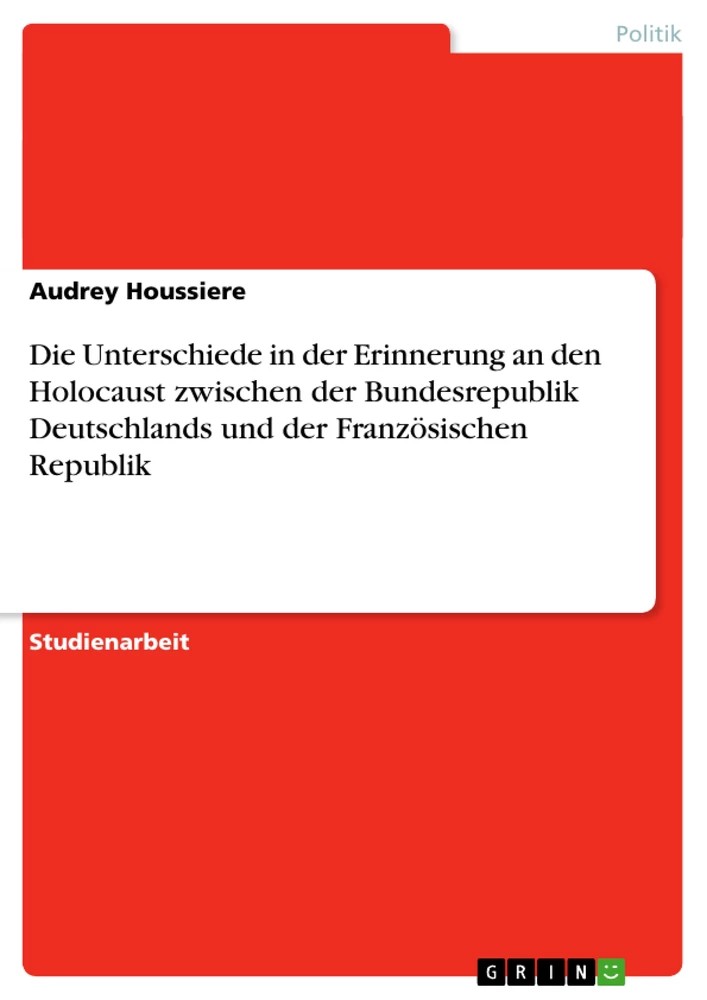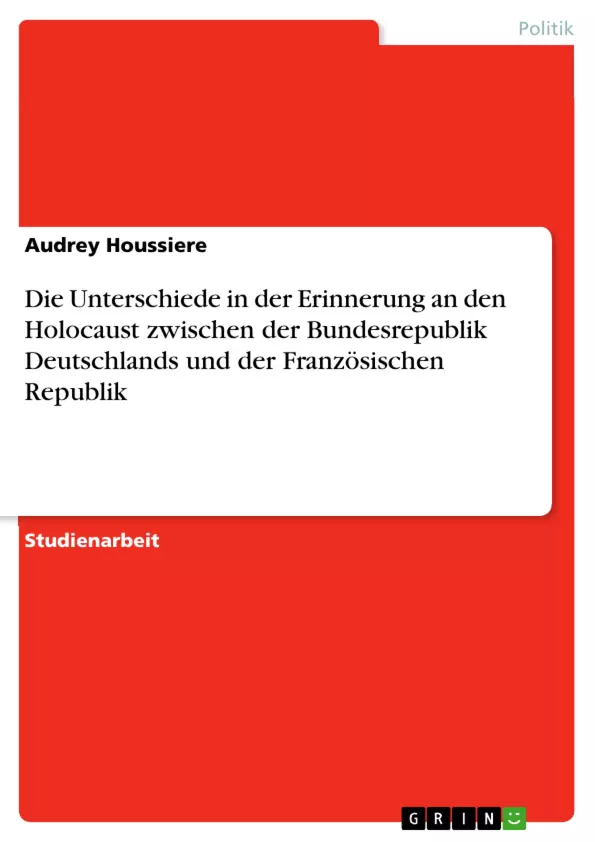[...] Diese Arbeit wird auf zwei Länder eingehen: die Bundesrepublik Deutschland und die
Französische Republik. Dabei soll insbesondere die politische Behandlung des Themas von
der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Neunziger Jahre im Zentrum stehen. In den beiden
Länder ist die Erinnerung jeweils vielfältig: Entschädigung, Anerkennung der Schuld,
Verdrängung oder sogar Leugnung. Der Umgang mit dem Holocaust ist umstritten und seit
1945 gab es verschiedene Vorstellungen von möglichen Erinnerungsformen. Hierbei kann
man jedoch deutliche Entwicklungslinien erkennen. Der Historiker Jörn Rüsen konstatiert
„drei zeitlich einander folgenden Einstellungen“3, die das historische Selbstbewusstsein der
Deutschen prägen: die Zeit von 1945 bis 1968 mit der Kriegs- und Wiederaufbaugeneration,
die von 1968 bis 1989 mit der Nachkriegsgeneration und schließlich die Zeit nach 1989. Für
die erste Epoche sei die Strategie des Verschweigens typisch, für die zweite die „moralische
Distanzierung“, und für die dritte die „Historisierung und Aneignung“. Für Frankreich lässt
sich eine ähnliche Entwicklung beobachten, wobei die Phase des Verdrängens noch länger
andauerte: eine systematische Aufarbeitung setzte hier erst später ein. Die These dieser Arbeit ist folgende: die Erinnerung an den Holocaust in Frankreich
und in Deutschland ist vom jeweiligen nationalen Kontext abhängig. Zu erörtern ist, inwiefern
die Erinnerung an den Holocaust von den Machthabern instrumentalisiert wird. Im Rahmen
dieser Arbeit gilt es zunächst, die Lage in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu untersuchen,
eine Epoche, die durch das Verschweigen der Verbrechen gekennzeichnet war. Anschließend
soll die Phase betrachtet werden, in der, wo u.a. Intellektuelle und Politiker angefangen
haben, den Holocaust zu thematisieren – wie beispielsweise den berühmten Historikerstreit in
Deutschland. Zum Schluss werde ich zeigen, wie die Errichtung nationaler Holocaust-
Mahnmale zur Versöhnung beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die unmittelbare Nachkriegszeit: die Mythen der Nationen.…….....
- 1.1 Das Verdrängen in der BRD
- 1.2 Der Nachkriegsmythos in Frankreich
- 2. Der Holocaust in der Öffentlichkeit.
- 2.1 Die Entstehung einer unterschiedlichen Erinnerungskultur im geteilten Deutschland....
- 2.2 << Le chagrin et la pitié ».
- 3. Eine,,Vergangenheit, die nicht vergehen will“.
- 3.1 Historikerstreit zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas......
- 3.2 Die umstrittene Deutung von Vichy..
- 4. Die Mahnmäler.....
- 4.1 Eine Bürgerinitiative als Ausgangspunkt für die Mahnmäler .......
- 4.2 Das Holocaust-Mahnmal in Berlin
- 4.3 Das Vél d'Hiv-Mahnmal.
- Schluss............
- Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede in der Erinnerung an den Holocaust zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik. Sie analysiert, wie die Erinnerung an den Holocaust von den jeweiligen nationalen Kontexten geprägt wurde und inwiefern sie von den Machthabern instrumentalisiert wurde. Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der Erinnerungskultur in beiden Ländern von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Neunziger Jahre.
- Die unterschiedlichen Erinnerungskulturen in Deutschland und Frankreich
- Die Rolle der Politik in der Gestaltung der Erinnerung an den Holocaust
- Die Instrumentalisierung der Erinnerung durch die Machthaber
- Die Entwicklung der Erinnerungskultur von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Neunziger Jahre
- Die Bedeutung nationaler Holocaust-Mahnmale für die Versöhnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor: Die Erinnerung an den Holocaust in Frankreich und in Deutschland ist vom jeweiligen nationalen Kontext abhängig. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichtspolitik im Bezug auf den Holocaust und die Bedeutung der Erinnerungskultur für die Verarbeitung der Vergangenheit.
Das erste Kapitel analysiert die unmittelbare Nachkriegszeit, die durch das Verschweigen der Verbrechen gekennzeichnet war. Es beleuchtet die unterschiedlichen Mythen der Nationen, die in dieser Zeit entstanden sind, und die Rolle der Verdrängung in der Erinnerungskultur beider Länder.
Das zweite Kapitel untersucht die Entstehung einer unterschiedlichen Erinnerungskultur im geteilten Deutschland und die Rolle von Filmen wie "Le chagrin et la pitié" in der öffentlichen Debatte über den Holocaust.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Historikerstreit zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas und der umstrittenen Deutung von Vichy. Es zeigt, wie die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in beiden Ländern zu unterschiedlichen Interpretationen der Geschichte führte.
Das vierte Kapitel analysiert die Rolle nationaler Holocaust-Mahnmale in der Versöhnung. Es beleuchtet die Entstehung der Mahnmale in Deutschland und Frankreich und ihre Bedeutung für die Erinnerung an die Opfer des Holocaust.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Holocaust, die Erinnerungskultur, die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die unmittelbare Nachkriegszeit, die Instrumentalisierung der Erinnerung, die Verdrängung, die Aufarbeitung der Vergangenheit, der Historikerstreit, die Mahnmale und die Versöhnung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Holocaust-Erinnerung in DE und FR?
Die Erinnerungskultur ist stark vom nationalen Kontext geprägt; in Frankreich dauerte die Phase der Verdrängung (Vichy-Regime) länger an als in der Bundesrepublik.
Was war der "Historikerstreit" in Deutschland?
Eine Debatte zwischen Ernst Nolte und Jürgen Habermas über die Einzigartigkeit des Holocaust und dessen Einordnung in die deutsche Geschichte.
Welche Rolle spielten Mythen in der Nachkriegszeit?
Beide Nationen nutzten Mythen (z.B. der Widerstand in Frankreich), um sich von der Schuld zu distanzieren und den nationalen Wiederaufbau zu fördern.
Was symbolisiert das Mahnmal "Vél d'Hiv" in Frankreich?
Es erinnert an die Massenverhaftungen jüdischer Bürger in Paris 1942 und markiert einen Wendepunkt in der Anerkennung französischer Kollaboration.
Wie trugen Mahnmale zur Versöhnung bei?
Nationale Mahnmale dienen der Anerkennung des Leids der Opfer und als sichtbares Zeichen der staatlichen Verantwortungsübernahme.
- Citar trabajo
- Audrey Houssiere (Autor), 2008, Die Unterschiede in der Erinnerung an den Holocaust zwischen der Bundesrepublik Deutschlands und der Französischen Republik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126561