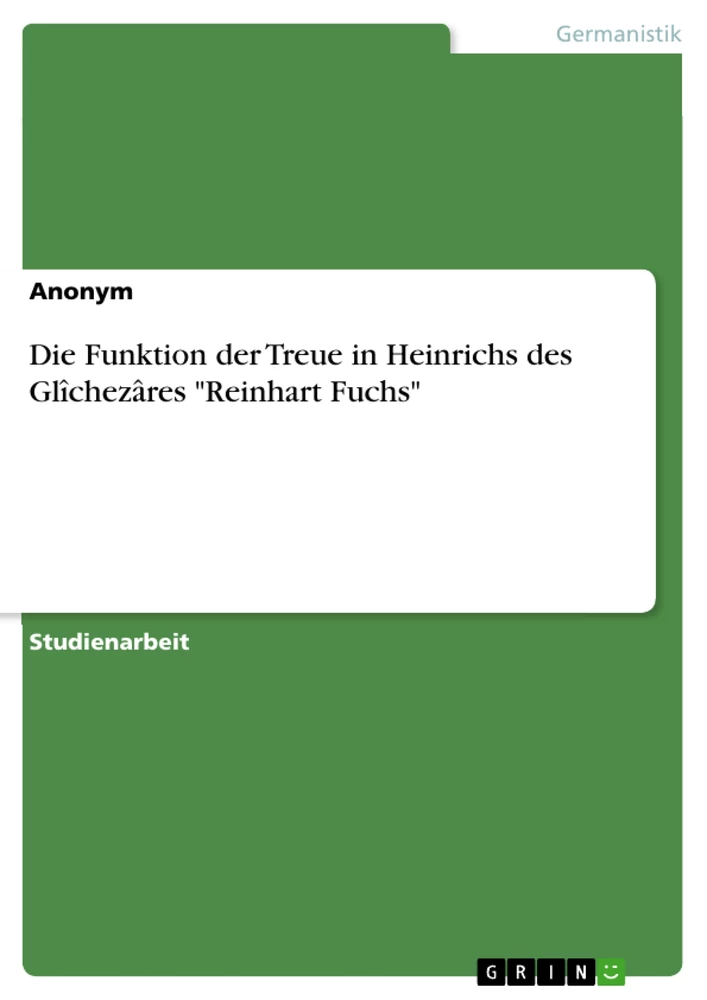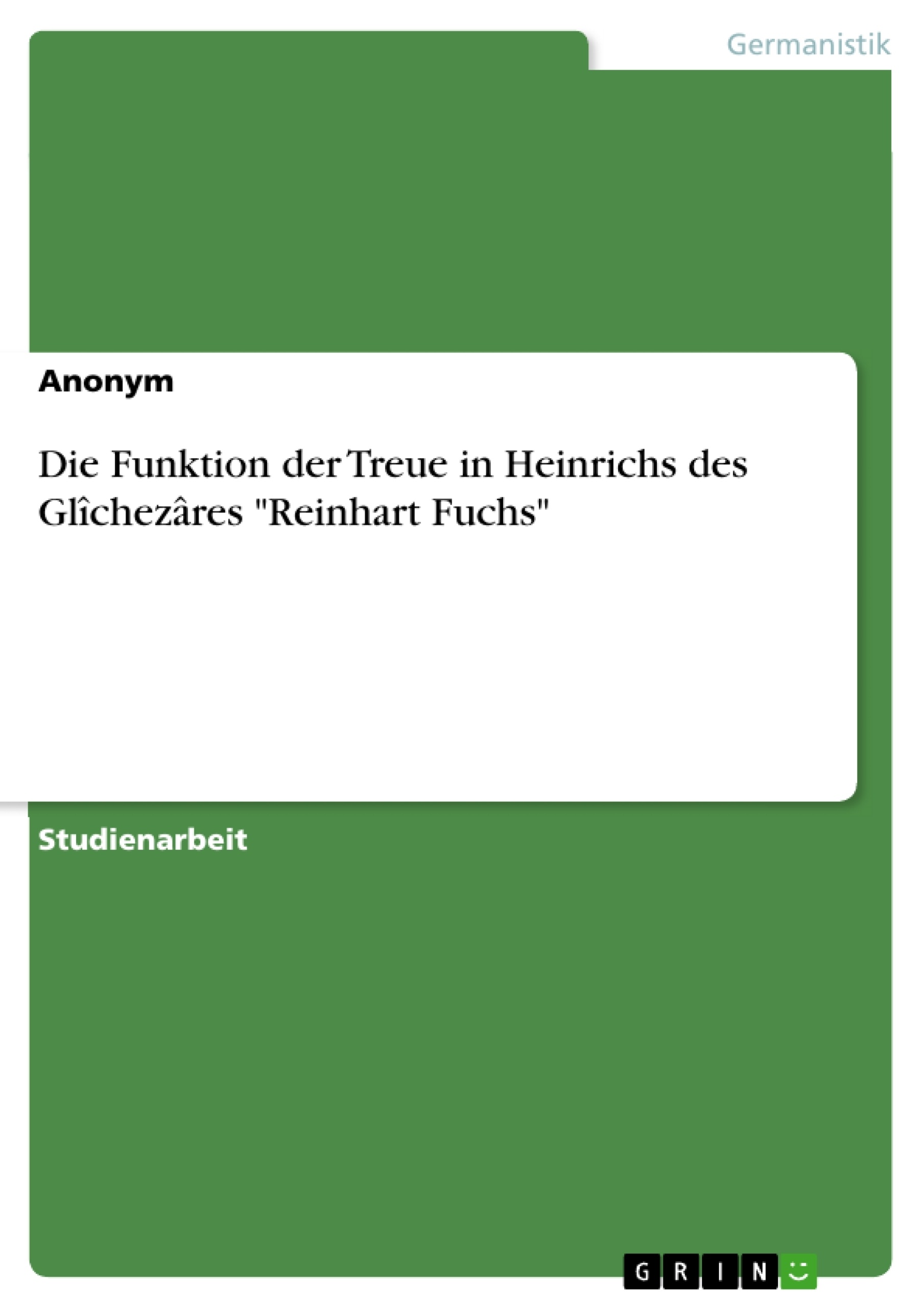Die Seminararbeit untersucht den Treuebegriff im mittelhochdeutschen Werk "Reinhart Fuchs" und stellt heraus, inwiefern der Treuebegriff zur Zeit des Mittelalters mit dem in dem Werk korreliert.
Da sich der heutige Treuebegriff stark von dem des Mittelalters unterscheidet, ist dies bei der Analyse des Textes zu beachten. Joachim Bumke bemängelt, dass eine zusammenfassende Analyse der hofkritischen Motive in der mittelhochdeutschen Literatur fehle. Die Ergebnisse dieser Hausarbeit könnten diesen Prozess jedoch unterstützen, indem herausgestellt wird, inwiefern das Prinzip der Treue in "Reinhart Fuchs" umgesetzt wird.
Dazu wird zuerst der Treuebegriff im Mittelalter näher beschrieben, um ein Verständnis für den gesellschaftlich-historischen Kontext des Werkes zu schaffen. Daran anschließend werden ausgewählte Textstellen des Tierepos herangezogen, um zu verdeutlichen, inwiefern Reinhart die mittelalterlichen Regeln bezüglich der Treue in verschiedenen Episoden des Werkes umsetzt. Dadurch soll verdeutlicht werden, welche Bedeutung der Treue in "Reinhart Fuchs" zukommt und wie der Fuchs diese zu seinem Vorteil nutzt, um andere Tiere heimtückisch zu hintergehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse
- Die Bedeutung der Treue im Mittelalter
- Textanalyse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Funktion der Treue im mittelhochdeutschen Tierepos „Reinhart Fuchs“ von Heinrich dem Glîchezâren. Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung der Treue im mittelalterlichen Kontext aufzuzeigen und zu analysieren, inwiefern diese in der Handlung des Werkes zum Ausdruck kommt, insbesondere im Hinblick auf die Figur des Fuchses Reinhart.
- Die Bedeutung der Treue im Mittelalter
- Die Rolle der Treue im Tierepos „Reinhart Fuchs“
- Die Figur des Fuchses Reinhart als Repräsentant der Untreue
- Die Folgen von Untreue für die Figuren im Werk
- Der Einfluss des mittelalterlichen Wertesystems auf die Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die historische und literarische Bedeutung von „Reinhart Fuchs“. Sie stellt den historischen Kontext der Treue im Mittelalter dar und gibt einen Überblick über die Figur des Fuchses Reinhart.
Das Kapitel „Analyse“ befasst sich mit dem mittelalterlichen Verständnis der Treue und erörtert den Einfluss der höfischen Kultur auf die Ethische Bedeutung der Treue. Die Textanalyse untersucht exemplarische Textstellen, um zu verdeutlichen, wie Reinhart die Prinzipien der Treue im Werk umsetzt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Funktion der Treue im Tierepos „Reinhart Fuchs“ von Heinrich dem Glîchezâren. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung des mittelalterlichen Treuebegriffes, die Figur des Fuchses Reinhart als Repräsentanten der Untreue und die Folgen von Untreue im Werk.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Seminararbeit zu „Reinhart Fuchs“?
Die Arbeit untersucht die Funktion und Bedeutung des Treuebegriffs im mittelhochdeutschen Tierepos „Reinhart Fuchs“ von Heinrich dem Glîchezâren im Vergleich zum mittelalterlichen Gesellschaftskontext.
Wie unterscheidet sich der mittelalterliche Treuebegriff von der heutigen Vorstellung?
Im Mittelalter war Treue ein zentrales Prinzip der gesellschaftlichen Ordnung und der höfischen Kultur, das weit über persönliche Loyalität hinausging und rechtliche sowie ethische Bindungen umfasste.
Wie nutzt die Figur Reinhart Fuchs das Prinzip der Treue aus?
Reinhart Fuchs repräsentiert die Untreue; er nutzt die Erwartungshaltung und die Regeln der Treue seiner Mitstreiter aus, um sie heimtückisch zu hintergehen und seine eigenen Ziele zu erreichen.
Welche Rolle spielt die Hofkritik in dieser Analyse?
Die Arbeit greift die von Joachim Bumke angemahnte fehlende Analyse hofkritischer Motive auf, indem sie zeigt, wie das Werk das Versagen des höfischen Wertesystems durch die Figur des Fuchses persifliert.
Was sind die Folgen von Untreue im Werk?
Die Textanalyse zeigt, dass Untreue zur Destabilisierung der Gemeinschaft führt und drastische Konsequenzen für die betroffenen Figuren hat, was den moralischen Kern des Tierepos unterstreicht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Funktion der Treue in Heinrichs des Glîchezâres "Reinhart Fuchs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1266578