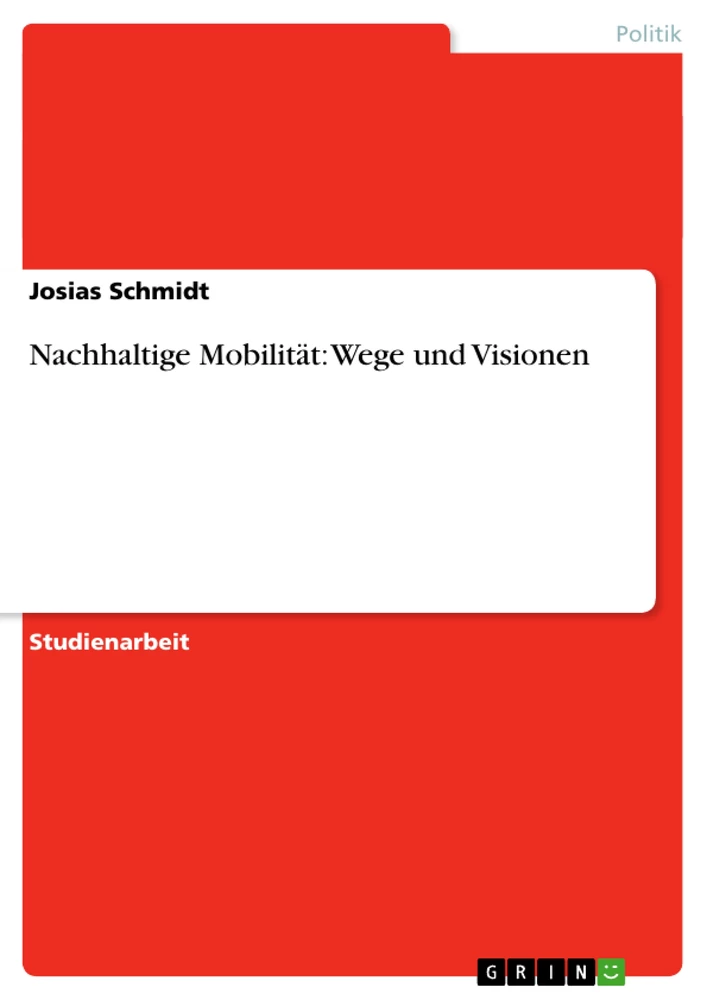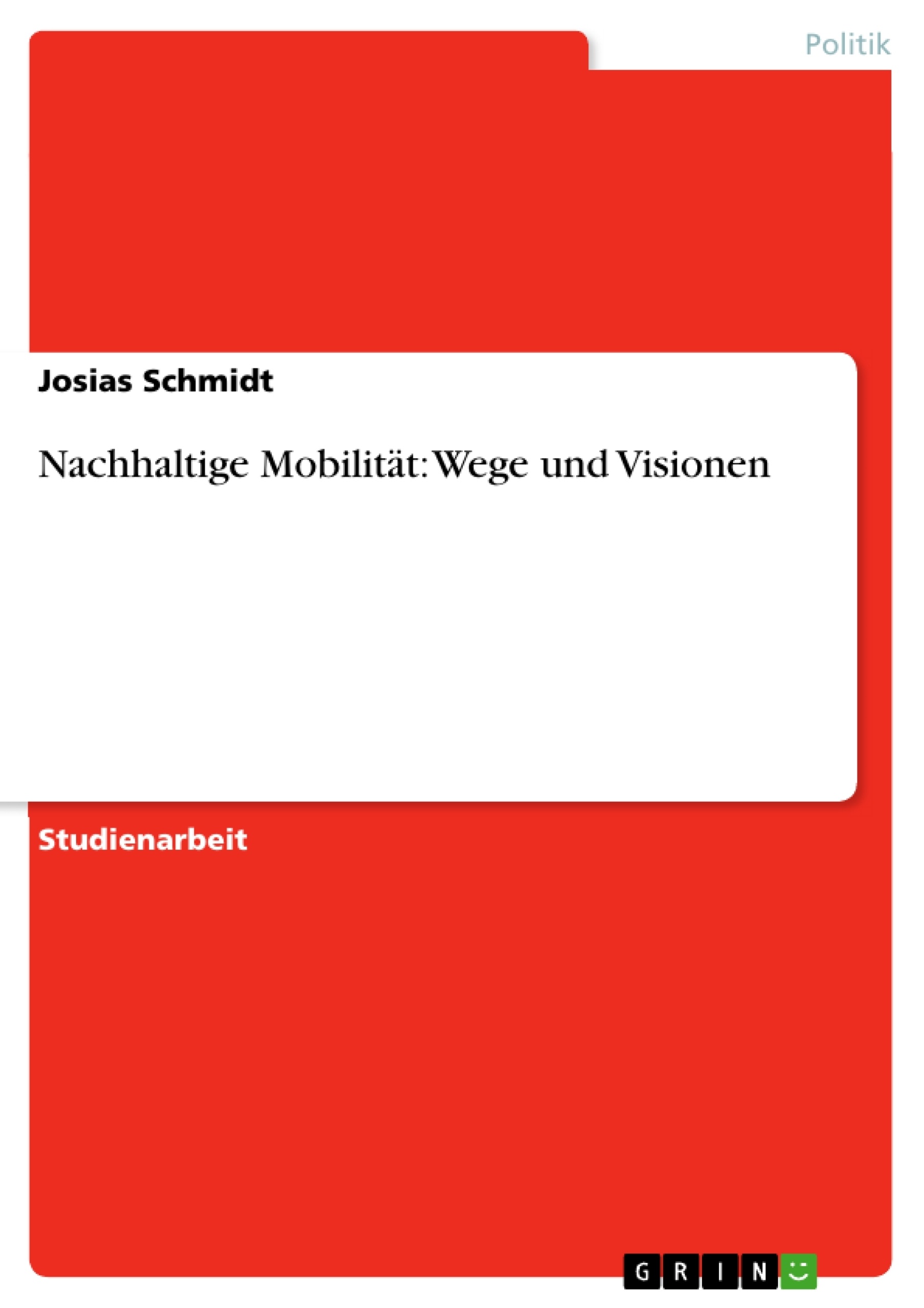Beginnen wir damit: Die Weltgemeinschaft hat die Ernsthaftigkeit des Klimaproblems erkannt und in die Öffentlichkeit getragen, um eine breite Unterstützung von der Wirtschaftselite bis zum Angestellten und Arbeiter zu erreichen.
Der erste Schritt in dieser Richtung war die Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention auf dem „Erdgipfel“ in Rio de Jeneiro, 1992. Das „Endziel“ - schon in dieser Formulierung liegt die unabdingbare Notwendigkeit des Handels – sieht vor, „die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Ein solches Niveau sollte innerhalb eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann."
Dem Abkommen folgte 1997 das Kyotoprotokoll. Und mit ihm erste konkrete Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in die Atmosphäre. Dieses, in ihrem Ziel notwendige aber ihrer Wirkung umstrittene Maßnahmenpaket, bedarf einer Fortsetzung nach 2012. Die Klimakonferenz in Posen sollte ein Folgeabkommen vorbereiten. Wie gesagt, sollte. Denn die Urteile der Medien lassen nur eines erkennen: Es gibt schöne Worte, aber wenig Konkretes. So bleibt die Feststellung: Die „Klimakonferenz endet ernüchternd" (SZ-online: 13.12.2008). Und da erscheint auch die Aussage Hermann Scheers, dass die Weltklimakonferenzen den „anhaltenden Weltkrieg gegen die Natur" nicht beenden konnten, (Scheer 2002: 6) aktueller denn je.
Es bedarf also konkreter Maßnahmen, statt schöner Worte! Da der Mobilitätssektor etwa die Hälfte der weltweiten Umweltschäden verursacht, zeigt sich hier enormer Handlungsbedarf, um der Klimaveränderung und der Umweltzerstörung entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Erster Gang, zweiter Gang, Rückwärtsgang – Rio de Janeiro, Kyoto, Posen?
- Mobilität – Einführung in die Problemstellung
- Was ist Mobilität?
- Die Geschichte von Mobilität und Verkehr
- Die Notwendigkeit zur Veränderung erkennen
- Verkehrsaufkommen als strukturelles Problem
- Siedlungsstrukturen und Mobilitätsverhalten
- Neue Siedlungskonzepte im Spiegel demografischer und sozialökonomischer Veränderungen
- Mobilität und Verkehr in der globalen Weltwirtschaft
- Alternativen zum individuellen Personenkraftverkehr
- Der öffentliche Personennahverkehr
- Zu Fuß und mit dem Fahrrad
- Mit der Bahn oder mit dem Flugzeug?
- Zukünftige Mobilität umweltverträglich gestalten
- Das Potenzial einer Suffizienzstrategie
- Die Effizienzstrategie – Eine Sackgasse?
- Alternative Antriebstechniken
- Alternativen zu Diesel – Biodiesel und Pflanzenöl
- Alternativen zu Benzin - Bioethanol, Biogas
- Biokraftstoffe der zweiten Generation
- Elektrische Alternativen – Methanol, Wasserstoff, Strom
- Mobilität und Nachhaltigkeit – Ein Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Problematik der nachhaltigen Mobilität und analysiert die Herausforderungen und Chancen einer umweltverträglichen Gestaltung des Verkehrssektors. Ziel ist es, die Notwendigkeit einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens aufzuzeigen und alternative Konzepte und Technologien zu beleuchten.
- Die Folgen des Klimawandels und die Rolle des Verkehrssektors
- Die Geschichte der Mobilität und die Entwicklung des Verkehrsaufkommens
- Die Bedeutung von Siedlungsstrukturen und Mobilitätsverhalten
- Alternative Antriebstechniken und ihre Potenziale
- Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Verkehrspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die globale Bedeutung des Klimaproblems und die Notwendigkeit von konkreten Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Es wird die Entwicklung von der Klimarahmenkonvention in Rio de Janeiro über das Kyotoprotokoll bis hin zur Klimakonferenz in Posen dargestellt und die Notwendigkeit von konkreten Maßnahmen im Mobilitätssektor hervorgehoben.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Mobilität und erläutert die Geschichte des Verkehrs und die Entwicklung der Motorisierung. Es werden die externen Kosten des Verkehrssektors und die Notwendigkeit einer Veränderung des Mobilitätsverhaltens aufgezeigt.
Das dritte Kapitel analysiert das Verkehrsaufkommen als strukturelles Problem und untersucht die Zusammenhänge zwischen Siedlungsstrukturen und Mobilitätsverhalten. Es werden neue Siedlungskonzepte im Spiegel demografischer und sozialökonomischer Veränderungen betrachtet und die Rolle des Verkehrs in der globalen Weltwirtschaft beleuchtet.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene Alternativen zum individuellen Personenkraftverkehr vor, darunter den öffentlichen Personennahverkehr, das Fahrrad und die Bahn. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Verkehrsmittel diskutiert und die Bedeutung einer multimodalen Verkehrsplanung hervorgehoben.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Gestaltung einer umweltverträglichen Mobilität der Zukunft. Es werden verschiedene Strategien zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Schadstoffemissionen vorgestellt, darunter Suffizienzstrategien, Effizienzstrategien und alternative Antriebstechniken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen nachhaltige Mobilität, Verkehrssektor, Klimawandel, CO2-Emissionen, alternative Antriebstechniken, Siedlungsstrukturen, Mobilitätsverhalten, öffentliche Personennahverkehr, Suffizienzstrategie, Effizienzstrategie, Biokraftstoffe, Elektromobilität, nachhaltige Verkehrspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist nachhaltige Mobilität für den Klimaschutz so wichtig?
Der Mobilitätssektor verursacht etwa die Hälfte der weltweiten Umweltschäden, weshalb hier ein enormer Handlungsbedarf zur CO2-Reduktion besteht.
Was unterscheidet Suffizienz- von Effizienzstrategien?
Suffizienzstrategien setzen auf Verhaltensänderung und Reduktion, während Effizienzstrategien auf technologische Verbesserungen zur Ressourceneinsparung abzielen.
Welche alternativen Antriebstechniken werden in der Arbeit diskutiert?
Diskutiert werden Biodiesel, Bioethanol, Biogas, Wasserstoff, Methanol sowie rein elektrische Antriebe und Biokraftstoffe der zweiten Generation.
Welchen Einfluss hat die Siedlungsstruktur auf das Verkehrsaufkommen?
Zersiedelung führt zu höherem Mobilitätsbedarf; neue Siedlungskonzepte versuchen, Verkehr durch demografisch angepasste Strukturen zu vermeiden.
Was war die Bedeutung der Klimakonferenzen von Rio und Kyoto?
Rio (1992) legte den Grundstein mit der Klimarahmenkonvention; Kyoto (1997) legte erstmals konkrete Maßnahmen zur CO2-Reduktion fest.
- Citation du texte
- Josias Schmidt (Auteur), 2009, Nachhaltige Mobilität: Wege und Visionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126672