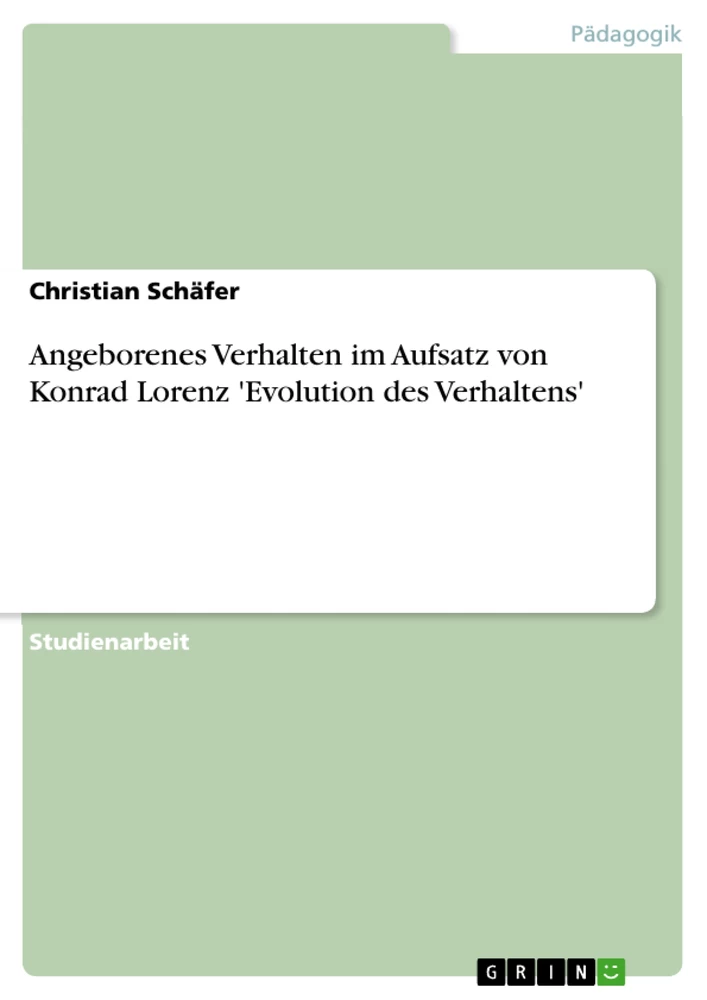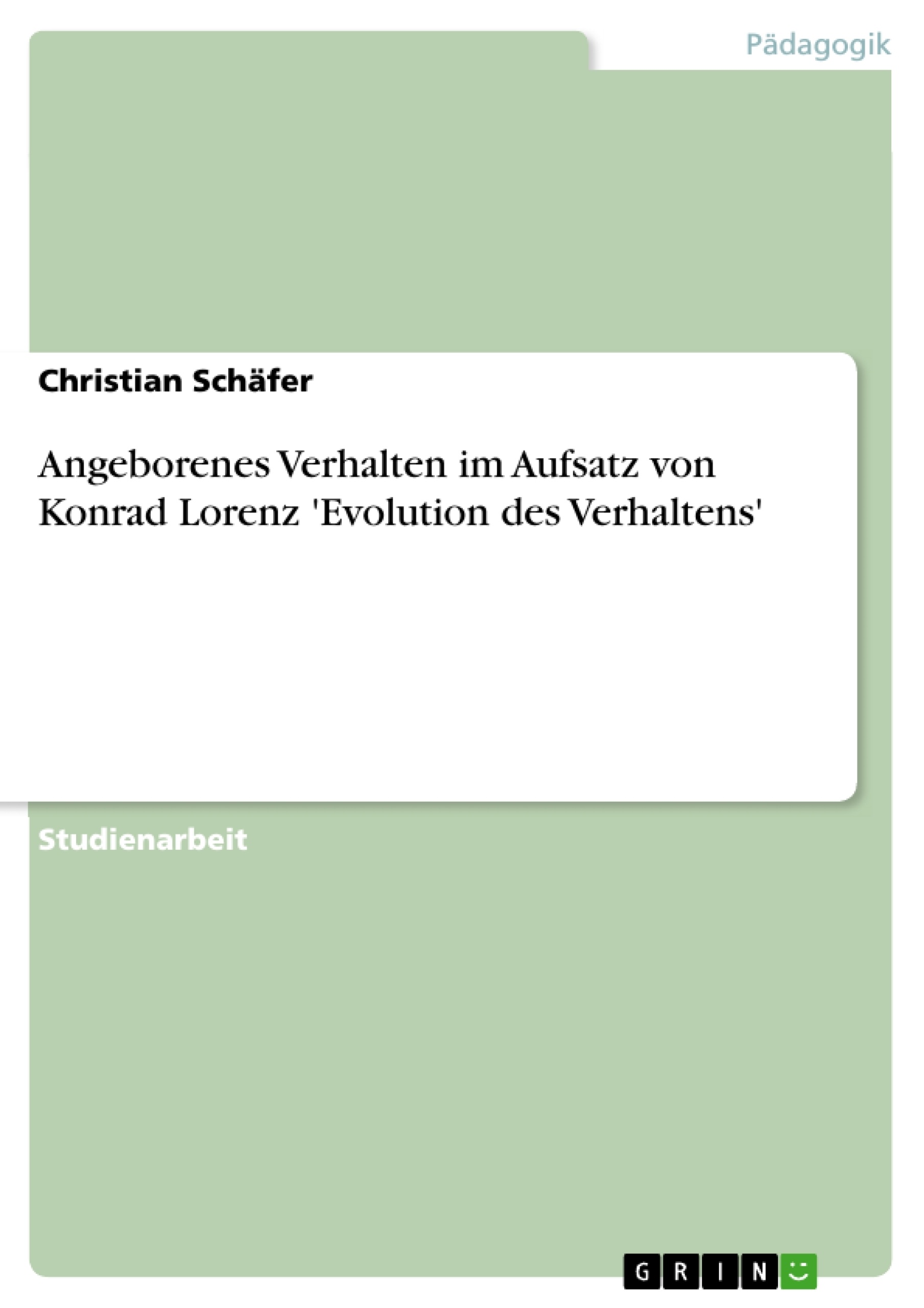1. Einleitung
1.1 Kurzer Biographischer Exkurs zu Konrad Lorenz und Einführung in die von ihm erforschte vergleichende Ethologie
Der Österreicher Prof. Dr. med. Dr. Phil. Konrad Zacharias Lorenz wurde am 7. November 1903 in Wien als Sohn des Orthopäden Dr. Adolf Lorenz und seiner Frau Emma geboren. Nach einer ereignisreichen Wissenschaftskarriere und zahlreichen medizinischen und wissenschaftlichen Verwendungen, wurde ihm im Jahre 1973, zusammen mit Karl von Frisch und Nikolaas Tinbergen, der Nobelpreis für Medizin und Physiologie verliehen. Dies war die Ehrenerweisung für Bahnbrechende Errungenschaften in der vergleichenden Verhaltensforschung. Die Max-Planck-Gesellschaft schuf für ihn daraufhin die Forschungsstation Grünau im Almtal, wo er, im Rahmen des Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, seine Forschungen fortsetzte. Konrad Lorenz verstarb am 27. Februar 1989. Sein Geistiges Erbe ist der Grundstein für eine Vielzahl der heutigen Erkenntnisse und seine wissenschaftlichen Arbeiten belegen seine Position als Nestor der vergleichenden Verhaltensforschung. Schon in der Historie wurde die Wissenschaft der Verhaltensforschung von den Menschen mit einem speziellen Interesse verfolgt. Das dieser Teilbereich der Biologie eine solche Popularität genießt, liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass der Forschungsgegenstand der Ethologie Erfahrungen aus dem unmittelbaren alltäglichen Umfeld untersucht. Dies bedeutet, die Forschungsergebnisse werden für den Interessierten greifbar und nachvollziehbar, selbst ohne eine wissenschaftliche Vorbildung. Konrad Lorenz verstand die Kunst seine festgestellten Ergebnisse, Beobachtungen und Erlebnisse selbst für einen Laien zugänglich zu machen und den Leser oder Zuhörer, durch seine faszinierende Art Wissen zu vermitteln, mitzureißen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Kurzer Biographischer Exkurs zu Konrad Lorenz und Einführung in die von ihm erforschte vergleichende Ethologie
- 2. Hauptteil
- 2.1. Historie der Verhaltensforschung
- 2.2. Definition und Beschreibung Angeborenen Verhaltens
- 2.3. Erbkoordination und Appetenzverhalten
- 2.4. Der Angeborene Auslösemechanismus
- 2.5. Entstehung komplexer Systeme aus Erbkoordination und AAM
- 3. Schluss
- 3.1. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text bietet eine Einführung in die vergleichende Ethologie anhand des Aufsatzes „Angeborenes Verhalten“ von Konrad Lorenz. Die Zielsetzung ist es, Lorenz' Werk und seine Bedeutung für das Verständnis angeborenen Verhaltens zu erläutern und die historischen Entwicklungen der Verhaltensforschung zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung der Verhaltensforschung und die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze.
- Definition und Beschreibung von angeborenem Verhalten, inklusive der Unterscheidung zwischen geschlossenen und offenen Programmen.
- Die Rolle von Erbkoordination und Appetenzverhalten im Kontext angeborener Verhaltensweisen.
- Die Bedeutung von Konrad Lorenz' Werk für die moderne Verhaltensforschung.
- Der Einfluss von Umwelt und Erfahrung auf angeborene Verhaltensmuster.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Leben und Werk von Konrad Lorenz ein, dem Begründer der modernen vergleichenden Verhaltensforschung. Sie hebt seine wissenschaftlichen Leistungen hervor und betont die Bedeutung seiner Arbeit für unser heutiges Verständnis von Tierverhalten. Es wird die Zugänglichkeit seiner Forschung für ein breites Publikum hervorgehoben und sein Einfluss auf die Fragestellungen im Bereich des beobachtbaren Verhaltens bei Tieren beschrieben. Die Einleitung bereitet den Leser auf die folgenden Ausführungen zum Thema „Angeborenes Verhalten“ vor, die größtenteils auf Lorenz' Arbeiten basieren.
2. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit einem historischen Überblick über die Verhaltensforschung, der die unterschiedlichen Ansätze, wie den Behaviorismus und die vitalistische Schule, darstellt und ihre jeweiligen Schwächen und Stärken beleuchtet. Die Entwicklung des Verständnisses von angeborenem Verhalten wird nachgezeichnet, beginnend mit den Arbeiten von Whitman und Heinroth, die die evolutionäre Veränderlichkeit von morphologischen und Verhaltensmerkmalen aufzeigten. Der Hauptteil definiert und beschreibt dann detailliert angeborenes Verhalten, inklusive der Unterscheidung zwischen "geschlossenen" und "offenen" Programmen nach Mayr, und erläutert den Einfluss von Umweltfaktoren und Lernerfahrungen. Schließlich werden Erbkoordination und Appetenzverhalten als zentrale Aspekte angeborener Verhaltensweisen erklärt.
Schlüsselwörter
Angeborenes Verhalten, Vergleichende Ethologie, Konrad Lorenz, Erbkoordination, Appetenzverhalten, Verhaltensforschung, Instinkt, Evolution, geschlossene Programme, offene Programme, Phylogenese, Behaviorismus, Vitalismus.
Häufig gestellte Fragen zu "Angeborenes Verhalten" von Konrad Lorenz
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Einführung in die vergleichende Ethologie, basierend auf Konrad Lorenz' Werk "Angeborenes Verhalten". Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Text beleuchtet die historische Entwicklung der Verhaltensforschung, definiert und beschreibt angeborenes Verhalten, erklärt Erbkoordination und Appetenzverhalten und diskutiert den Einfluss von Lorenz' Arbeit auf die moderne Verhaltensforschung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die historische Entwicklung der Verhaltensforschung (inkl. Behaviorismus und Vitalismus), die Definition und Beschreibung von angeborenem Verhalten (geschlossene und offene Programme), Erbkoordination und Appetenzverhalten, die Bedeutung von Konrad Lorenz' Arbeit und der Einfluss von Umwelt und Erfahrung auf angeborene Verhaltensmuster.
Wer ist Konrad Lorenz und welche Rolle spielt er im Text?
Konrad Lorenz ist der Begründer der modernen vergleichenden Verhaltensforschung. Der Text verwendet seine Arbeit als Grundlage, um das Verständnis von angeborenem Verhalten zu erläutern und seine Bedeutung für die Verhaltensforschung hervorzuheben. Sein biographischer Hintergrund wird kurz skizziert.
Was sind Erbkoordination und Appetenzverhalten?
Der Text erklärt Erbkoordination und Appetenzverhalten als zentrale Aspekte angeborener Verhaltensweisen. Genaueres wird im Hauptteil des Textes erläutert, der auf Lorenz' Arbeit basiert.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert. Die Einleitung führt in Lorenz' Leben und Werk ein. Der Hauptteil behandelt die historische Entwicklung der Verhaltensforschung, die Definition und Beschreibung von angeborenem Verhalten sowie Erbkoordination und Appetenzverhalten. Der Schluss enthält abschließende Bemerkungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Angeborenes Verhalten, Vergleichende Ethologie, Konrad Lorenz, Erbkoordination, Appetenzverhalten, Verhaltensforschung, Instinkt, Evolution, geschlossene Programme, offene Programme, Phylogenese, Behaviorismus, Vitalismus.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich einen Überblick über die vergleichende Ethologie und das Konzept des angeborenen Verhaltens verschaffen möchten. Die Zugänglichkeit des Textes für ein breites Publikum wird betont.
Welche wissenschaftlichen Ansätze werden im Text verglichen?
Der Text vergleicht verschiedene wissenschaftliche Ansätze in der Verhaltensforschung, insbesondere den Behaviorismus und die vitalistische Schule, und beleuchtet deren Stärken und Schwächen.
Wie wird angeborenes Verhalten im Text definiert?
Der Text definiert angeborenes Verhalten detailliert und unterscheidet zwischen "geschlossenen" und "offenen" Programmen nach Mayr. Er erläutert auch den Einfluss von Umweltfaktoren und Lernerfahrungen auf angeborene Verhaltensmuster.
Welche Bedeutung hat Lorenz' Arbeit für die moderne Verhaltensforschung?
Der Text hebt die große Bedeutung von Lorenz' Arbeit für unser heutiges Verständnis von Tierverhalten und die moderne Verhaltensforschung hervor.
- Arbeit zitieren
- Christian Schäfer (Autor:in), 2002, Angeborenes Verhalten im Aufsatz von Konrad Lorenz 'Evolution des Verhaltens', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1266