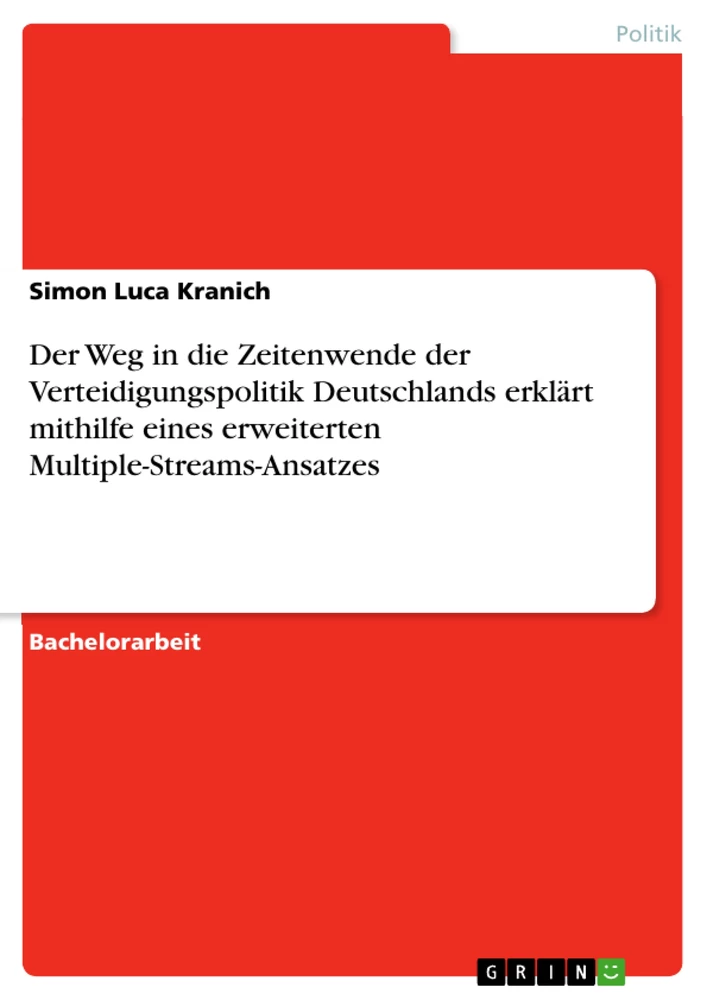In einer Bundestags-Sondersitzung am 27. Februar 2022 hatte Deutschlands Bundeskanzler Scholz (SPD) die Errichtung eines Sondervermögens und dessen Verankerung im Grundgesetz angekündigt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kriegseskalation zwischen Russland und der Ukraine soll aus Mitteln dieses Sondervermögens die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr gestärkt werden. Die Gesetze, welche das Bundesfinanzministerium ermächtigen Kredite von bis zu 100 Milliarden Euro aufzunehmen, wurden am 3. Juni 2022 verabschiedet.
Mithilfe eines erweiterten Multiple-Streams-Ansatzes wurde im Rahmen dieser Arbeit der Weg in die sogenannte „Zeitenwende“ in der Verteidigungspolitik Deutschlands analysiert. Von Interesse waren vor allem die für den Zeitpunkt des Agenda-Wandels entscheidenden Faktoren und Akteure. Unterstützend hierzu erfolgte die Überprüfung von zuvor aufgestellten Hypothesen, denen überdies eine ansatztestende Wirkung zukam. 9 der 13 Hypothesen konnten vollständig bestätigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Multiple-Streams-Ansatz, Erweiterung und Hypothesen
- Erweiterung des Ansatzes
- Hypothesen
- Analyse der drei Ströme des vorliegenden Falls
- Der Problem-Strom
- Der Politics-Strom
- Der Policy-Strom
- Kopplung der Ströme, Problem-Fenster und Agenda-Wandel
- Hypothesenprüfung
- Ausblick und Fazit
- Anhang
- Literatur-, Quellen- und Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Weg in die „Zeitenwende“ der deutschen Verteidigungspolitik mithilfe eines erweiterten Multiple-Streams-Ansatzes. Das Ziel ist es, die entscheidenden Faktoren und Akteure zu identifizieren, die den Agenda-Wandel im Kontext der jüngsten Eskalation des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst haben. Zusätzlich werden Hypothesen aufgestellt und überprüft, um den Ansatz zu testen und seine Gültigkeit für den vorliegenden Fall zu beleuchten.
- Die Rolle des Krieges zwischen Russland und der Ukraine in der Transformation der deutschen Verteidigungspolitik
- Der Einfluss der öffentlichen Meinung und der politischen Akteure auf den Agenda-Wandel
- Die Analyse der drei Ströme des Multiple-Streams-Ansatzes: Problem, Politics und Policy
- Die Kopplung der Ströme und die Entstehung eines Problem-Fensters
- Die Überprüfung der Hypothesen und deren Beitrag zur Erklärung des Agenda-Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über den Kontext der „Zeitenwende“ in der deutschen Verteidigungspolitik und stellt die Forschungsfrage nach den Faktoren und Akteuren des Agenda-Wandels.
- Das zweite Kapitel beschreibt den Multiple-Streams-Ansatz, erläutert notwendige Erweiterungen und formuliert Hypothesen, die in der Arbeit überprüft werden sollen.
- Das dritte Kapitel analysiert die drei Ströme des Multiple-Streams-Ansatzes: Problem, Politics und Policy. Es beleuchtet die relevanten Ereignisse, Akteure und Entscheidungen, die den Wandel der deutschen Verteidigungspolitik beeinflusst haben.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Kopplung der drei Ströme, der Entstehung eines Problem-Fensters und dem daraus resultierenden Agenda-Wandel.
- Das fünfte Kapitel überprüft die aufgestellten Hypothesen anhand der gewonnenen Ergebnisse und bewertet deren Gültigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Transformation der deutschen Verteidigungspolitik, die „Zeitenwende“, den Multiple-Streams-Ansatz, Agenda-Wandel, Problem-Fenster, Krieg zwischen Russland und der Ukraine, öffentliche Meinung, politische Akteure, Bundeswehr, Verteidigungsfähigkeit und Hypothesenprüfung.
- Citar trabajo
- Simon Luca Kranich (Autor), 2022, Der Weg in die Zeitenwende der Verteidigungspolitik Deutschlands erklärt mithilfe eines erweiterten Multiple-Streams-Ansatzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1267072