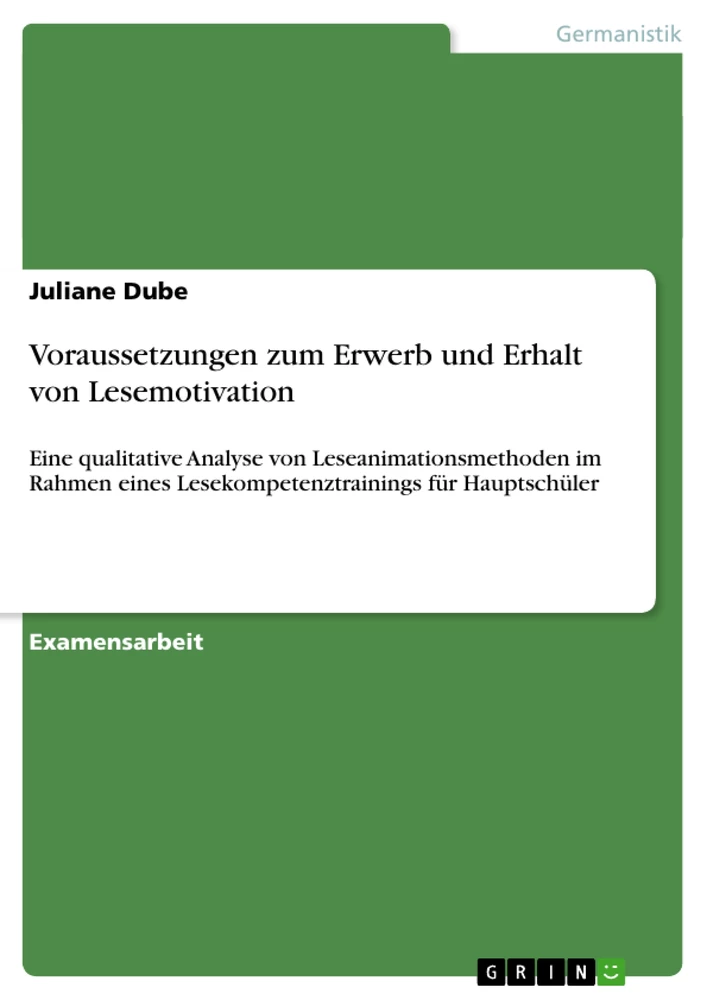[...] Im Hauptteil der Arbeit wird anschließend eine Auswahl an Leseanimationsverfahren
vorgestellt und mithilfe von qualitativen und quantitativen Instrumenten
hinsichtlich ihrer Wirkung bzw. in ihrer Funktion als Voraussetzung
zur Ausbildung von Lesemotivation bei zehn Hauptschülern der Albert-
Schweitzer-Schule (ASS) in Oberhausen evaluiert und diskutiert. Die Verfahren
werden in diesem und dem darauffolgenden Kapitel zusammen mit einigen
Informationen zum programmatischen Kontext der Leseförderung in ihrem
Aufbau vorgestellt, im Bezug auf ihre schulische Umsetzung analysiert und in
ihrer Effektivität auf das Leseverhalten und die Lesemotivation der ausgewählten
Kohorte gemessen. Demzufolge besteht das Ziel der Arbeit nicht nur darin
herauszufinden, ob die schulische Ausbildung mithilfe von Leseanimationsverfahren
als Voraussetzung zur Ausbildung von Lesemotivation dem zunehmenden
Rückgang der Lesemotivation und der Buchlektüre im Freizeitbereich heutiger
Jugendlicher entgegen wirken kann, sondern vor allem darin zu analysieren,
wie sich die Leseanimationsverfahren auf die Lesehaltung und die Wertstellung
des Buches bei leseabstinenten Schülern auswirken können. Im Anschluss
an die Vorstellung und Synthese der Ergebnisse ziehe ich im fünften
Kapitel Schlussfolgerungen für die schulische Praxis. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Motivation als notwendige Bedingung zum Aufbau von Lesekompetenz
- Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Formale Verfahrensweisen zur Erhebung
- Grundlegendes zum Lesen, zur Lesesozialisation und zur Lesemotivation
- Historische Entwicklung des Lesens (und die Angst vor dem Untergang der Bücherkultur)
- Lesesozialisation – ein Überblick zu Phasen und Einflussfaktoren
- Lesemotivation
- Motivation und Lesen
- Intrinsische und extrinsische Lesemotivation
- Forschungskontext und Ergebnisse der Voruntersuchung zur Analyse von Leseanimationsverfahren
- Lesekompetenztraining „Lesen(d) lernen“ an Oberhausener Hauptschulen – eine Initiative der städtischen Sparkasse und des Oberhausener Schulamts
- Zur Situation in der Leseklasse – Testumgebung
- Ergebnisse der Voruntersuchung
- Darstellung und Evaluierung ausgesuchter Methoden als Voraussetzung zum Erwerb von Lesemotivation
- Einfach lesen
- Bibliotheken/Bücherkisten und die Arbeit mit dem Leseausweis
- Feste Lesezeiten
- Lesevertrag
- Vielfältige Situationen zum Umgang mit Büchern
- Lesetheater
- Lesen und neue Medien
- Erstellen eines Hörbuchs
- Synthese und Diskussion der Evaluationsergebnisse
- „Lesen lernt man nur durch Lesen“ – Schlussfolgerungen der Arbeit für den Deutschunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Voraussetzungen zum Erwerb und Erhalt von Lesemotivation bei Hauptschülern. Sie analysiert verschiedene Leseanimationsmethoden im Rahmen eines Lesekompetenztrainings und bewertet deren Wirksamkeit hinsichtlich der Steigerung der Lesemotivation und der Verbesserung der Einstellung zum Lesen bei leseabstinenten Schülern.
- Bedeutung von Lesemotivation für den Aufbau von Lesekompetenz
- Einflussfaktoren auf Lesesozialisation und Lesemotivation (Familie, Schule, Freunde)
- Qualitative und quantitative Analyse von Leseanimationsmethoden (Bibliotheksarbeit, Lesekisten, feste Lesezeiten, Leseverträge, Lesetheater, Hörbuchproduktion)
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext der schulischen Praxis und Entwicklung von Schlussfolgerungen für den Deutschunterricht
- Forderung nach Trennung von Literatur- und Leseunterricht an Hauptschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Bedeutung von Lesemotivation für den Aufbau von Lesekompetenz. Es werden die Ergebnisse der PISA-Studie sowie weitere Studien zum Leseverhalten und zur Leseförderung vorgestellt, die die Notwendigkeit einer intensiven Leseförderung in allen Schulstufen betonen.
Im zweiten Kapitel wird die Lesesozialisation als ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Lesemotivation behandelt. Die Arbeit untersucht die einzelnen Phasen der Lesesozialisation und ihre wichtigsten Einflussfaktoren: Familie, Schule und Freunde. Sie zeigt, dass eine frühzeitige und intensive Leseförderung, insbesondere im familiären Umfeld, entscheidend für die Entwicklung eines positiven Verhältnisses zum Lesen ist.
Kapitel drei beleuchtet den Forschungskontext der Arbeit und stellt das Lesekompetenztraining „Lesen(d) lernen“ an Oberhausener Hauptschulen vor. Es werden die Ziele und Methoden des Programms erläutert, sowie die Situation der Leseklasse, in der die Studie durchgeführt wurde, beschrieben.
Im Hauptteil der Arbeit werden fünf verschiedene Leseanimationsmethoden im Detail vorgestellt und evaluiert. Die Arbeit analysiert deren Umsetzung, Probleme und Wirkung auf die Lesemotivation der Schüler. Die Methoden umfassen Bibliotheksarbeit, Lesekisten, feste Lesezeiten, Leseverträge und Lesetheater. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Methoden einen positiven Effekt auf die Lesemotivation der Schüler haben.
Kapitel fünf fasst die Ergebnisse der Evaluationsstudie zusammen und diskutiert deren Relevanz für die schulische Praxis. Die Arbeit argumentiert für eine Trennung von Literatur- und Leseunterricht an Hauptschulen und betont die Bedeutung von Lesemotivation als Schlüsselfaktor für den Erfolg der Leseförderung.
Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Leseförderung an Hauptschulen und formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für die schulische Praxis.
Schlüsselwörter
Lesemotivation, Lesekompetenz, Lesesozialisation, Leseanimationsverfahren, Lesekompetenztraining, Hauptschule, Deutschunterricht, Schulbibliothek, Lesetheater, Hörbuch, Familie, Schule, Freunde, PISA, qualitative und quantitative Analyse, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Lesemotivation für die Lesekompetenz so wichtig?
Motivation ist die notwendige Bedingung dafür, dass Schüler überhaupt lesen und so ihre Kompetenzen durch ständige Übung („Lesen lernt man nur durch Lesen“) verbessern.
Welche Leseanimationsverfahren werden in der Arbeit evaluiert?
Evaluiert werden Bibliotheksarbeit, Bücherkisten, feste Lesezeiten, Leseverträge, Lesetheater und die Erstellung von Hörbüchern.
Wie beeinflusst das familiäre Umfeld die Lesesozialisation?
Die Familie ist der primäre Ort der Lesesozialisation; ein positives Vorbild der Eltern ist entscheidend für die spätere Lesehaltung der Kinder.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation?
Intrinsische Motivation entspringt dem eigenen Interesse am Text, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Noten oder Belohnungen entsteht.
Warum wird eine Trennung von Literatur- und Leseunterricht gefordert?
An Hauptschulen ist es oft effektiver, das reine Lesetraining von der komplexen Literaturanalyse zu trennen, um leseabstinenten Schülern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
- Quote paper
- Juliane Dube (Author), 2009, Voraussetzungen zum Erwerb und Erhalt von Lesemotivation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126714