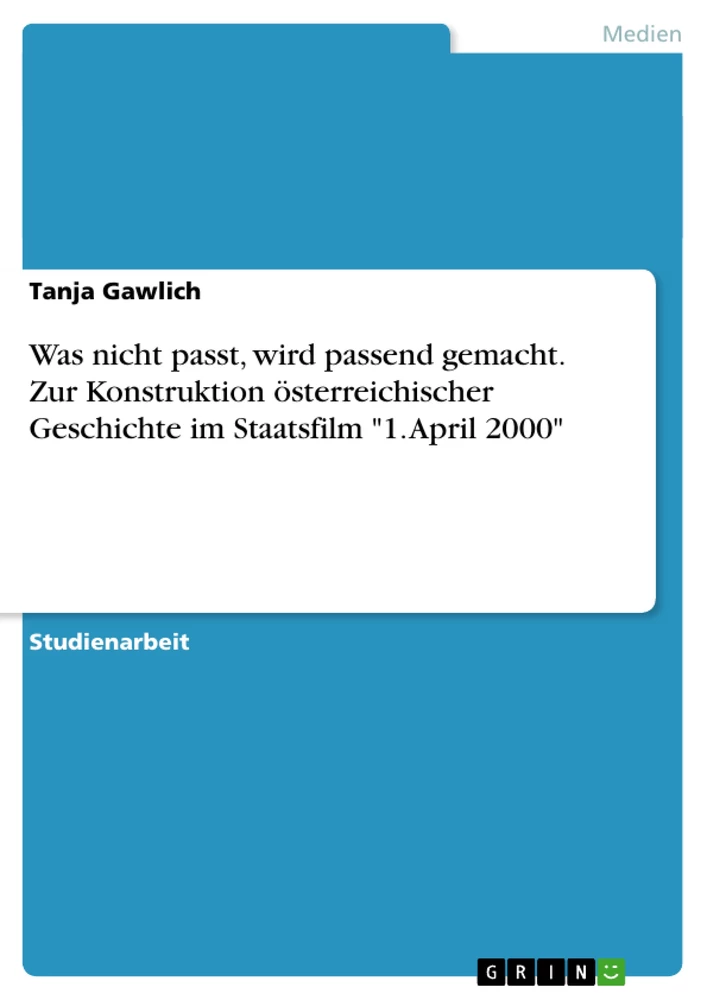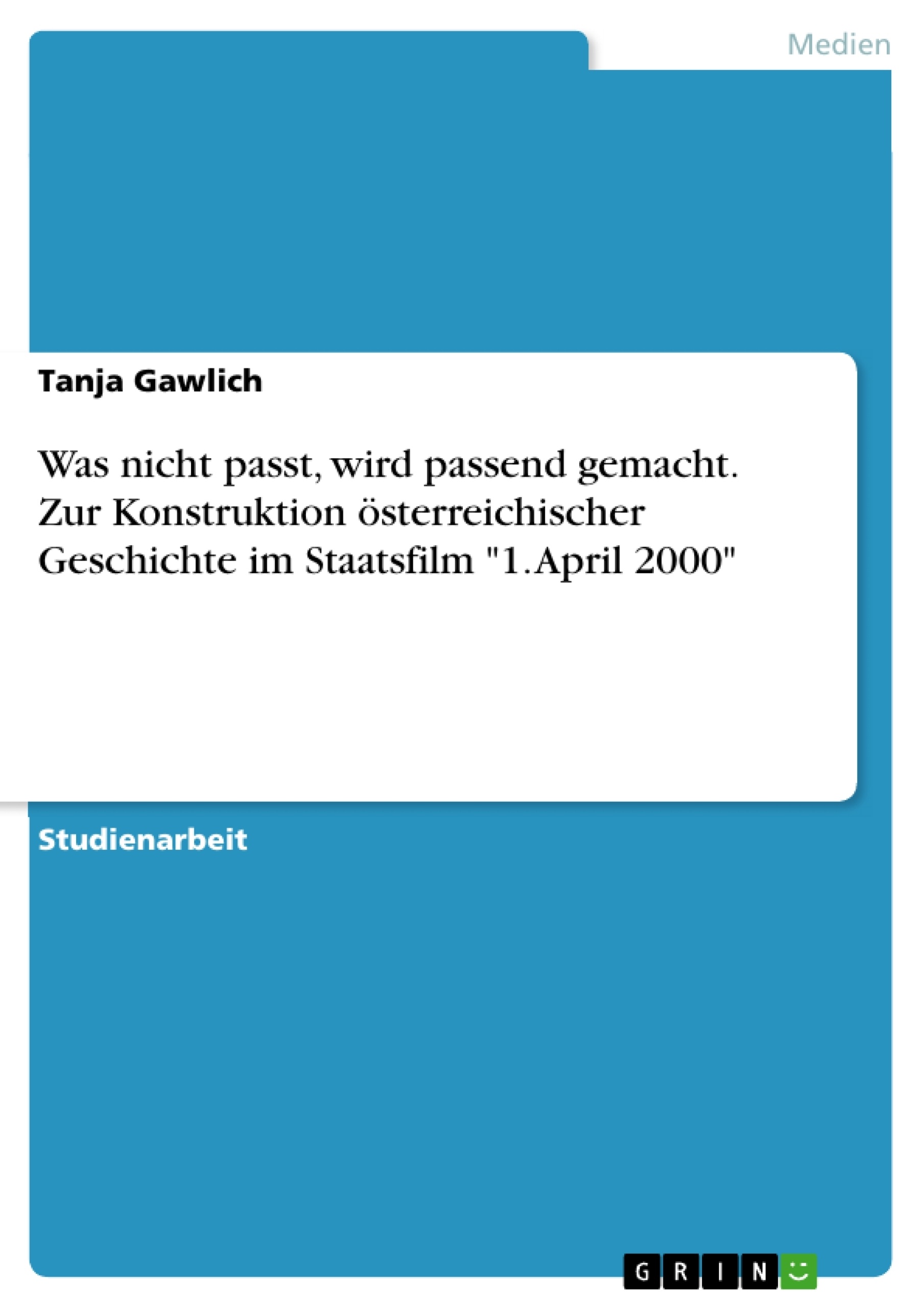Die 1950er-Jahre sind wie in Deutschland auch in Österreich filmisch geprägt von einer Hochkonjunktur der Musikkomödien und Heimatfilme. Operetten- und Fremdenverkehrsfilme, sowie filmische Biografien lockten ein Millionenpublikum in die Kinos. Die klischeehaften Heimatfilme, deren Inhalt das einfache Leben der Bergbewohner, kombiniert mit einer Liebesgeschichte, einem Missverständnis und einem Happy End, waren durch ihre Berg- und Tieraufnahmen zugleich sehr tourismuswirksam. Auf Handlungsvielfalt wurde dabei eher wenig wert gelegt, wie Billy Wilder bemerkte: „wenn die Deutschen [gemeint war der gesamte deutschsprachige Raum] einen Berg im Hintergrund und Paul Hörbiger im Vordergrund sehen, sind sie schon zufrieden.“ Ein Heimatfilm der besonderen Art ist jedoch der Film 1. April 2000 aus dem Jahr 1952. Er ist eine einzigartige und außergewöhnliche Produktion in der Filmgeschichte. Mit Geldern und auf Initiative der Bundesregierung entstanden, bezeichnete er sich als „politisch- utopische Komödie“. Bizarr ist der Staatsfilm 1. April 2000 auf jeden Fall und bietet sich durch Form und Inhalt als historische Quelle gerade zu an, denn er ist ein interessantes Zeitdokument über das Selbstbild und Geschichtsverständnis Österreichs Anfang der 1950er Jahre.Österreich inszeniert sich nämlich als harmlosestes Land der Welt, was (wie der Titel schon sagt) scherzhaft formuliert wurde, aber ernst gemeint war. Hierbei wird die österreichische Geschichte dort kurzerhand umgeschrieben, wo sie nicht in das zu vermittelnde Bild passt. Das im Film entwickelte, bzw. konstruierte Geschichtsbild Österreichs ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Als erstes wird der Hintergrund und die Entstehungsgeschichte des Films „1. April 2000“ dargestellt werden. Nach einer kurzen Information über den Inhalt und die Besetzung werden als Kernpunkt der Arbeit die „historisierenden“ Einschübe und Rückblicke untersucht. Dazu sollen sie nach einer kurzen Zusammenfassung berichtigt und sowohl auf ihre Funktion im Film als auch im Hinblick auf die Gesamtkonstruktion der Geschichte Österreichs hin untersucht werden. In der Schlussbetrachtung werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Entstehungsgeschichte
- Der Film: Inhalt und Besetzung
- Die „historisierenden“ Einschübe als Konstruktion der eigenen Geschichte
- Der 3. Kreuzzug 1189-1191
- Das Jahr 1515
- Kaiser Karl V.
- Die Pest und der „liebe Augustin“
- Die Türken vor Wien 1683
- Prinz Eugen, Kaiser Leopold I. und Maria Theresia
- Schlussbetrachtung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den österreichischen Staatsfilm „1. April 2000“ aus dem Jahr 1952. Der Film, der als „politisch-utopische Komödie“ bezeichnet wurde, entstand auf Initiative der Bundesregierung und diente als Propagandainstrument zur Förderung des österreichischen Selbstbildes und Geschichtsverständnisses in der Nachkriegszeit. Die Arbeit untersucht, wie der Film die österreichische Geschichte konstruiert und dabei die Vergangenheit in ein positives Licht rückt.
- Die Konstruktion der österreichischen Geschichte im Film „1. April 2000“
- Die Rolle des Films als Propagandainstrument der österreichischen Bundesregierung
- Die „historisierenden“ Einschübe als Mittel der Geschichtskonstruktion
- Die Darstellung Österreichs als „harmlosestes Land der Welt“
- Die politische und gesellschaftliche Situation Österreichs in den 1950er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des österreichischen Heimatfilms der 1950er Jahre ein und stellt den Film „1. April 2000“ als ein besonderes Beispiel vor. Der Film wird als Zeitdokument über das Selbstbild und Geschichtsverständnis Österreichs Anfang der 1950er Jahre betrachtet.
Das Kapitel „Hintergrund und Entstehungsgeschichte“ beleuchtet die politische Situation Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entstehung des Films „1. April 2000“. Die Besatzung Österreichs durch die Alliierten, die „Opferthese“ und die Reparationsforderungen der Sowjetunion werden als wichtige Faktoren für die Entstehung des Films dargestellt.
Das Kapitel „Der Film: Inhalt und Besetzung“ gibt einen Überblick über den Inhalt und die Besetzung des Films. Es wird die „politisch-utopische Komödie“ als Genre des Films beschrieben und die Bedeutung des Films für die österreichische Filmgeschichte hervorgehoben.
Das Kapitel „Die „historisierenden“ Einschübe als Konstruktion der eigenen Geschichte“ analysiert die „historisierenden“ Einschübe im Film und untersucht, wie sie die österreichische Geschichte konstruieren. Die einzelnen Einschübe werden dabei im Detail betrachtet und auf ihre Funktion im Film sowie im Hinblick auf die Gesamtkonstruktion der Geschichte Österreichs hin untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den österreichischen Heimatfilm, die Konstruktion der Geschichte, das Selbstbild Österreichs, die politische Situation Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, die „Opferthese“, die „historisierenden“ Einschübe, die Propagandafunktion des Films und die „politisch-utopische Komödie“ als Genre.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Film „1. April 2000“?
Es handelt sich um einen staatlich finanzierten österreichischen Science-Fiction-Film von 1952, der als politisch-utopische Komödie das Selbstbild Österreichs in der Nachkriegszeit propagierte.
Warum wird der Film als „Staatsfilm“ bezeichnet?
Der Film entstand auf Initiative der österreichischen Bundesregierung, um die Forderung nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der Alliierten filmisch zu unterstützen.
Was ist die „Opferthese“ im Film?
Österreich inszeniert sich im Film als harmloses Land und Opfer der Weltpolitik, wobei dunkle Kapitel der Geschichte zugunsten eines positiven Selbstbildes umgeschrieben oder ignoriert werden.
Welche historischen Ereignisse werden im Film aufgegriffen?
Der Film nutzt Rückblenden auf den 3. Kreuzzug, die Türkenbelagerung und die Zeit von Maria Theresia, um eine kontinuierliche Tradition österreichischer Friedfertigkeit und Kultur zu konstruieren.
Welchen Zweck dienten die „historisierenden Einschübe“?
Sie sollten die historische Bedeutung Österreichs untermauern und legitimieren, warum das Land im Jahr 2000 (der fiktiven Gegenwart des Films) endlich frei und souverän sein sollte.
- Arbeit zitieren
- M.A. Tanja Gawlich (Autor:in), 2007, Was nicht passt, wird passend gemacht. Zur Konstruktion österreichischer Geschichte im Staatsfilm "1. April 2000", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126748