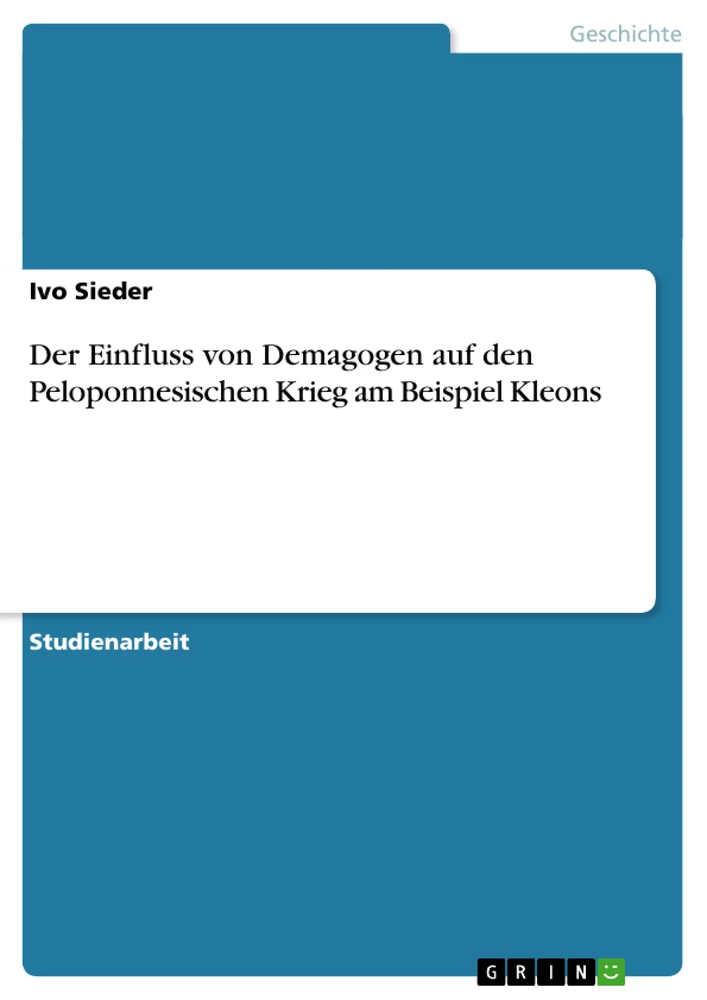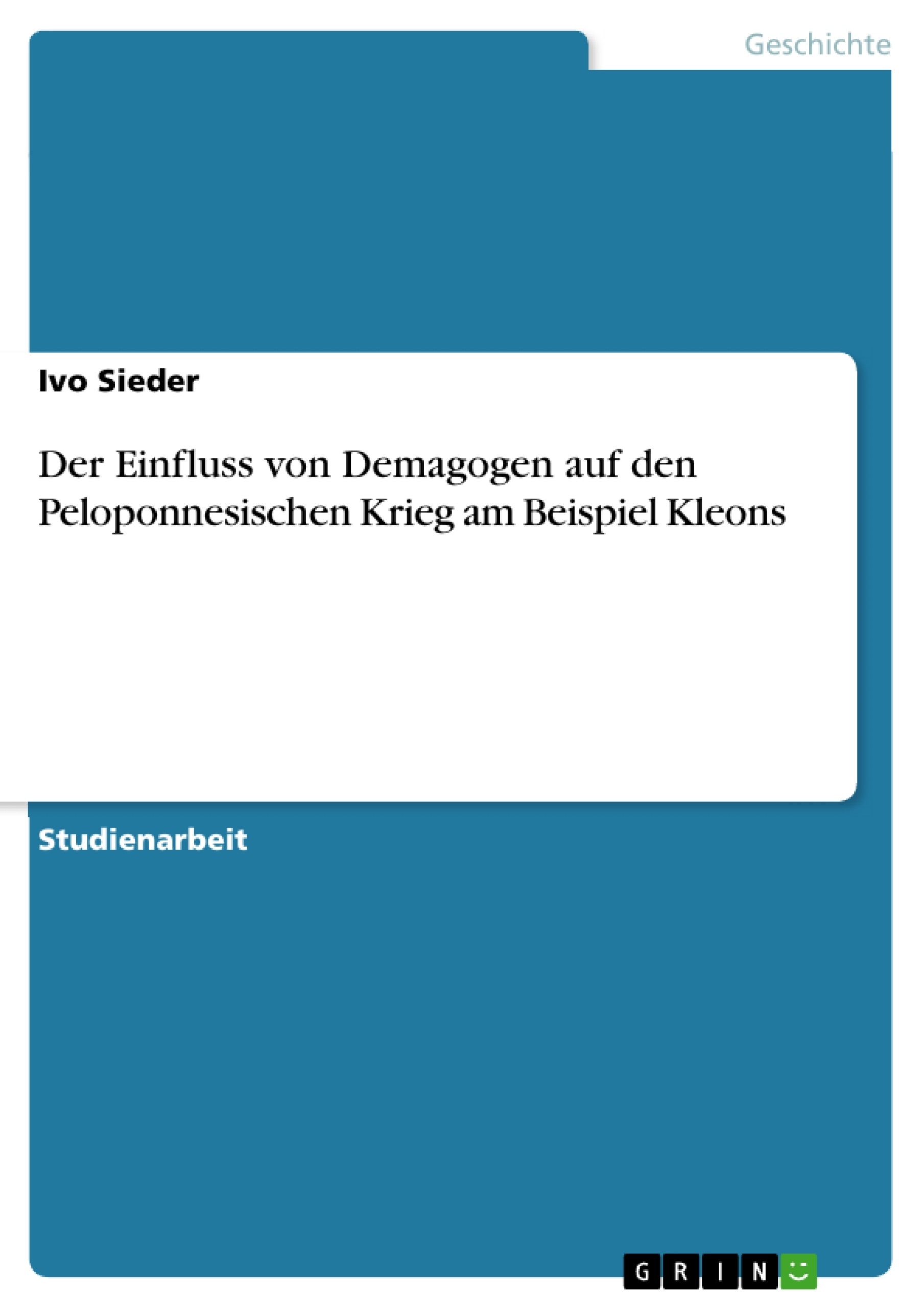Der im Seminar besprochene Peloponnesische Krieg stellt sicherlich das wichtigste Ereignis
für Athen im späten 5.Jh. v.Chr. dar. Während die Zeit davor oftmals als eine Blüte der
Demokratie und generell ein goldenes Zeitalter beschrieben wird, werden besonders der
Peloponnesische Krieg, seine Brutalität und sein zerstörerischer Verlauf oftmals dem Einfluss
von so genannten Demagogen wie Kleon und Alkibiades zugeschrieben. Im Rahmen dieser
Hausarbeit werde ich am Beispiel Kleons, des Archetypen eines Demagogen, untersuchen
welchen Einfluss die Demagogen auf die athenische Politik im Peloponnesischen Krieg
wirklich hatten. Ich hoffe zu klären, ob die Demagogen die Demokratie missbrauchten und
Athen alleine in seinen Untergang stießen oder ob die Demagogen (wie sie behaupteten) nur
den Willen des Volkes umsetzten.
Zu Beginn werde ich den Peloponnesischen Krieg als selbst und den gern (miss-)gebrauchten
Begriff „Demagoge“ als notwendigen historischen Kontext erläutern. Anschließend werde ich
anhand der Überlieferung erläutern, an welchen Punkten Kleon wie Einfluss auf athenischen
Politik und Kriegsführung nahm. Die wichtigste Quelle zu Kleons Wirken ist natürlich
Thukydides „Peloponnesischer Krieg“. Thukydides selbst lehnte sowohl Kleons Methoden
wie Ziele ab, so dass Kleon generell äußerst negativ dargestellt wird. Eine weitere wichtige
zeitgenössische Quelle stellen die Komödien des Aristophanes dar, besonders die „Ritter“ in
denen Kleon die Hauptrolle zukommt. Aristophanes beschuldigte in vielen seiner Werke
Kleon und die Demagogen allgemein der Kriegstreiberei und vieler negativer Charakterzüge,
so dass auch hier ein äußerst negatives Kleonbild entsteht. Eine dritte literarische Quelle
stellen schließlich die Plutarch-Biografien des Nikias und Perikles dar. Plutarch allerdings
schrieb bereits im 1.Jh. n.Chr., durch seinen besonderen Stil des Fokus auf das Persönliche
und der Opposition, in der Kleon zu Nikias wie Perikles stand, sind Plutarchs Einschätzungen
von Kleon ebenso oft negativ geprägt. Generell lässt sich also feststellen, dass die
literarischen Quellen Kleon nicht wohlgesonnen sind, so dass mögliche positive Einflüsse des
Kleon nicht dargestellt und seine negativen Einflüsse überzeichnet werden. Aus diesem
Grund werde ich zum Abschluss versuchen, eine eigene Bewertung der Tätigkeit des Kleon
und seines Einflusses vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Der Peloponnesische Krieg
- Der Demagoge
- Kleon und der Peloponnesische Krieg
- vom Kriegsausbruch bis zum Vorgehen gegen Mytilene
- Kleon auf dem Höhepunkt: die Schlacht von Sphakteria
- von Sphakteria nach Amphipolis
- Schluss
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Demagogen auf die athenische Politik im Peloponnesischen Krieg am Beispiel Kleons. Sie analysiert, ob Demagogen die Demokratie missbrauchten und Athen in den Untergang trieben oder ob sie den Willen des Volkes umsetzten.
- Der Peloponnesische Krieg als historischer Kontext
- Der Begriff „Demagoge“ und seine Bedeutung im 5. Jahrhundert v. Chr.
- Kleons Einfluss auf die athenische Politik und Kriegsführung
- Die Rolle der Demagogen im Kontext der athenischen Demokratie
- Bewertung von Kleons Wirken und seinem Einfluss auf den Peloponnesischen Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Demagogen auf den Peloponnesischen Krieg am Beispiel Kleons. Sie erläutert die Bedeutung des Peloponnesischen Krieges für Athen und die Rolle von Demagogen in der athenischen Politik.
Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet den historischen Kontext des Peloponnesischen Krieges und des Begriffs „Demagoge“. Er beschreibt die Ursachen und Phasen des Krieges sowie die Bedeutung des Begriffs „Demagoge“ in der athenischen Politik.
Der dritte Teil der Arbeit analysiert Kleons Einfluss auf die athenische Politik und Kriegsführung. Er untersucht Kleons Rolle im Krieg, seine Strategien und seine Beziehung zu anderen wichtigen Persönlichkeiten wie Perikles und Nikias.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Peloponnesischen Krieg, die athenische Demokratie, Demagogie, Kleon, Perikles, Nikias, Thukydides, Aristophanes, Plutarch, politische Rhetorik, Kriegsführung, Machtpolitik, Volkswillen, Einfluss, historische Quellen, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Kleon und welche Rolle spielte er in Athen?
Kleon war ein einflussreicher athenischer Politiker während des Peloponnesischen Krieges und gilt als Archetyp des Demagogen.
Was versteht man unter dem Begriff "Demagoge"?
Historisch bezeichnet es einen "Volksführer", der durch Rhetorik die Massen beeinflusst; oft wird der Begriff negativ für Politiker verwendet, die die Demokratie für eigene Zwecke missbrauchen.
Wie bewerten historische Quellen wie Thukydides Kleon?
Thukydides und Aristophanes zeichnen ein sehr negatives Bild von Kleon, wobei sie ihm Kriegstreiberei und populistische Methoden vorwerfen.
Welchen Einfluss hatte Kleon auf den Peloponnesischen Krieg?
Kleon trieb eine aggressive Kriegspolitik voran, feierte militärische Erfolge wie bei Sphakteria, wurde aber auch für die Radikalisierung der athenischen Politik verantwortlich gemacht.
Was war die Schlacht von Sphakteria?
Es war Kleons militärischer Höhepunkt, bei dem es gelang, spartanische Elite-Krieger gefangen zu nehmen, was seine Macht in Athen massiv stärkte.
- Citation du texte
- Ivo Sieder (Auteur), 2007, Der Einfluss von Demagogen auf den Peloponnesischen Krieg am Beispiel Kleons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126771