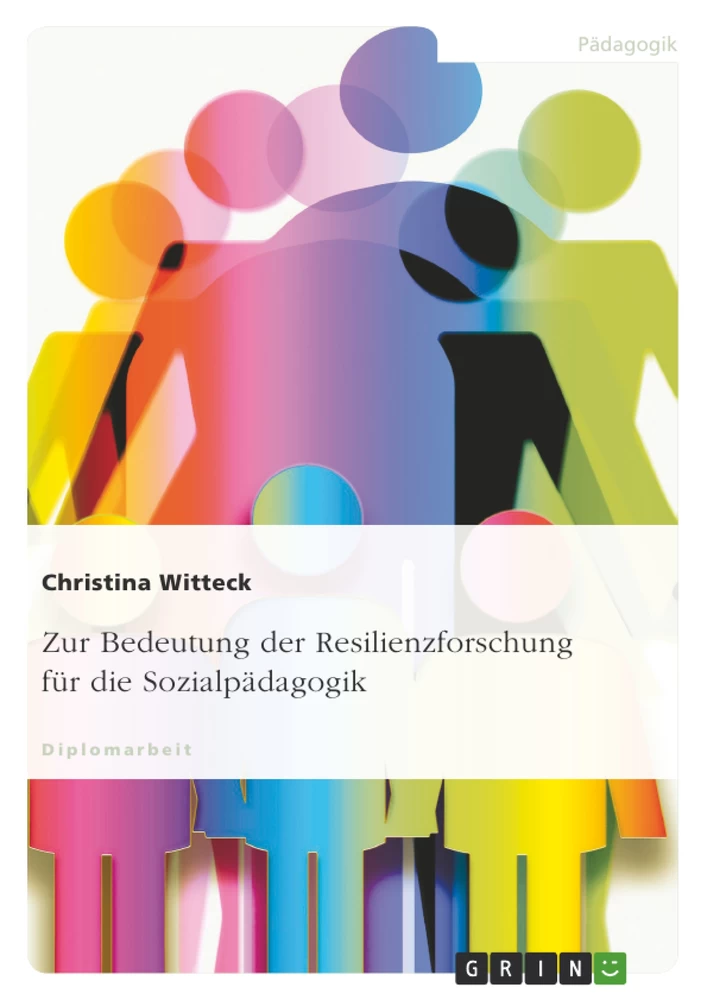Gemeinhin wird von einer Zunahme von Belastungen gesprochen, denen Menschen heute ausgesetzt sind und die einer positiven Entwicklung im Wege stehen können. Es handelt sich um Risiken, die sie „auf intraindividueller Ebene, innerhalb der Familie, in der Peergroup, in der schulischen und beruflichen Ausbildung oder im gesamtgesellschaftlichen Kontext erfahren“ (Wustmann 2004, S. 09). Die Sozialpädagogik setzt vor allem dort an, wo diese Risiken eine negative Wirkung nach sich ziehen und Entwicklungsdefizite entstehen. Sie versucht durch ihr Eingreifen den daraus folgenden Problemen entgegenzuwirken.
Obwohl augenscheinlich vermehrt Risiken und unerwünschte Entwicklungsdefizite vorhanden sind, wurde im Bereich der Entwicklungspsychopathologie, die Aufmerksamkeit auf ein anderes Phänomen gelenkt: Längst nicht alle Menschen, die einer erheblichen Anzahl von Risikobelastungen ausgesetzt sind, entwickeln Probleme und Störungen. Es ist ihnen möglich, sich trotz dieser Widrigkeiten durchaus ‚normal’ und sogar sehr positiv zu entwickeln.
Dieses Phänomen wurde anfangs noch als „Invulnerabilität“ − Unverletzlichkeit − bezeichnet. Doch im Zuge weiterer Forschung, in der das Phänomen empirisch bestätigt wurde, fand eine Ausdifferenzierung dieses neuen Konzepts statt, welches sich in den 1980er Jahren vollends unter dem Begriff der „Resilienz“ in der Forschung etablierte. Die ursprünglich aus der Psychologie stammende Resilienzforschung fand bald Anklang in pädagogischen Kontexten und wird heute bereits in sozialpädagogischen Arbeitskonzepten verwendet. Für viele in diesem Bereich Tätigen geht von dem Begriff der Resilienz eine große Faszination aus, denn erstmals werden nicht nur die Risiken und die daraus resultierenden Defizite einer Person wahrgenommen. Mit ihm wendet sich der Fokus den Faktoren zu, die es einer Person ermöglichen, sich trotz aller Widrigkeiten positiv zu entwickeln und es stellt sich die Frage, wie es einigen Menschen möglich ist, dieses „Gleichgewicht“ zu finden um ihr Leben erfolgreich zu führen. Diese neue Blickrichtung in der Sozialpädagogik beschreiben Opp und Fingerle wie folgt:
„In der Zukunft wird es vor allem darum gehen, die Risiken kindlicher Entwicklung, die in modernen Gesellschaften für viele Kinder zunehmen, als Entwicklungsgefährdungen und nicht primär im Sinne von Defiziten zu erfassen. Im Zentrum des pädagogischen Interesses stehen mittlerweile die Potentiale und Ressourcen, die kindliche Entwicklung schützen und stärken.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Resilienz
- II.1 Definition
- II.2 Geschichtliche Herkunft/Wurzeln
- II.3 Konzeptuelle Grundlagen
- II.3.1 Risikoforschung
- II.3.1.1 Risikofaktoren
- II.3.1.2 Wirkungsweise von Risikofaktoren
- II.3.2 Vulnerabilität
- II.3.3 Forschung zu Schutzfaktoren
- II.3.3.1 Definition
- II.3.3.2 Wirkungsweise von Schutzfaktoren
- II.3.3.3 Ausblick
- II.3.4 Modelle der Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
- II.3.5 Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus
- II.3.5.1 Primäre und sekundäre Bewertung
- II.3.5.2 Bewältigungsformen
- II.3.6 Das Konzept der Salutogenese
- II.3.6.1 Definition
- II.3.6.2 Generalisierte Widerstandsressourcen
- II.3.6.3 Kohärenzgefühl
- II.3.1 Risikoforschung
- II.4 Resilienzmodell nach Kumpfer
- II.5 Messung von Resilienz
- II.6 Studien zu Resilienz
- II.6.1 Die Kauai-Studie
- II.6.2 Das Bielefeld-Erlangen-Resilienz-Projekt
- II.6.3 Die Mannheimer-Risikokinderstudie
- II.7 Merkmale von Resilienz
- II.7.1 Personale Merkmale
- II.7.2 Soziale Merkmale
- II.7.2.1 Familiäre Merkmale
- II.7.2.2 Außerfamiliäre Merkmale
- II.7.3 Biologische Aspekte von Resilienz
- II.8 Resilienzförderung
- III. Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik
- III.1 Begriffsbestimmungen Sozialarbeit - Sozialpädagogik
- III.2 Definition Ressourcen
- III.3 Ressourcenorientierung historisch
- III.3.1 Ressourcenorientierung in der Erwachsenenfürsorge
- III.3.2 Ressourcenorientierung in der Jugendfürsorge
- III.4 Ressourcenorientierung heute
- III.4.1 Die klassischen Methoden
- III.4.1.1 Soziale Einzel(fall)hilfe
- III.4.1.2 Soziale Gruppenarbeit
- III.4.1.3 Gemeinwesenarbeit
- III.4.1.4 Kritik
- III.4.2 Methoden heute
- III.4.2.1 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- III.4.2.1.1 Sozialpädagogisches Handeln
- III.4.2.1.2 Dimensionen
- III.4.2.2 Prävention
- III.4.2.2.1 Kritik
- III.4.2.2.2 Bedeutung für die sozialpädagogische Praxis
- III.4.2.3 Empowerment
- III.4.2.3.1 Empowerment und sozialpädagogisches Handeln
- III.4.2.3.2 Ebenen
- III.4.2.4 Fazit
- III.4.2.1 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- III.4.1 Die klassischen Methoden
- III.5 Defizitblickwinkel in der Sozialpädagogik
- III.6 Bedeutung der Ressourcenorientierung für sozialpädagogisches Handeln
- III.7 Kritik
- IV. Implikationen für die sozialpädagogische Praxis
- IV.1 Sozialpädagogisches Arbeiten und Resilienzförderung
- IV.1.1 Zeitpunkt der Förderung
- IV.1.2 Adressaten der Förderung
- IV.2 Resilienzförderung auf der individuellen Ebene
- IV.3 Resilienzförderung auf der Eltern-Ebene
- IV.3.1 Eltern- und Erziehungskompetenzen
- IV.3.2 Sozialpädagogisches Handeln auf der Eltern-Ebene
- IV.4 Netzwerk-Ebene
- IV.1 Sozialpädagogisches Arbeiten und Resilienzförderung
- V. Die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik
- V.1 Das Neue an der Resilienzforschung
- V.1.1 Erfolgreiche Bewältigung und der Fokus auf die Stärken
- V.1.2 Eigenaktivität
- V.1.3 Vorhersagbarkeit
- V.2 Resilienzforschung und Sozialpädagogik
- V.2.1 Von der defizitorientierten zur resilienzorientierten Haltung
- V.2.1.1 Defizitorientierung
- V.2.1.2 Resilienzorientierung
- V.2.2 Resilienzorientierung als Ressourcenorientierung
- V.2.1 Von der defizitorientierten zur resilienzorientierten Haltung
- V.3 Erweiterung der Ressourcenorientierung durch die Resilienzorientierung
- V.4 Resilienzorientierung in der sozialpädagogischen Praxis
- V.4.1 Resilienzförderung und Prävention
- V.4.2 Gemeinsame Ziele
- V.4.3 Einfluss der Resilienzförderung auf die Präventionsarbeit
- V.5 Grenzen resilienzorientierten Arbeitens
- V.1 Das Neue an der Resilienzforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik. Ziel ist es, die Konzepte der Resilienz und Ressourcenorientierung zu erläutern und deren Implikationen für die sozialpädagogische Praxis aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren sowie die Möglichkeiten der Resilienzförderung auf individueller, elterlicher und netzwerkebene.
- Konzept der Resilienz und dessen historische Entwicklung
- Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik
- Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren
- Methoden der Resilienzförderung
- Implikationen für die sozialpädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik heraus. Sie veranschaulicht die Notwendigkeit, neben den Risikofaktoren auch die positiven Entwicklungspotenziale von Kindern und Jugendlichen im Fokus zu behalten und diese gezielt zu fördern. Der Bezug auf Janosch unterstreicht die Notwendigkeit, das Leben trotz Widrigkeiten genießen zu können und die Kompetenz zur gesellschaftlichen Teilhabe zu entwickeln.
II. Resilienz: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Resilienzkonzepts. Es definiert Resilienz, beleuchtet ihre geschichtliche Entwicklung und erläutert die konzeptuellen Grundlagen, darunter Risikoforschung, Vulnerabilität und Schutzfaktoren. Es werden verschiedene Modelle der Wechselwirkung zwischen Risiko- und Schutzfaktoren vorgestellt, darunter das transaktionale Stressmodell nach Lazarus und das Konzept der Salutogenese. Weiterhin behandelt es die Messung von Resilienz und präsentiert Ergebnisse relevanter Studien wie der Kauai-Studie und des Bielefeld-Erlangen-Resilienz-Projekts. Schließlich werden Merkmale von Resilienz auf personaler, sozialer und biologischer Ebene diskutiert und Möglichkeiten der Resilienzförderung erörtert.
III. Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik. Es definiert den Begriff "Ressourcen" und verfolgt dessen historische Entwicklung in der Erwachsenen- und Jugendfürsorge. Es analysiert klassische und moderne Methoden der Sozialen Arbeit wie die lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Prävention und Empowerment. Die Kritik an defizitorientierten Ansätzen wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung der Ressourcenorientierung für sozialpädagogisches Handeln.
IV. Implikationen für die sozialpädagogische Praxis: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktischen Implikationen der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik. Es zeigt auf, wie sozialpädagogisches Arbeiten und Resilienzförderung miteinander verknüpft werden können. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ebenen der Förderung: individuell, elterlich und auf Netzwerkebene. Es wird im Detail erläutert, wie Sozialpädagogen auf diesen Ebenen effektiv agieren können, z.B. durch die Stärkung von Elternkompetenzen und die Entwicklung von unterstützenden Netzwerken.
Schlüsselwörter
Resilienz, Ressourcenorientierung, Sozialpädagogik, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Prävention, Empowerment, Lebensweltorientierung, Entwicklungspsychopathologie, Soziales Handeln, Familienarbeit, Netzwerk.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Resilienzforschung und Sozialpädagogik
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik. Sie erläutert die Konzepte der Resilienz und Ressourcenorientierung und zeigt deren Implikationen für die sozialpädagogische Praxis auf. Schwerpunkte sind die Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren sowie die Möglichkeiten der Resilienzförderung auf individueller, elterlicher und Netzwerkebene.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Konzept der Resilienz und dessen historische Entwicklung, Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik, die Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren, Methoden der Resilienzförderung und deren Implikationen für die sozialpädagogische Praxis. Es werden verschiedene Resilienzmodelle (z.B. das transaktionale Stressmodell nach Lazarus, Salutogenese), relevante Studien (Kauai-Studie, Bielefeld-Erlangen-Resilienz-Projekt) und verschiedene sozialpädagogische Methoden (lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Prävention, Empowerment) diskutiert.
Was ist Resilienz und wie wird sie in der Arbeit definiert?
Resilienz wird in der Arbeit umfassend definiert und ihre geschichtliche Entwicklung beleuchtet. Es werden konzeptuelle Grundlagen wie Risikoforschung, Vulnerabilität und Schutzfaktoren erläutert. Die Arbeit beschreibt verschiedene Modelle der Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren und diskutiert Methoden zur Messung von Resilienz.
Welche Rolle spielt die Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik?
Die Arbeit beleuchtet die Ressourcenorientierung in der Sozialpädagogik, definiert den Begriff "Ressourcen" und verfolgt dessen historische Entwicklung. Sie analysiert klassische und moderne Methoden der Sozialen Arbeit und diskutiert die Bedeutung der Ressourcenorientierung für sozialpädagogisches Handeln im Vergleich zu defizitorientierten Ansätzen.
Wie können die Erkenntnisse der Resilienzforschung in der sozialpädagogischen Praxis angewendet werden?
Die Arbeit zeigt die praktischen Implikationen der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik auf und beschreibt, wie sozialpädagogisches Arbeiten und Resilienzförderung verknüpft werden können. Der Fokus liegt auf der Förderung auf individueller, elterlicher und Netzwerkebene, inklusive der Stärkung von Elternkompetenzen und dem Aufbau unterstützender Netzwerke.
Welche Ebenen der Resilienzförderung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Resilienzförderung auf drei Ebenen: der individuellen Ebene, der Ebene der Eltern und der Netzwerkebene. Für jede Ebene werden konkrete Möglichkeiten der Förderung und des sozialpädagogischen Handelns beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Resilienz, Ressourcenorientierung, Sozialpädagogik, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Prävention, Empowerment, Lebensweltorientierung, Entwicklungspsychopathologie, Soziales Handeln, Familienarbeit und Netzwerk.
Welche Studien werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt und diskutiert Ergebnisse relevanter Studien wie die Kauai-Studie und das Bielefeld-Erlangen-Resilienz-Projekt, sowie die Mannheimer-Risikokinderstudie.
Wie unterscheidet sich die resilienzorientierte von der defizitorientierten Haltung in der Sozialpädagogik?
Die Arbeit vergleicht die defizitorientierte und die resilienzorientierte Haltung in der Sozialpädagogik. Die resilienzorientierte Haltung konzentriert sich auf die Stärken und Ressourcen der Individuen, während die defizitorientierte Haltung sich primär auf die Schwächen und Defizite fokussiert.
Gibt es Grenzen resilienzorientierten Arbeitens?
Die Arbeit thematisiert auch die Grenzen resilienzorientierten Arbeitens, um ein vollständiges Bild der Thematik zu vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Christina Witteck (Autor:in), 2008, Zur Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126780