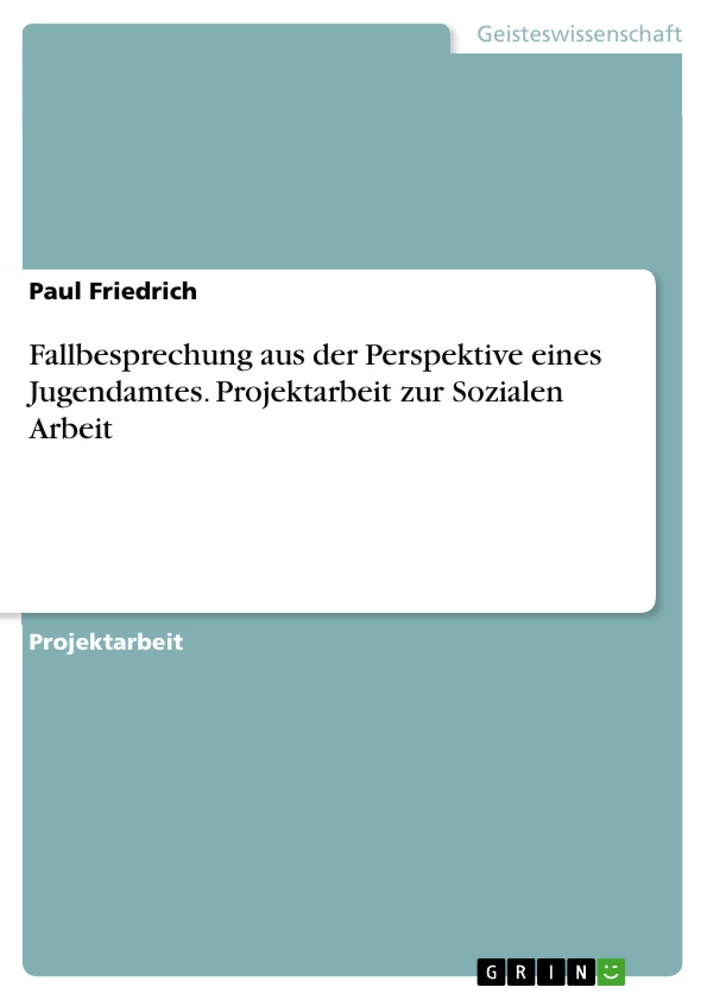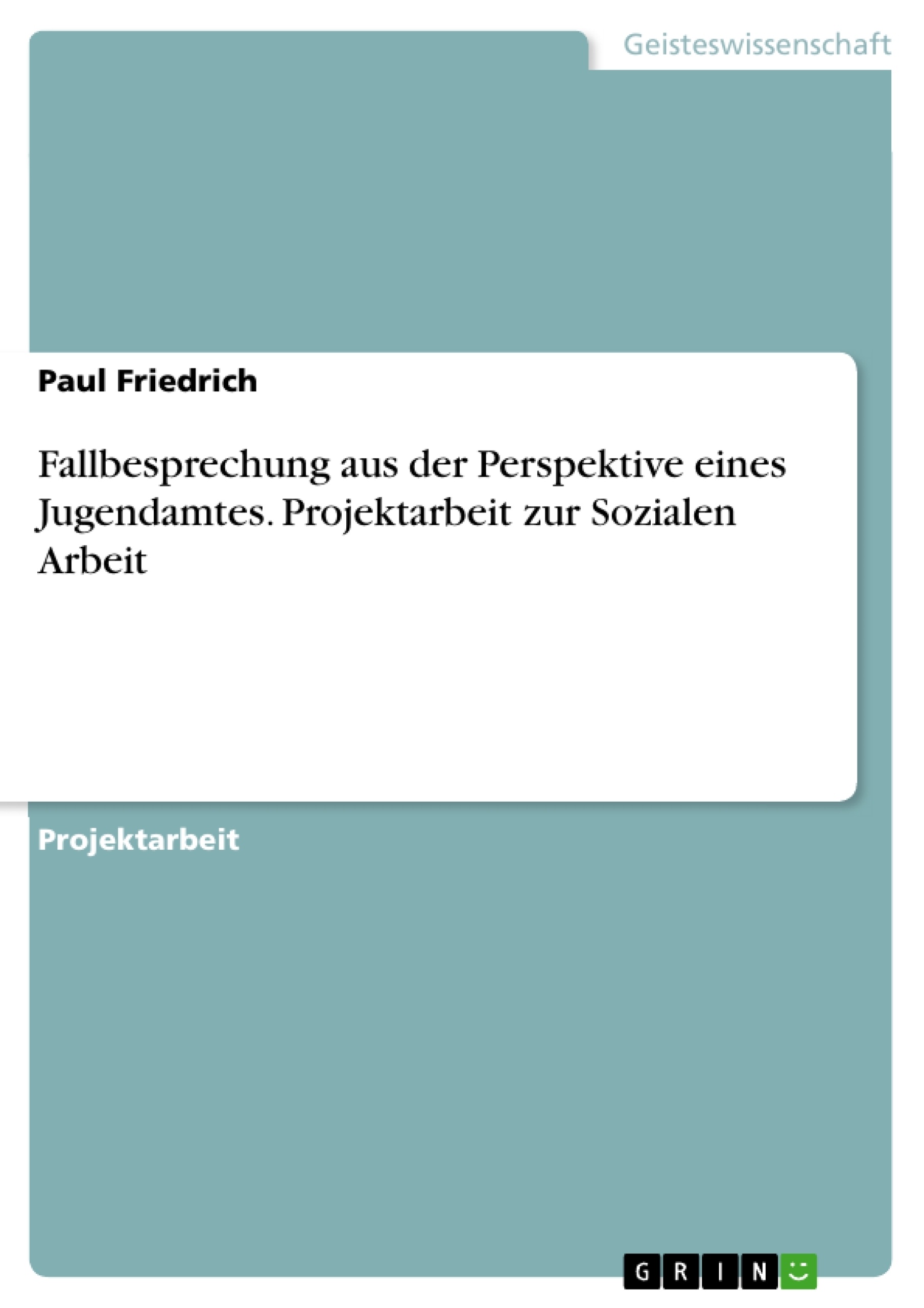Die Projektarbeit beschäftigt sich mit dem Fall Maurice P. aus der Perspektive eines Jugendamtes. Das Grundkonstrukt dieser Arbeit folgt den Wissensformen der normativen Handlungswissenschaft nach Staub-Bernasconi. Diese besteht aus acht Phasen, die zu sieben zusammengefasst wurden. Hier ein kurzer Überblick: Was? Warum? Woraufhin? Wer? Womit? Wie? Wirksamkeit?
Zur professionell-theoretischen Fundierung greift die Arbeit auf verschiedene Instrumente wie das Genogramm oder die Ressourcenkarte zurück und folgt im gesamten Ablauf der Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Was?
- Warum?
- Woraufhin?
- Wer?
- Womit?
- Wie?
- Wirksamkeit?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit dem Fall von Maurice P., einem elfjährigen Jungen mit Diabetes mellitus Typ I, und analysiert die Situation aus der Perspektive eines Facharbeiters im Jugendamt. Die Arbeit folgt den Wissensformen der normativen Handlungswissenschaft nach Staub-Bernasconi und nutzt verschiedene Instrumente wie das Genogramm und die Ressourcenkarte. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch im konkreten Fall von Maurice P.
- Analyse der familiären Situation und des Lebensumfelds von Maurice P.
- Anwendung der Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch im Fall von Maurice P.
- Bewertung der Wirksamkeit von Interventionen und Hilfestellungen.
- Identifizierung von Ressourcen und Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung und den familiären Begebenheiten.
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Arbeit im Jugendamt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Zur Einführung: Das erste Kapitel bietet eine kurze Einleitung in die Thematik und stellt den Fall Maurice P. sowie den methodischen Rahmen der Arbeit vor. Es werden die acht Phasen der normativen Handlungswissenschaft nach Staub-Bernasconi vorgestellt und auf die Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch eingegangen.
- Was?: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Situation von Maurice P., einschließlich seiner Krankheitsdiagnose, familiären Konstellation und der Auswirkungen auf seinen Alltag. Es werden auch die Herausforderungen und besonderen Bedürfnisse des Jungen aufgrund seines Diabetes mellitus Typ I und der komplexen Familiensituation beleuchtet.
- Warum?: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für die Situation von Maurice P. und geht auf die Hintergründe seines Diabetes, die familiären Konflikte und die Auswirkungen auf sein Leben ein.
- Woraufhin?: Hier werden die Ziele und die gewünschten Ergebnisse für Maurice P. und seine Familie definiert. Es wird die Frage nach den Zielen und den gewünschten Veränderungen in der Situation des Jungen und seiner Familie behandelt.
- Wer?: Dieses Kapitel identifiziert die Akteure und Personen, die in der Situation von Maurice P. involviert sind und beschreibt ihre Rollen und Verantwortlichkeiten. Dazu gehören beispielsweise die Eltern, die Schule, das Jugendamt und andere relevante Institutionen.
- Womit?: In diesem Kapitel werden die Ressourcen und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, die im Fall von Maurice P. zur Verfügung stehen. Es geht um die konkreten Handlungsoptionen und Instrumente, die im Rahmen der Arbeit mit dem Jungen und seiner Familie eingesetzt werden können.
- Wie?: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Handlungsschritte und -methoden, die im Fall von Maurice P. angewandt werden sollen. Es werden die Strategien und Interventionen vorgestellt, die zur Verbesserung der Situation von Maurice P. und seiner Familie beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Fall von Maurice P. und analysiert die Situation aus der Perspektive eines Facharbeiters im Jugendamt. Die Arbeit nutzt die Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch und setzt sich mit den Themen Diabetes mellitus Typ I, Familienkonflikte, Ressourcen und Interventionen im Kontext von Jugendhilfe auseinander.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Fall Maurice P.?
Es handelt sich um eine Fallbesprechung eines elfjährigen Jungen mit Diabetes mellitus Typ I aus der Perspektive des Jugendamtes.
Welche Theorie liegt der Sozialen Arbeit in diesem Fall zugrunde?
Die Arbeit folgt der Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch und den Wissensformen nach Staub-Bernasconi.
Welche Instrumente werden zur Fallanalyse genutzt?
Es werden professionelle Werkzeuge wie das Genogramm (familiäre Beziehungen) und die Ressourcenkarte eingesetzt.
Welche Rolle spielt das Jugendamt bei chronisch kranken Kindern?
Das Jugendamt prüft, inwieweit die Familie mit der medizinischen Versorgung überfordert ist und welche Hilfen zur Erziehung oder Unterstützung nötig sind.
Wie wird die Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet?
Die Arbeit evaluiert anhand der acht Phasen der normativen Handlungswissenschaft, ob die gewählten Interventionen die Lebensbewältigung des Jungen verbessern.
- Quote paper
- Paul Friedrich (Author), 2019, Fallbesprechung aus der Perspektive eines Jugendamtes. Projektarbeit zur Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268110