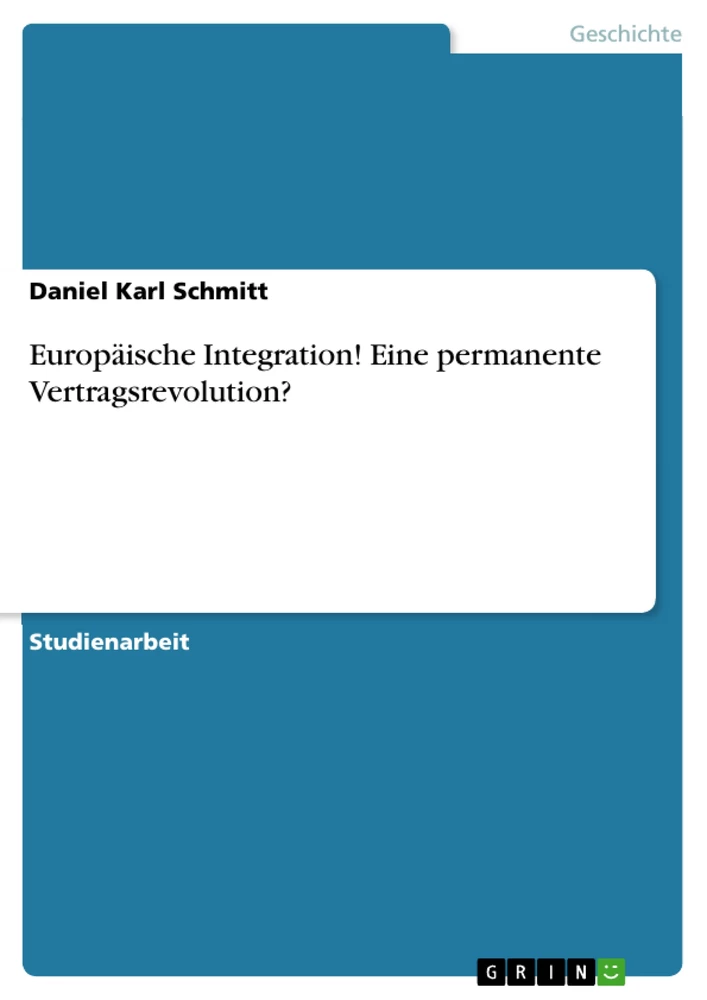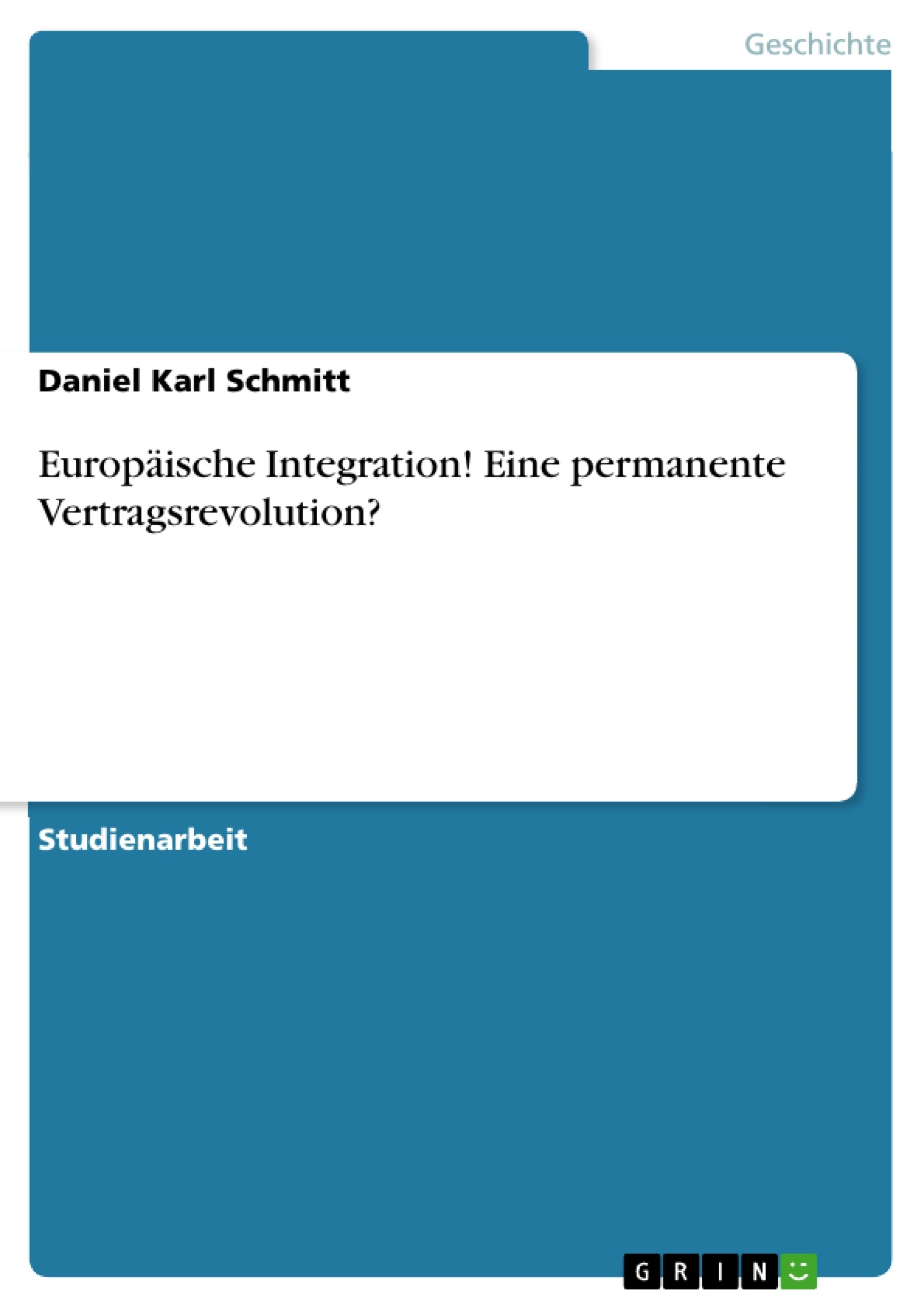Diese Arbeit soll sich mit diesem Phänomen, dem stetigen Drang nach Veränderung, Reformierung bzw. Neuschaffung befassen. Ein solcher Wandel in der europäischen politischen Gesellschafft weist Parallelen zu großen vergangenen Gesellschaftsumbrüchen im 18. und 19. Jahrhundert, wie der Amerikanischen Revolution, der Februarrevolution in Frankreich oder der Märzrevolution in Berlin, um nur einige wenige zu nennen, auf. Es stellt sich also die Frage, ob es sich bei dem Prozess der europäischen Integration um einen revolutionären Prozess handelt.
Bei der Definition von Revolution bedient sich diese Arbeit bei Reinhart Koselleck und dessen Analyse: "Revolution als Begriff und als Metapher" .
In seiner Dankesrede 2018 erinnerte der Karlspreisträger Emmanuel Macron an die Tatsache, dass das Projekt Europa auch in Zukunft nie abgeschlossen sein wird. Vielmehr wird diese Körperschaft, bedingt durch inneren und äußeren Druck, Spannungen und vielen weiteren gesellschaftlichen Aspekten, einem unendlichen Wandel unterlegen sein. Sodass es die Aufgabe einer jeden Generation aufs Neue sein wird, den 'Körper-Europa' an diese Veränderungen anzupassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Revolution - Eine Begriffsdefinition
- 2.1. Die Revolution der Gesellschaft
- 2.2. Die Revolution des Naturrechts
- 3. Europäische Integrationsgeschichte 1: 1946 - 1957
- 3.1. Churchills Europa-Rede (19.09.1946)
- 3.2. Die Gründung der EGKS (18.04.1951)
- 3.3. EVG und EPG
- 3.4. EWG
- 4. Europäische Integrationsgeschichte 2: 1959 - 2009
- 4.1. Kleine Fortschritte und Zusammenführungen
- 4.2. Die Gründung der EU und der Vertrag von Maastricht
- 4.3. Der Vertrag von Lissabon (EUV/AEUV) - Eine Verfassung?
- 5. Europäische Integration 3: Zukunft
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die europäische Integration und analysiert, ob sie als ein revolutionärer Prozess betrachtet werden kann. Dabei werden die historischen Entwicklungen von der EGKS bis zur EU beleuchtet, und es wird untersucht, ob es sich um einen langfristigen, zusammenhängenden Wandel oder um eine Vielzahl einzelner, getrennter Prozesse handelt.
- Definition des Begriffs "Revolution" im Kontext von gesellschaftlichen und politischen Veränderungen
- Chronologische Analyse der europäischen Integrationsgeschichte
- Identifizierung von Schlüsselereignissen und deren Einfluss auf die Integration
- Beurteilung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der europäischen Integration und anderen historischen Revolutionen
- Analyse der Frage, ob die europäische Integration als abgeschlossener Prozess, als permanenter Wandel oder als eine Abfolge von Revolutionen betrachtet werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Forschungsfrage und das Problemfeld vor. Es wird die Relevanz des Themas für das heutige Europa betont. In Kapitel 2 wird der Begriff "Revolution" aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und definiert. Es werden verschiedene Modelle von Revolutionen vorgestellt, und die Arbeit bezieht sich auf die Begriffsdefinition von Reinhart Koselleck.
Kapitel 3 widmet sich der ersten Phase der europäischen Integration, von 1946 bis 1957. Es werden die wichtigsten historischen Ereignisse dieser Zeit dargestellt, einschließlich Churchills Europa-Rede, die Gründung der EGKS und die Entwicklungen zur EWG.
Kapitel 4 beleuchtet die zweite Phase der europäischen Integration, von 1959 bis 2009. Es werden wichtige Meilensteine wie die Gründung der EU, der Vertrag von Maastricht und der Vertrag von Lissabon analysiert.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Revolution, EGKS, EU, Vertrag von Maastricht, Vertrag von Lissabon, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wandel, Reformierung, Neuschaffung, Reinhart Koselleck
Häufig gestellte Fragen
Ist die europäische Integration ein revolutionärer Prozess?
Die Arbeit untersucht, ob der stetige Wandel der EU-Verträge Parallelen zu historischen Revolutionen aufweist und nutzt dafür Kosellecks Revolutionsbegriff.
Was war die Bedeutung von Churchills Europa-Rede 1946?
Churchill forderte darin die Schaffung einer Art „Vereinigte Staaten von Europa“, was als einer der geistigen Startpunkte der modernen Integration gilt.
Was änderte der Vertrag von Lissabon?
Der Vertrag von Lissabon gab der EU eine neue Rechtsgrundlage und wurde oft als Versuch gewertet, der EU eine Art Verfassungsstruktur zu geben, ohne es formal so zu nennen.
Warum wird die Integration als „permanenter Wandel“ bezeichnet?
Wie Emmanuel Macron 2018 betonte, ist das Projekt Europa nie abgeschlossen und muss von jeder Generation an neue innere und äußere Spannungen angepasst werden.
Was ist die EGKS?
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1951) war der erste supranationale Schritt der Integration, um die kriegswichtigen Ressourcen gemeinsam zu verwalten.
- Citar trabajo
- Daniel Karl Schmitt (Autor), 2018, Europäische Integration! Eine permanente Vertragsrevolution?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268259