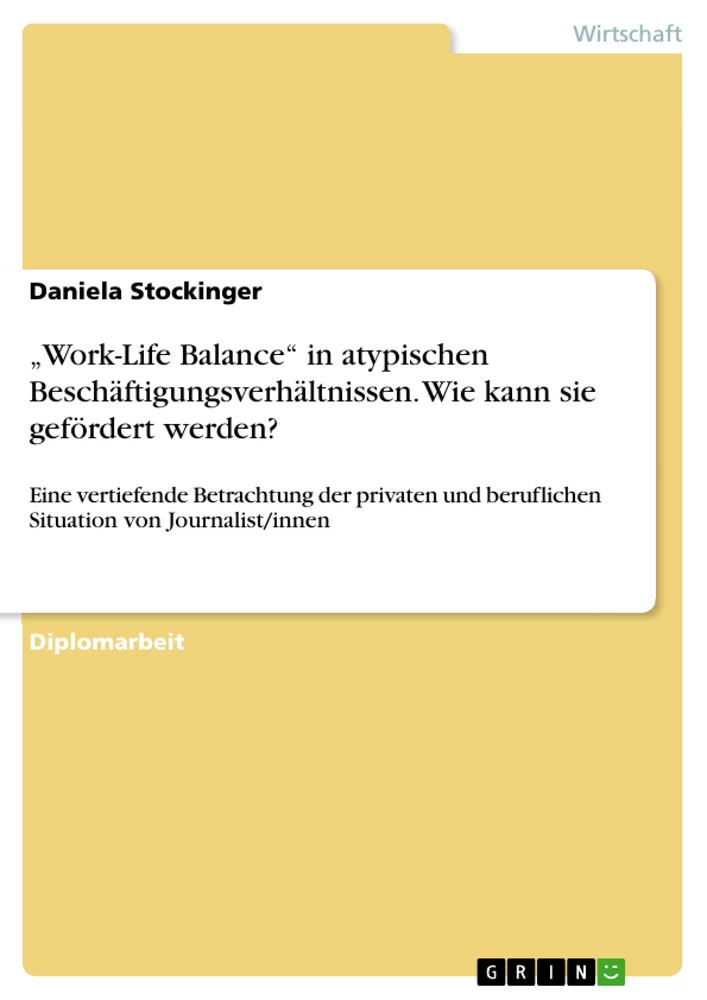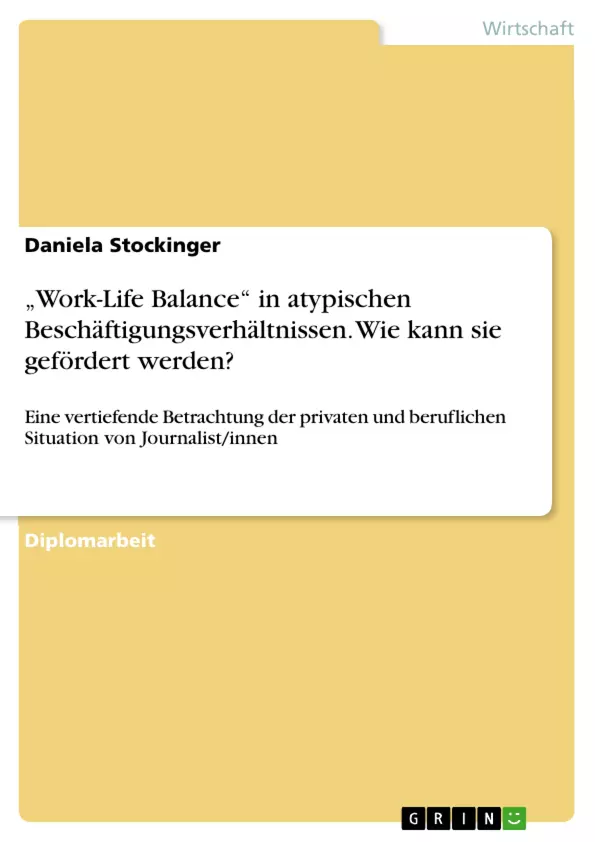Die vorliegende Arbeit wurde bei der Ausschreibung zum AK-Wissenschaftspreis 2009 als wertvollen wissenschaftlichen Beitrag gewürdigt.
Die Jury des Wissenschaftspreises der Kammer für Arbeiter und Angestellte setzte sich aus Professoren der Johannes Kepler Universität Linz, Karl Franzens Universität Graz, Österr. Institut für Wirtschaftsforschung und der Donau-Universität Krems zusammen.
Die Diplomarbeit „Work-Life Balance in atypischen Beschäftigungsverhältnissen“ widmet sich vor allem dem aktuellen Thema der atypischen Beschäftigung. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind Neben- und Teilzeitbeschäftigungen, befristete und geringfügige Beschäftigungen, Freie Dienstverträge sowie Leiharbeit.
Die bisher als „normal“ geltenden Standards – wie vor allem Vollzeitbeschäftigung, Arbeitnehmereigenschaft und unbefristete Beschäftigung – werden in Frage gestellt, da sich der Arbeitsmarkt durch Zunahme der atypischen Beschäftigung stark verändert.
Trotz dieses Anstiegs wird die Arbeits- und Sozialpolitik noch anhand des Wunschbilds der Normalarbeitnehmer betrieben, die mittlerweile eine immer kleiner werdende Gruppe darstellen.
Unterschiedliche Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der „War for Talent“ um Facharbeitskräfte, verdeutlichen die Notwendigkeit zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Arbeitgeber beschäftigen sich mit den Themenbereich „Work-Life Balance“, um „Top Talente“ und Leistungsträger langfristig an ihr Unternehmen zu binden.
Viele Freie Dienstnehmer sind „versteckte Arbeitnehmer“ und sollten wie Normalarbeitnehmer behandelt werden. Auch Journalist/innen haben trotz starker Integration und Bindung an das Medienunternehmen häufig nur Freie Dienstverträge. Arbeitsschutzgesetze und Kollektivverträge sollen die maximale Arbeitsdauer und Überstundenentlohnung festlegen. Diese Schutzgesetze gelten nicht für viele Journalist/innen.
Der Journalismus wurde als Forschungsfeld gewählt, da in diesem Bereich aufgrund der Art der Tätigkeit und der Schnelllebigkeit der Medienbranche die „Work-Life Balance“ von Journalist/innen auch in Normalarbeitsverhältnissen schwierig zu erreichen ist.
Besonders jenen Frauen, die als Freie Dienstnehmerinnen im Journalismus tätig sind, gelingt es besonders schlecht, Beruf-Karriere und Familienleben miteinander zu verbinden, wodurch viele Freie Journalistinnen kinderlos bleiben. Auch bleiben sie hinter dem Einkommen und den Karrieremöglichkeiten ihrer männlichen Kollegen zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition „Work-Life Balance“
- „Work-Life Balance“-Konzepte und atypische Beschäftigung
- Probleme bei Unausgeglichenheit
- Stress-Modell anhand kritischer Lebensereignisse
- Stressauslöser
- „Atypische Beschäftigung“ Begriffsdefinition
- Prekäre Arbeitsmarktsituation
- Formen atypischer Beschäftigung
- Teilzeitarbeit
- Freie Dienstnehmer (Scheinselbständigkeit bei abhängig Beschäftigten)
- Befristete Beschäftigung
- Zeitarbeit bzw. Leiharbeit - Arbeitskräfteüberlassung
- Geringfügig Beschäftigte - Minijobs
- Gründe für das zunehmende Interesse am Thema „Work-Life Balance“
- Arbeitsmarktentwicklungen
- Demographische Entwicklung
- Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in Österreich
- Entwicklung der Freien Dienstverträge in Österreich
- Entwicklung der Leiharbeit in Österreich und Deutschland
- Entwicklung der geringfügigen Beschäftigung bzw. Nebenbeschäftigung
- Entwicklung befristeter Dienstverträge in Österreich und Deutschland
- Entwicklung der Lage der Arbeitszeit
- Langfristige Erhaltung der Leistungsfähigkeit
- Arbeitszufriedenheit
- Erklärungsansätze für die Zunahme an atypischer Beschäftigung
- Wandel der Unternehmensorganisation
- Wandel des Arbeitsmarkts
- Wandel der Arbeitnehmerpräferenzen
- Änderung der arbeitspolitischen Unternehmensstrategien
- Flexibilisierungsbedarf
- „Work-Life Balance“-Maßnahmen
- Gründe für die Einführung von „Work-Life Balance“-Maßnahmen
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Arbeit auf Abruf
- Telearbeit
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Weitere betriebliche Services
- „Work-Life Balance“ von atypisch Beschäftigten
- Vergleich von atypischen Beschäftigungen mit Normalarbeitsverhältnissen
- Auswirkung der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen
- Arbeitsmarktentwicklungen
- „Work-Life Balance“ am Beispiel des Journalismus: Mitarbeiter/innen im Bereich Journalismus
- Berufsbild Journalist/in
- Verschiedene Journalismusbereiche
- Vertragsarten: Normalarbeitsverträge oder Freie Dienstverträge
- „Work-Life Balance“ von Journalist/innen
- Besondere Situation von Frauen im Journalismus
- Gesundheitliche Situation von österreichischen Journalist/innen
- „Work-Life Balance“ von oberösterreichischen Journalist/innen
- Ausgangslage: Arbeitsmarkt Oberösterreich am Beispiel der Journalist/innen
- Empirische Vorgangsweise
- Durchführung der Erhebung
- Ergebnisse der quantitativen Untersuchung und der Interviews mit oberösterreichischen Journalist/innen
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der „Work-Life Balance“ von atypisch Beschäftigten
- Arbeitgeberbezogene Maßnahmen zur Verbesserung der „Work-Life Balance“ im Journalismus
- Überbetriebliche Maßnahmen zur Verbesserung der „Work-Life Balance“ im Journalismus
- Gesetzliche Verbesserungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene
- Erneuerungsbedarf des Arbeitsrechts
- Weiterbearbeitung der bisherigen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für Freie Dienstnehmer
- Gewerkschaftliche Verbesserungsmöglichkeiten
- Ansatzpunkte zur Regulierung atypischer Beschäftigung (am Beispiel Frankreichs)
- Arbeitnehmerbezogene Möglichkeiten zur Verbesserung der „Work-Life Balance“ von Journalist/innen
- Selbstorganisation
- Die Auswahl eines „Work-Life Balance“-fördernden Arbeitgebers
- Eigenverantwortung
- Conclusio
- Literaturverzeichnis
- Internetressourcen
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der „Work-Life Balance“ von atypisch Beschäftigten, insbesondere im Journalismus. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in atypischen Beschäftigungsverhältnissen zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der „Work-Life Balance“ zu entwickeln.
- Definition und Konzepte der „Work-Life Balance“
- Analyse der Arbeitsbedingungen und Herausforderungen atypischer Beschäftigung
- Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der „Work-Life Balance“
- Empirische Untersuchung der Situation von Journalist/innen in Oberösterreich
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Work-Life Balance“ in atypischen Beschäftigungsverhältnissen ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Work-Life Balance“ und „atypische Beschäftigung“ und beleuchtet die Probleme, die bei einer unausgeglichenen Work-Life Balance auftreten können. Kapitel 3 analysiert die Gründe für das zunehmende Interesse am Thema „Work-Life Balance“ und die Entwicklungen im Arbeitsmarkt, die zu einer Zunahme atypischer Beschäftigung führen. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für diese Entwicklungen vorgestellt und verschiedene „Work-Life Balance“-Maßnahmen diskutiert. Kapitel 4 widmet sich der Situation von Journalist/innen und beleuchtet die Besonderheiten des Berufsfeldes im Hinblick auf die „Work-Life Balance“. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur „Work-Life Balance“ von Journalist/innen in Oberösterreich. Kapitel 6 entwickelt Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik, um die „Work-Life Balance“ von atypisch Beschäftigten zu verbessern. Die Conclusio fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Work-Life Balance“, atypische Beschäftigung, Journalismus, Arbeitsmarktentwicklungen, Handlungsempfehlungen, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Flexibilisierung, Arbeitszeitmodelle, Stress, Gesundheit, Selbstorganisation, Arbeitsrecht, Gewerkschaften, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter atypischen Beschäftigungsverhältnissen?
Dazu zählen Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung, befristete Verträge, freie Dienstverträge sowie Leiharbeit, die vom klassischen Vollzeit-Standard abweichen.
Warum ist Work-Life Balance im Journalismus besonders schwierig?
Die Schnelllebigkeit der Medienbranche, unregelmäßige Arbeitszeiten und der hohe Termindruck machen die Trennung von Beruf und Privatleben zur Herausforderung.
Welche Probleme haben freie Dienstnehmer bei der Work-Life Balance?
Sie unterliegen oft nicht den Schutzbestimmungen des Arbeitsrechts (z. B. Überstundenregelung) und tragen ein höheres wirtschaftliches Risiko, was zu mehr Stress führt.
Wie wirkt sich atypische Beschäftigung auf Frauen im Journalismus aus?
Frauen in freien Dienstverhältnissen haben es oft schwerer, Karriere und Familie zu vereinbaren, was häufig zu Kinderlosigkeit oder geringerem Einkommen führt.
Welche Maßnahmen können die Work-Life Balance fördern?
Möglichkeiten sind flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Gesundheitsförderung, bessere gesetzliche Absicherung freier Dienstnehmer und bessere Selbstorganisation.
- Arbeit zitieren
- Mag. Daniela Stockinger (Autor:in), 2009, „Work-Life Balance“ in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Wie kann sie gefördert werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126826