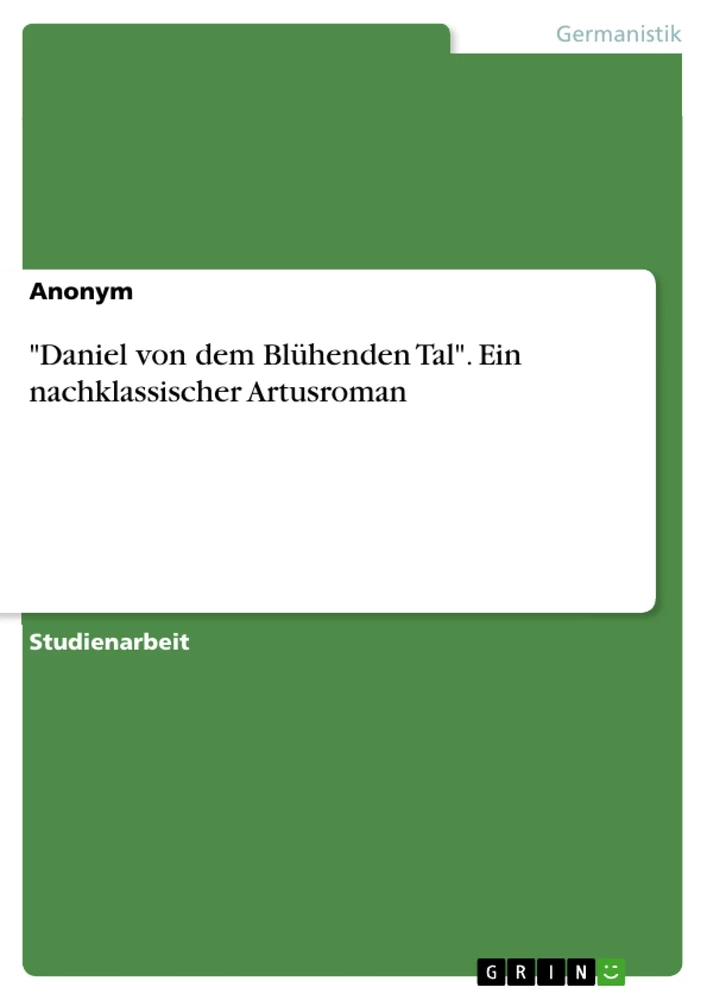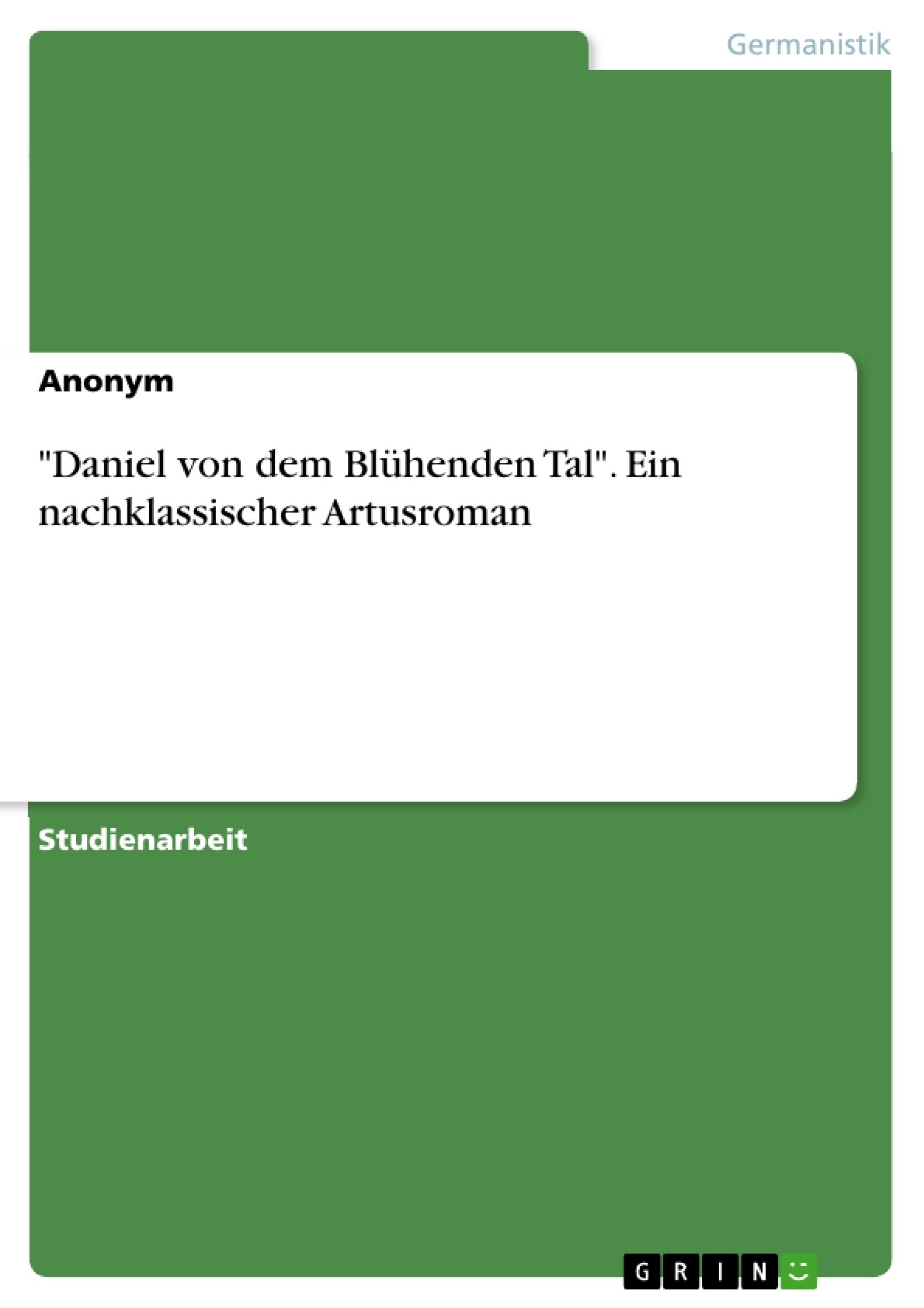"Daniel von dem Blühenden Tal" gilt in der Forschung als ein sehr umstrittener Artusroman, zu dem es zahlreiche sich scheidende Meinungen gibt. Jene reichen von "Abenteuergeschichte ohne Geist und Sinn" bis hin zur Erkenntnis von Ingeborg Henderson, die im Daniel einen Beweis für die erstaunliche Bildung des Dichters und seine bewusste Hinwendung zum aktuellen Thema sieht. Der Grund für die unterschiedlichen Urteile, ist die Abweichung des Stoffes von klassischen Artusromanen wie Parzival von Wolfram von Eschenbach oder Erec und Iwein von Hartmann von Aue.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, zunächst aufzuzeigen, inwiefern der Held in "Daniel von dem Blühenden Tal" eine Veränderung im Vergleich zu seinen klassischen Vorgängern erfährt, um anschließend der Frage nachzugehen, warum der Stricker die Alternativen bei seiner Daniel-Figur entwickelt.
Hierzu werden zunächst grundlegend die Konzepte der Konventionalisierung und Alternativenbildung nach Remele erläutert. Im Anschluss daran werden die Aspekte Aufnahme in die Tafelrunde, minne und list aus dem vorliegenden Roman anhand der beiden Konzepte analysiert. Im zweiten Arbeitsprozess wird die Herleitung des Begriffes
nachklassisch herangezogen, um darauffolgend festzustellen, dass Daniel ein nachklassischer Artusroman ist. Fortlaufend werden die Veränderungen vom klassischen Artusroman zum Daniel erörtert. Dies dient, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine bewusste Veränderung des Autors innerhalb der Gattung der Artusromane handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konventionalisierung und Alternativenbildung
- Erläuterung der Konzepte
- Aufnahme in die Tafelrunde
- minne
- list
- Daniel von dem Blühenden Tal als nachklassischer Artusroman
- Zur Terminologie "nachklassisch"
- Klassischer und nachklassischer Artusroman
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Artusroman "Daniel von dem Blühenden Tal" des Strickers und analysiert, inwiefern sich der Held von klassischen Artusromanen unterscheidet. Dabei wird insbesondere die Frage nach der bewussten Entwicklung von Alternativen durch den Stricker in Bezug auf die Figur des Daniel beleuchtet. Die Arbeit betrachtet die Konzepte der Konventionalisierung und Alternativenbildung nach Remele und untersucht, wie sich die Aufnahme in die Tafelrunde, minne und list im Daniel von den klassischen Konventionen abheben.
- Konventionalisierung und Alternativenbildung im Artusroman
- Die Figur des Daniel im Vergleich zu klassischen Artushelden
- Die Rolle des Strickers als Autor und seine Intentionen
- Der Wandel vom klassischen zum nachklassischen Artusroman
- Die Bedeutung von list im Daniel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Artusromans "Daniel von dem Blühenden Tal" ein und erläutert die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Werk. Es wird die Zielsetzung der Arbeit vorgestellt, die darin besteht, die Veränderungen des Helden im Vergleich zu klassischen Artusromanen zu analysieren und die Gründe für die Entwicklung von Alternativen durch den Stricker zu erforschen.
Im zweiten Kapitel wird das Konzept der "Konventionalisierung und Alternativenbildung" nach Remele vorgestellt und anhand dreier zentraler Aspekte aus dem Daniel, der Aufnahme in die Tafelrunde, minne und list, analysiert. Es wird gezeigt, inwiefern sich der Held Daniel in Bezug auf diese Konzepte von seinen klassischen Vorgängern unterscheidet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Artusroman, Konventionalisierung, Alternativenbildung, Daniel von dem Blühenden Tal, der Stricker, nachklassisch, Tafelrunde, minne, list, Ritter, Königssohn, Veränderung, Abweichung, Tradition.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, "Daniel von dem Blühenden Tal". Ein nachklassischer Artusroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1269007