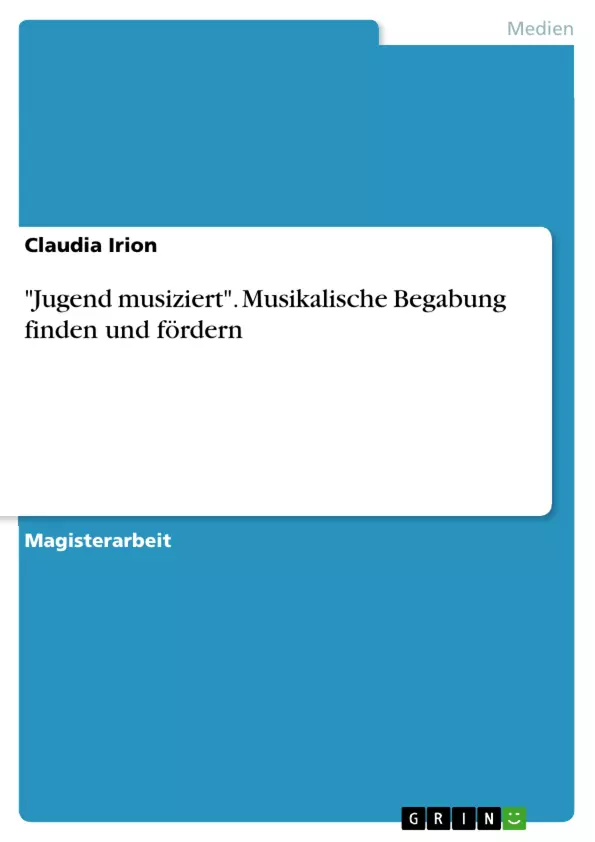Vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren steigenden pädagogischen und bildungspolitischen Bedeutung der intensiven Förderung junger Musiker ist die vorliegende Arbeit entstanden, mit dem Ziel, einen Überblick über den Beitrag zu geben, den JM zur Begabtenfindung und -förderung bundesweit in Deutschland und
darüber hinaus leistet. In Kapitel I wird dazu der begriffliche Bezugsrahmen der Arbeit anhand einer Diskussion der wichtigsten Fachliteratur abgegrenzt. Angefangen vom Musikalitäts- und Begabungsbegriff (I.1), über Erklärungsmodelle hoher musikalischer Leistung (I.2), Determinanten der Entwicklung (I.3), Messbarkeit von Musikalität (I.4) bis hin zu Persönlichkeitsmerkmalen (I.5) dient dieser Teil als Grundlage für die darauf folgenden Ausführungen.
Der zweite Abschnitt stellt daran anschließend JM als eine Möglichkeit der Begabtenfindung und -förderung im Bereich der Musik dar, wobei zunächst näher auf dessen Aufgaben, Ziele sowie Bedeutung (II.1) eingegangen wird. Des Weiteren werden drei grundlegende Studien der musikalischen Begabungsforschung von BASTIAN vorgestellt (II.2), welche die Bedingungen dieses Wettbewerbes beleuchten, den Motivationen der Jugendlichen in Einzelinterviews auf den Grund gehen und die Ergebnisse einer großen schriftlichen Befragung akkumulieren.
Aufbauend darauf wird in Kapitel III beschrieben, welchen Beitrag JM für die Begabtenfindung und -förderung leistet. Es werden dazu unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten und ihre Wirkungen beschrieben sowie Grenzen und aktuelle ungelöste Probleme aufgezeigt, mit denen sich der Deutsche Musikrat als Träger des Wettbewerbes auseinandersetzen muss. Grundlage hierfür sind unter anderem auch drei Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit mit verantwortlichen Initiatoren von JM geführt wurden und einen aktuellen Einblick in das Thema und die Problematik ermöglichen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in einer Schlussbetrachtung zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- I THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- I.1 Musikalität als theoretisches Konstrukt
- I.1.1 Anfänge der Musikalitätsforschung
- I.1.2 Der Terminus Musikalität und sein begriffliches Umfeld
- I.1.3 Definitionsmöglichkeiten
- I.2 Erklärungsmodelle hoher musikalischer Leistung
- 1.2.1 Begabungskonzepte
- 1.2.2 Expertisemodell
- 1.2.3 Kritische Würdigung
- I.3 Determinanten musikalischer Entwicklung
- 1.3.1 Vererbung
- 1.3.2 Umwelt und Sozialisation
- I.3.3 Aktive Gestaltung der eigenen Entwicklung
- I.4 Messbarkeit der Musikalität
- I.4.1 Definition, Aufgaben und Ziele
- I.4.1.1 SEASHORE und BENTLEY
- I.4.1.2 Musikalitätstests von GORDON
- 1.4.1.3 Neuere Testverfahren
- I.4.2 Kritik an Musikalitätstests
- I.5 Musikalität und Persönlichkeit
- I.5.1 Musikalität und Intelligenz
- I.5.2 Persönlichkeitsmerkmale von Musikern
- I.5.3 Wunderkinder
- II DER WETTBEWERB „JUGEND MUSIZIERT“
- II.1 Rahmenbedingungen des Wettbewerbes
- II.1.1 Zur Grundsteinlegung und Entwicklung
- II.1.2 Zur kulturpolitischen Bedeutung des Wettbewerbes
- II.1.3 „Jugend musiziert“ und Europa
- II.2 Forschungsarbeiten über „Jugend musiziert“
- II.2.1 Jugend musiziert. Der Wettbewerb in der Sicht von Teilnehmern und Verantwortlichen (1987)
- II.2.2 Leben für Musik. Eine Biographiestudie über musikalische (Hoch-) Begabungen (1989)
- II.2.3 Jugend am Instrument. Eine Repräsentativstudie (1991)
- III DER FÖRDERGEDANKE BEI „JUGEND MUSIZIERT“
- III.1 Musikalische und pädagogische Aspekte
- III.1.1 Förderung von Neuer Musik und kammermusikalischen Besetzungen
- III.1.2 Deutscher Kammermusikkurs und Jugendorchester
- III.1.3 Begegnung und Beratung
- III.1.4 Positive Auswirkungen einer Teilnahme
- III.2 Ökonomische Aspekte
- III.2.1 Anschluss- und Fördermaßnahmen
- III.2.2,,WESPE“ - Wochenende der Sonderpreise
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- Musikalität als theoretisches Konstrukt und ihre Messbarkeit
- Erklärungsmodelle hoher musikalischer Leistung, insbesondere Begabungskonzepte und Expertisemodell
- Determinanten musikalischer Entwicklung, wie Vererbung, Umwelt und Sozialisation
- Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ als Förderinstrument und seine Rahmenbedingungen
- Der Fördergedanke bei „Jugend musiziert“ mit seinen musikalischen, pädagogischen und ökonomischen Aspekten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der musikalischen Begabungsfindung und -förderung im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Förderung musikalisch begabter Kinder und Jugendlicher im Kontext dieses Wettbewerbs zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der Musikalität, die Entwicklung musikalischer Begabung und die Rolle von Förderung und Wettbewerb.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Darstellung der theoretischen Grundlagen der Musikalität. Sie beleuchtet die Anfänge der Musikalitätsforschung, die Entwicklung des Begriffs „Musikalität“ und verschiedene Definitionsmöglichkeiten. Anschließend werden Erklärungsmodelle hoher musikalischer Leistung vorgestellt, darunter Begabungskonzepte und das Expertisemodell. Die Arbeit analysiert die Determinanten musikalischer Entwicklung, wie Vererbung, Umwelt und Sozialisation, sowie die Rolle der aktiven Gestaltung der eigenen Entwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Messbarkeit der Musikalität, wobei verschiedene Testverfahren und deren Kritik diskutiert werden. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Musikalität und Persönlichkeit, insbesondere die Beziehung zwischen Musikalität und Intelligenz sowie die Persönlichkeitsmerkmale von Musikern.
Im zweiten Kapitel wird der Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Detail betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, einschließlich seiner Grundsteinlegung, Entwicklung und kulturpolitischen Bedeutung. Sie analysiert die Forschungsarbeiten über „Jugend musiziert“ und beleuchtet die Rolle des Wettbewerbs im europäischen Kontext.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Fördergedanken bei „Jugend musiziert“. Die Arbeit untersucht die musikalischen und pädagogischen Aspekte der Förderung, wie die Förderung von Neuer Musik und kammermusikalischen Besetzungen, den Deutschen Kammermusikkurs und Jugendorchester, sowie die Bedeutung von Begegnung und Beratung. Sie analysiert die positiven Auswirkungen einer Teilnahme am Wettbewerb und beleuchtet die ökonomischen Aspekte der Förderung, einschließlich Anschluss- und Fördermaßnahmen sowie das „WESPE“-Wochenende der Sonderpreise.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen musikalische Begabung, Musikalität, Begabungsförderung, „Jugend musiziert“, Wettbewerb, Förderung, Musikpädagogik, Musikwissenschaft, Talententwicklung, Expertise, Determinanten musikalischer Entwicklung, Messbarkeit der Musikalität, Persönlichkeitsmerkmale von Musikern, Wunderkinder, kulturpolitische Bedeutung, Förderung von Neuer Musik, Kammermusik, Jugendorchester, Begegnung und Beratung, Anschluss- und Fördermaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Musikalität in der Fachliteratur definiert?
Musikalität wird als theoretisches Konstrukt betrachtet, dessen Definition von frühen Ansätzen bis hin zu modernen Begabungskonzepten reicht.
Welche Rolle spielt „Jugend musiziert“ bei der Begabtenförderung?
Der Wettbewerb dient als zentrales Instrument in Deutschland, um musikalische Talente zu finden, zu fördern und pädagogisch zu begleiten.
Was ist das Expertisemodell in der Musik?
Es erklärt hohe musikalische Leistungen weniger durch angeborenes Talent als vielmehr durch intensives, gezieltes Üben und Umweltfaktoren.
Welche Faktoren beeinflussen die musikalische Entwicklung?
Die Arbeit nennt Vererbung, Umwelt, Sozialisation sowie die aktive Gestaltung der eigenen Entwicklung als entscheidende Determinanten.
Was sind Anschlussmaßnahmen nach dem Wettbewerb?
Dazu gehören Kurse, Jugendorchester und Sonderpreise wie das „WESPE“-Wochenende, um die Teilnehmer über den Wettbewerb hinaus ökonomisch und musikalisch zu unterstützen.
- Citar trabajo
- Claudia Irion (Autor), 2008, "Jugend musiziert". Musikalische Begabung finden und fördern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126900