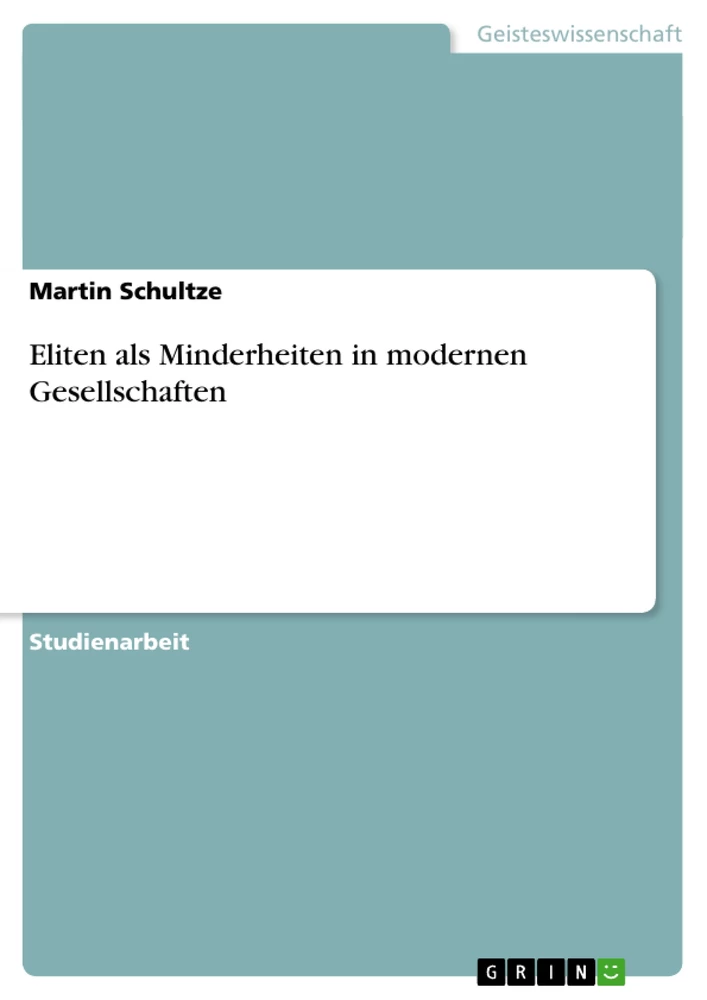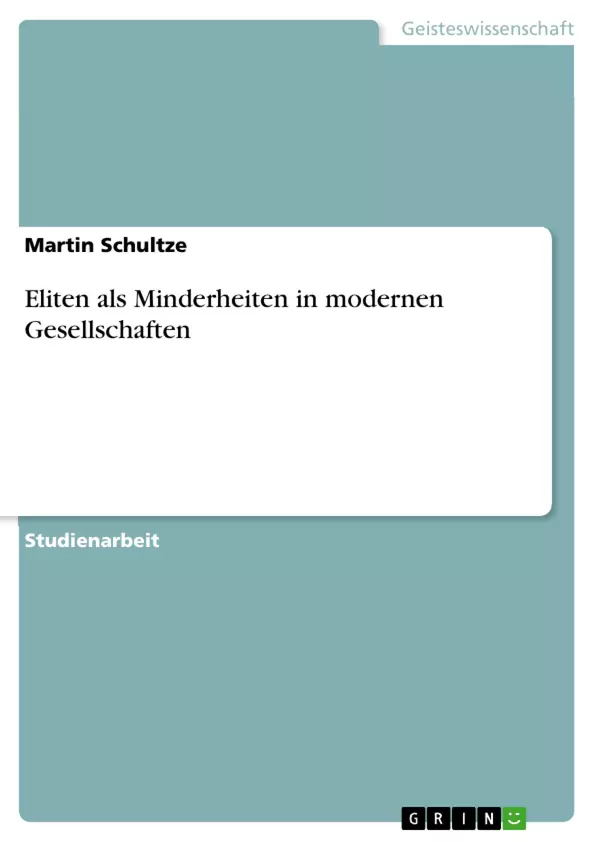Elitenschelte ist in. Angesichts der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise und dem drohenden Staatsbankrott einiger Länder stehen Führungspersonen in der Wirtschaft unter scharfer Kritik. Manager, die ihre Institute oder Unternehmen durch hoch spekulative – von der Realwirtschaft abgekoppelte – Finanzgeschäfte ruiniert haben und jetzt Steuergelder zur Sanierung fordern oder mit Millionenabfindungen die Unternehmen verlassen, sorgen für Empörung in allen Teilen der Bevölkerung und der Politik.
Auch bei anderen krisenhaften Symptomen wie hoher Arbeitslosigkeit, steigender Verschuldung und Strukturproblemen in den sozialen Sicherungssystemen wird regelmäßig an der mangelnden Leistungs- und Problemlösungsfähigkeit gesellschaftlicher Eliten gezweifelt (vgl. Grabow 2006: 19).
Ist davon auszugehen, dass Eliten nicht nur mit der Demokratie vereinbar sind, sondern auch für den Erhalt, Wohlstand und Reformfähigkeit unverzichtbar sind, wie es die Mehrzahl der Demokratietheoretiker sieht, so muss sich auch die Frage nach der Förderung von zukünftigen Eliten gestellt werden. In der modernen Wissensgesellschaft werden darunter Personen mit besonderen Fähigkeiten und Talenten, also Hochbegabte verstanden. Damit zielt der Begriff Eliteförderung vor allem auf das Hervorbringen von Leistungs- und Bildungseliten ab. In diesem Zusammenhang sind Eliten für die Gesellschaft nur sinnvoll, wenn sie gemeinwohlorientiert sind und sich ihrer sozialen Verantwortung stellen, immerhin wurde mit gesellschaftlichen Ressourcen in die Ausbildung der zukünftigen Entscheidungsträger investiert, was die Eliten in irgendeiner Form zurückgeben sollten. Nur so wird ihre herausragende Stellung in der Gesellschaft legitimiert.
Der schlechte Ruf der Eliten in Deutschland ist sowohl auf die aktuell fehlende soziale Verantwortung und Gemeinwohlorientierung zurückzuführen als auch auf eine historisch negative Besetzung des Begriffs „Elite“ in der deutschen Geschichte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was sind Eliten und wie können sie identifiziert werden?
- 3. Legitimität, Gemeinwohlorientierung, Problemlösungs- und Leistungsfähigkeit von Eliten
- 4. Die Elitenstruktur der BRD: Zentrale Erkenntnisse aus der Potsdamer Elitestudie 1995
- 5. Werteinstellungen und Gewohnheiten von Eliten: Ergebnisse der Befragungen des Allensbach Instituts für die Zeitschrift „Capital“
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Elitebegriff in modernen Gesellschaften, insbesondere im Kontext der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert Kriterien zur Identifizierung von Eliten, beleuchtet deren Legitimität und Leistungsfähigkeit und untersucht empirisch die Struktur und Werteinstellungen deutscher Eliten.
- Definition und Identifizierung von Eliten
- Legitimität und Leistungsfähigkeit von Eliten
- Elitenstruktur der BRD
- Werteinstellungen und Gewohnheiten deutscher Eliten
- Eliteförderung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Kritik an Wirtschaftseliten im Kontext der Finanzkrise und führt in die Thematik der Elitenforschung ein. Sie stellt die zentrale Frage nach der Leistungsfähigkeit und Legitimität von Eliten in der BRD und kündigt den weiteren Aufbau der Arbeit an, der sich mit der Definition von Eliten, ihrer Identifizierung und empirischen Untersuchung beschäftigt. Der Ausblick deutet eine Auseinandersetzung mit dem Thema Eliteförderung in Deutschland an.
2. Was sind Eliten und wie können sie identifiziert werden?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Elite“. Es zeigt die Schwierigkeit auf, eine einheitliche Definition zu finden, und beleuchtet verschiedene konkurrierende Ansätze. Der Fokus liegt auf dem Ausleseprozess, der zur herausragenden Stellung von Eliten führt. Das Kapitel diskutiert verschiedene Kriterien zur Qualifizierung elitärer Personen (Leistung, Reputation, Bildung etc.) und führt den Begriff der „Teileliten“ in modernen, funktional differenzierten Gesellschaften (nach Luhmann) ein. Die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Machtstrukturen wird angesprochen.
Schlüsselwörter
Eliten, Eliteforschung, Legitimität, Leistungsfähigkeit, BRD, Elitenstruktur, Werteinstellungen, Potsdamer Elitestudie, Allensbach Institut, Eliteförderung, Macht, funktionale Differenzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Elitenstruktur in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Elitebegriff in modernen Gesellschaften, speziell in der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Sie untersucht Kriterien zur Identifizierung von Eliten, deren Legitimität und Leistungsfähigkeit sowie die Struktur und Werteinstellungen deutscher Eliten anhand empirischer Daten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Identifizierung von Eliten, ihre Legitimität und Leistungsfähigkeit, die Elitenstruktur der BRD, die Werteinstellungen und Gewohnheiten deutscher Eliten sowie - in einem Ausblick - die Eliteförderung in Deutschland. Sie bezieht sich dabei auf die Potsdamer Elitestudie von 1995 und Befragungen des Allensbach Instituts für die Zeitschrift „Capital“.
Wie werden Eliten in dieser Arbeit definiert und identifiziert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen des Elitebegriffs und die Schwierigkeiten, eine einheitliche Definition zu finden. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze und Kriterien zur Identifizierung elitärer Personen (Leistung, Reputation, Bildung etc.) und führt den Begriff der „Teileliten“ in modernen Gesellschaften ein. Die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Machtstrukturen wird ebenfalls thematisiert.
Welche empirischen Studien werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf Ergebnisse der Potsdamer Elitestudie von 1995 und Befragungen des Allensbach Instituts für die Zeitschrift „Capital“, um die Elitenstruktur und die Werteinstellungen deutscher Eliten empirisch zu untersuchen.
Welche Aspekte der Legitimität und Leistungsfähigkeit von Eliten werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Legitimität und Leistungsfähigkeit von Eliten im Kontext der aktuellen Kritik an Wirtschaftseliten (z.B. im Zusammenhang mit der Finanzkrise). Sie hinterfragt, ob und wie Eliten in der BRD ihre Legitimität und Leistungsfähigkeit begründen und aufrechterhalten können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Identifizierung von Eliten, ein Kapitel zu Legitimität, Gemeinwohlorientierung, Problemlösungs- und Leistungsfähigkeit, ein Kapitel zur Elitenstruktur der BRD basierend auf der Potsdamer Elitestudie, ein Kapitel zu Werteinstellungen und Gewohnheiten basierend auf Daten des Allensbach Instituts und eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eliten, Eliteforschung, Legitimität, Leistungsfähigkeit, BRD, Elitenstruktur, Werteinstellungen, Potsdamer Elitestudie, Allensbach Institut, Eliteförderung, Macht, funktionale Differenzierung.
- Citar trabajo
- Martin Schultze (Autor), 2009, Eliten als Minderheiten in modernen Gesellschaften, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126925