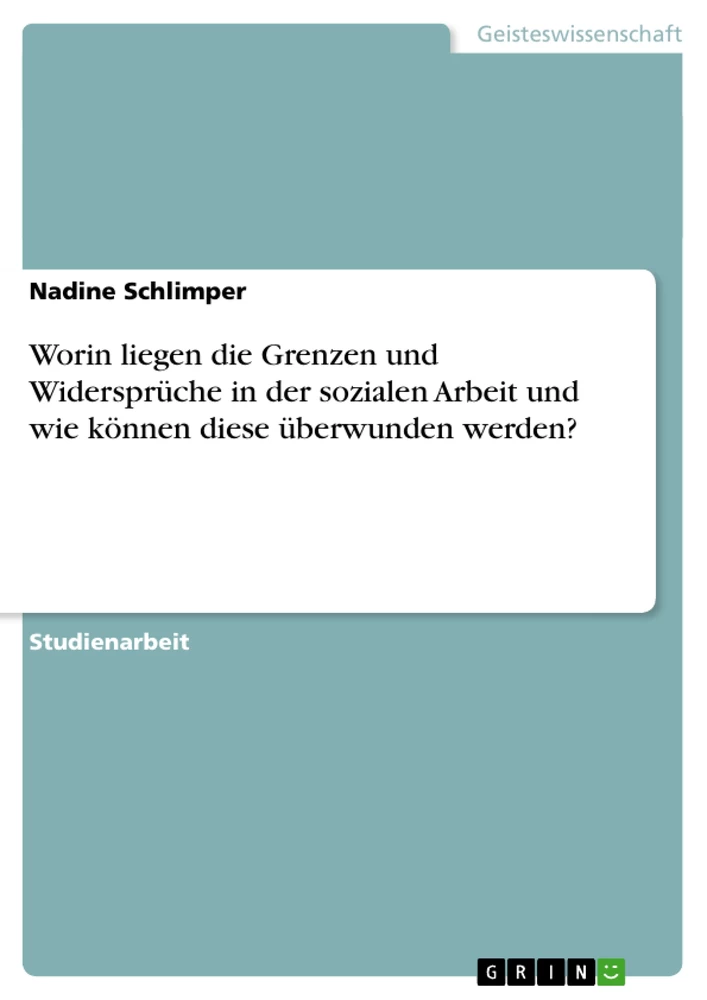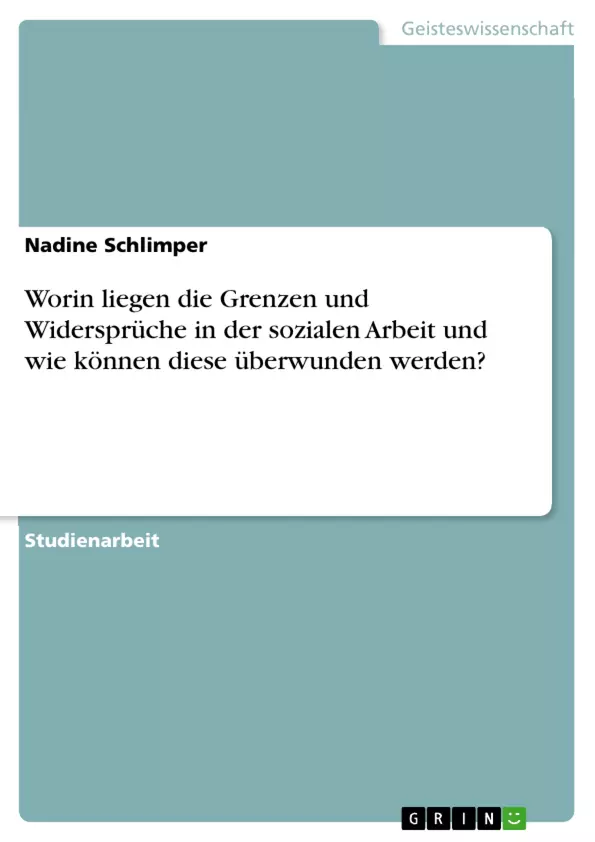„Vernachlässigt, geschlagen, verhungert, getötet – immer wieder erschüttern in Deutschland Fälle von schweren Kindesmisshandlungen. Und immer geraten dabei die Jugendämter in die Diskussion. Auch der jüngste Fall im schleswig-holsteinischen Darry wirft Fragen auf. Warum fiel der Behörde nicht auf, dass die Mutter der fünf getöteten Kinder psychisch krank ist? Die Familie wurde vom Jugendamt betreut. Es gab auch Hinweise von Lehrern, wonach die Kinder verwahrlost zum Unterricht erschienen. Erst nach dem die Jungen am Mittwoch der Schule fernblieben, schritt das Jugendamt ein - mit einem Hausbesuch. Zu dem Zeitpunkt waren die Kinder aber schon tot.“ (http://www.focus.de/panorama/welt/kinder_aid_228500.html)
Es ist Aufgabe des Staates rechtzeitig einzugreifen, wenn sich die Eltern ihrem natürlichen Erziehungsrecht zum Schaden des Kindes entziehen. Im Rahmen seines Wächteramtes hat der Staat die Aufgabe und Verpflichtung, die Pflege und Erziehung der Kinder sicherzustellen. Doch der Staat ist nicht dazu legitimiert in das natürliche Elternrecht der Familien einzugreifen und über eine „gute“ oder „schlechte“ Erziehung zu urteilen und sie vorzugeben.
Steckt hier nicht schon ein Widerspruch zwischen dem Staat als Wächteramt und dem Recht der Eltern zur Erziehung ihres Kindes? Wie soll und kann der Staat eingreifen, wenn die Erziehung des Kindes natürliches Elternrecht ist? Der Staat soll unsere Kinder schützen und beschützen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz schafft die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu. Es ist seit nahezu 15 Jahren unverändert und bietet eine ganze Reihe an Leistungen und individuellen Rechtsansprüchen an. Aber was ist, wenn die sogenannte „Problemfamilie“ die Hilfe ablehnt? Wann ist der Richtige Zeitpunkt für das Jugendamt einzugreifen und ein Kind aus der Familie zu nehmen?
Aufgrund von persönlichem Interesse, wie in einer von dem Jugendamt betreuten Familie ein Kind misshandelt oder gar getötet werden kann, habe ich mich in der vorliegenden Hausarbeit mit der Fragestellung: „Worin liegen die Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit und wie können diese überwunden werden?“ auseinandergesetzt.
Zunächst werden die Begriffe „Kindeswohl“ und „struktureller Widerspruch“ definiert und erläutert. Die daraus resultierenden Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit, wo möglicherweise weitere zu finden sind und wie sie überwunden werden können und sollen, werden zentrale Aspekte dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Dreieck Kindeswohl-Elternrecht-Wächteramt
- Der Begriff des Kindeswohles
- Der Struktureller Widerspruch
- Worin liegen die Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit?
- Nähe und Distanz oder die Notwendigkeit von Beteiligung der Betroffenen
- Unterschiedliches Werteverständnis
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Grenzen und Widersprüchen in der sozialen Arbeit. Sie analysiert die Spannungsfelder zwischen dem Kindeswohl, dem Elternrecht und dem Wächteramt des Staates. Die Arbeit untersucht, wie diese Widersprüche in der Praxis der sozialen Arbeit zum Tragen kommen und welche Herausforderungen sich daraus für die Fachkräfte ergeben.
- Der Begriff des Kindeswohls und seine Interpretation in der Praxis
- Der strukturelle Widerspruch zwischen Hilfe und Kontrolle in der sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von Nähe und Distanz in der Beziehung zwischen Fachkraft und Klient
- Die Herausforderungen des unterschiedlichen Werteverständnisses in der sozialen Arbeit
- Mögliche Ansätze zur Überwindung von Grenzen und Widersprüchen in der sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den aktuellen Diskurs um Kindeswohlgefährdung und die Rolle des Staates als Wächteramt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Dreieck Kindeswohl-Elternrecht-Wächteramt. Es definiert den Begriff des Kindeswohls und analysiert die Herausforderungen, die sich aus der unbestimmten Rechtslage ergeben. Der strukturelle Widerspruch zwischen Hilfe und Kontrolle in der sozialen Arbeit wird im zweiten Kapitel ebenfalls beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit im Detail. Es analysiert die Spannungsfelder zwischen Nähe und Distanz in der Beziehung zwischen Fachkraft und Klient sowie die Herausforderungen des unterschiedlichen Werteverständnisses in der sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Kindeswohl, das Elternrecht, das Wächteramt des Staates, die Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit, die Hilfeleistung, die Kontrolle, die Nähe und Distanz in der Beziehung zwischen Fachkraft und Klient sowie das unterschiedliche Werteverständnis in der sozialen Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus diesen Spannungsfeldern für die Praxis der sozialen Arbeit ergeben.
- Quote paper
- Nadine Schlimper (Author), 2009, Worin liegen die Grenzen und Widersprüche in der sozialen Arbeit und wie können diese überwunden werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126960