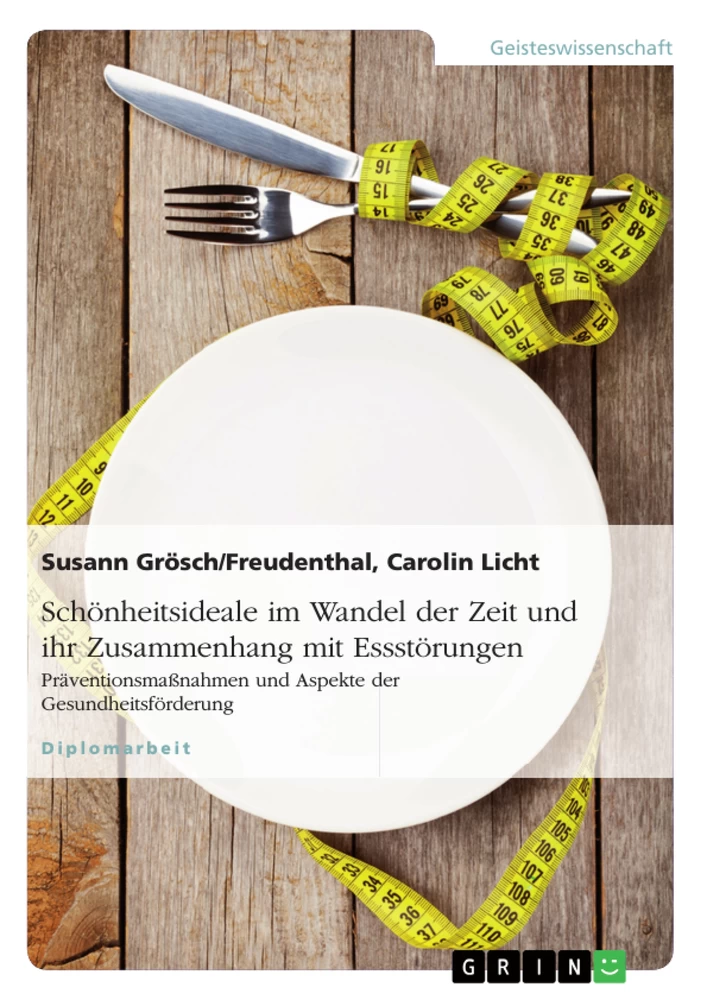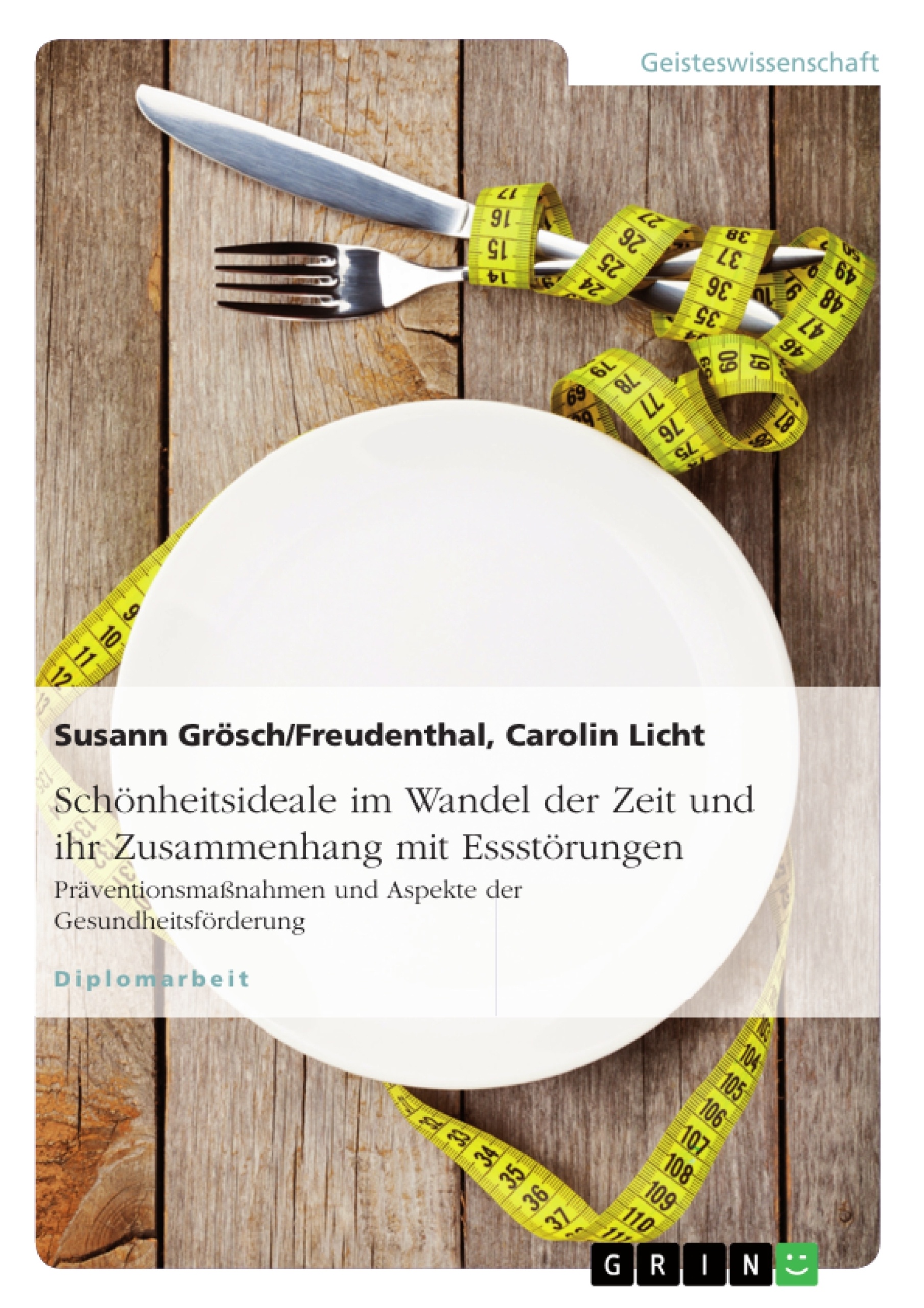Das Phänomen Essstörung stellt den Mittelpunkt unserer Arbeit dar. Wir möchten unser Hauptaugenmerk auf den gesellschaftstheoretischen Kontext beziehungsweise die Rolle der Frauen in der sogenannten westlichen zivilisierten und industrialisierten Welt legen.
Folgende Fragen haben sich für uns ergeben, die wir versuchen wollen zu klären:
Woran liegt es, dass hauptsächlich Frauen an einer Essstörung erkranken?
Welche Einflüsse haben TV-Sendungen wie „Germany's Next Topmodel“ oder „Besser Essen“ auf unsere Gesellschaft?
Zunächst möchten wir einen kleinen historischen Einblick in das sich wandelnde Schönheitsideal innerhalb der Gesellschaft geben.
Die unterschiedlichen Formen der Essstörungen sowie eine Krankheitsbeschreibung von Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Disorder und den verschiedenen Unterformen sollen anschließend näher betrachtet werden. Hierzu gehört auch die psychische Befindlichkeit des einzelnen Menschen, deren Einfluss sich auch auf unser Bewegungsverhalten auswirkt.
In Kapitel 3 werden „Mögliche Ursachen bzw. Faktoren von Essstörungen“ dargestellt. Hierzu betrachten wir die biologisch-genetischen Faktoren, die psychologischen Komponenten, den familiären Einfluss, sowie die soziokulturellen und gesellschaftspolitischen Einflusskomponenten. Hier wird sich zeigen, dass es nicht nur eine einzige Ursache für essgestörtes Verhalten gibt, sondern dass viele verschiedene individuelle Faktoren bei der Entstehung von Essstörungen beteiligt sein können.
Im darauf folgenden Kapitel beschäftigen wir uns mit den gängigsten Behandlungsansätzen, deren Zielen und Erfolgen. Diese werden häufig miteinander kombiniert, um die Chancen auf Heilung zu erhöhen. Hier zeigt sich auch, dass es aufgrund der verschiedenen Entstehungsfaktoren und Hintergründe der Betroffenen keine einheitlichen Therapiemaßnahmen gibt.
Der fünfte Teil der Arbeit bezieht sich auf Möglichkeiten der Prävention von Essstörungen. Es werden anderem eigene Überlegungen zu primären Präventionen aufgezeigt und deren Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag. Eine Überlegung zu dieser Problematik wäre die allgemeine Einführung bzw. Weiterentwicklung von Ganztagsschulen, mit bereits integrierten Präventionsmaßnahmen.
Anschließend möchten wir noch einmal kurz auf gesundheitsfördernde Aspekte in der Prävention, mit Hilfe von progressiven Muskelentspannung und autogenem Training, eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Schönheitsideale und Gesundheitsvorstellungen im Wandel der Zeit
- Twiggy oder Rubensfrau - Schönheit im Wandel der Zeit
- Historische Erscheinungsformen vom abweichenden Essverhalten
- Geschichte der Anorexia nervosa
- Geschichte der Bulimia nervosa
- Geschichte der Adipositas
- Geschichte der Binge-Eating-Disorder (BED)
- Essstörungen - eine Einführung – körperliche und medizinische Folgen
- Essstörungen - eine Sucht?
- Orthorexie (Orthorexia nervosa)
- Gezügeltes Essverhalten (restrained eating) - Der Einstieg zur Essstörungen?
- Anorexia nervosa (Magersucht)
- Folgeschäden
- Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht)
- Folgeschäden
- Übergewicht - Adipositas
- Folgeschäden
- Latente Adipositas/Latente Esssucht
- Binge-Eating-Disorder (Fressanfälle)
- Folgeschäden
- Mögliche Ursachen bzw. Faktoren von Essstörungen
- Biologisch-genetische Faktoren
- Psychologische Komponenten
- Sexueller Missbrauch und Essstörungen
- Familiäre Einflüsse
- Soziokulturelle und gesellschaftspolitische Einflüsse
- Feministische Aspekte
- Hilfen zur Bewältigung von Essstörungen, ihre Ziele und Erfolge
- Ambulante Beratungen
- Selbsthilfegruppen
- Somatisch orientierte Behandlungen
- Methoden der Psychotherapie
- Verhaltenstherapie
- Psychoanalyse
- Gesprächspsychotherapie
- Systemische Familientherapie
- Körpertherapeutische Ansätze
- Maltherapie
- Musiktherapie
- Tanz- und Bewegungstherapie
- Entspannungstechniken
- Dauer, Kosten und Erfolge der Behandlungen
- Prävention von Essstörungen
- Zum Begriff der Prävention
- Bestimmung der Risikofaktoren und deren Reduzierungsmöglichkeiten
- Projekte zur Arbeit bei Essstörungen und deren Möglichkeiten zur Umsetzung
- Projekt „BodyTalk“
- Projekt „Korrekt Kochen!“
- Eigene Überlegungen zu Präventionsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entwicklung von Schönheitsidealen im Laufe der Zeit und deren Zusammenhang mit Essstörungen. Ziel ist es, Präventionsmaßnahmen und gesundheitsfördernde Aspekte im Kontext dieser Entwicklung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert historische und aktuelle Erscheinungsformen von Essstörungen und deren Ursachen auf biologischer, psychologischer, soziokultureller und gesellschaftlicher Ebene.
- Wandel von Schönheitsidealen und deren Einfluss auf Körperbild und Selbstwertgefühl
- Historische und aktuelle Erscheinungsformen von Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Disorder)
- Ursachen von Essstörungen: biologische, psychologische, soziokulturelle und gesellschaftliche Faktoren
- Möglichkeiten der Behandlung und Therapie von Essstörungen
- Prävention von Essstörungen: Risikofaktoren und präventive Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Schönheitsideale und Gesundheitsvorstellungen im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Schönheitsidealen und deren Einfluss auf das Körperbild. Es werden verschiedene Epochen und die damit verbundenen Idealvorstellungen verglichen, von der Rubensfrau bis hin zu Twiggy und den heutigen, oft unrealistischen, von Medien geprägten Bildern. Der Wandel wird im Kontext gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen analysiert, wobei der Fokus auf dem Einfluss dieser Ideale auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen liegt. Die Darstellung historischer Schönheitsideale dient als Grundlage für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Normen und individuellen Körpererfahrungen.
Essstörungen - eine Einführung – körperliche und medizinische Folgen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in verschiedene Essstörungen, darunter Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas und Binge-Eating-Disorder. Es beschreibt die jeweiligen Krankheitsbilder, diagnostische Kriterien und vor allem die schwerwiegenden körperlichen und medizinischen Folgen dieser Erkrankungen. Der detaillierte Überblick über die körperlichen Auswirkungen dient als wichtige Grundlage für die spätere Diskussion von Präventions- und Behandlungsmaßnahmen. Die Darstellung der medizinischen Folgen verdeutlicht die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen.
Mögliche Ursachen bzw. Faktoren von Essstörungen: Dieses Kapitel erörtert die vielschichtigen Ursachen von Essstörungen. Es werden biologisch-genetische Faktoren, psychologische Komponenten wie Störungen im Selbstwertgefühl oder Perfektionismus, sowie soziokulturelle und gesellschaftliche Einflüsse, wie der Druck durch Medien und soziale Normen, analysiert. Die Rolle von sexuellem Missbrauch und familiären Faktoren wird ebenfalls beleuchtet. Die ganzheitliche Betrachtung verschiedener Einflussfaktoren unterstreicht die Komplexität des Problems und zeigt die Notwendigkeit eines multifaktoriellen Ansatzes in der Prävention und Therapie.
Hilfen zur Bewältigung von Essstörungen, ihre Ziele und Erfolge: Das Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze zur Behandlung von Essstörungen. Es werden ambulante Beratungen, Selbsthilfegruppen und somatisch orientierte Behandlungen vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Methoden der Psychotherapie, wie Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie und systemische Familientherapie. Zusätzlich werden körpertherapeutische Ansätze wie Mal-, Musik- und Tanztherapie sowie Entspannungstechniken erläutert. Die Beschreibung der verschiedenen Behandlungsmethoden und deren jeweilige Ziele und Erfolgsaussichten liefert eine umfassende Übersicht über die Möglichkeiten der therapeutischen Intervention.
Prävention von Essstörungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Prävention von Essstörungen. Es definiert den Begriff der Prävention und beleuchtet die Bedeutung der Bestimmung von Risikofaktoren und deren Reduzierungsmöglichkeiten. Es werden Beispiele für konkrete Projekte zur Präventionsarbeit vorgestellt und eigene Überlegungen zu diesem wichtigen Bereich eingebracht. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit von präventiven Maßnahmen, um das Entstehen von Essstörungen zu verhindern und langfristig die Gesundheit zu fördern.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Disorder, Schönheitsideale, Körperbild, Selbstwertgefühl, Prävention, Gesundheitsförderung, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Familientherapie, soziokulturelle Einflüsse, Medien, Risikofaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Schönheitsideale, Essstörungen und Prävention
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Wandel von Schönheitsidealen im Laufe der Zeit und dem Auftreten von Essstörungen. Sie analysiert historische und aktuelle Erscheinungsformen von Essstörungen, deren Ursachen (biologisch, psychologisch, soziokulturell, gesellschaftlich) und beleuchtet Möglichkeiten der Prävention und Therapie.
Welche Essstörungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Essstörungen, darunter Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht), Adipositas (Übergewicht) und Binge-Eating-Disorder (Essattacken). Für jede Störung werden Krankheitsbilder, diagnostische Kriterien und körperliche Folgen beschrieben.
Wie werden Schönheitsideale im Wandel der Zeit dargestellt?
Das Kapitel „Schönheitsideale und Gesundheitsvorstellungen im Wandel der Zeit“ vergleicht verschiedene Epochen und deren Idealvorstellungen (z.B. Rubensfrau, Twiggy) und analysiert den Einfluss dieser Ideale auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen auf das Körperbild.
Welche Ursachen für Essstörungen werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht multifaktorielle Ursachen von Essstörungen. Dies beinhaltet biologisch-genetische Faktoren, psychologische Komponenten (z.B. Selbstwertgefühl, Perfektionismus), soziokulturelle Einflüsse (z.B. Medien, soziale Normen), den Einfluss von sexuellem Missbrauch und familiäre Faktoren.
Welche Behandlungsmethoden werden vorgestellt?
Das Kapitel „Hilfen zur Bewältigung von Essstörungen“ beschreibt verschiedene Behandlungsansätze, darunter ambulante Beratungen, Selbsthilfegruppen, somatisch orientierte Behandlungen und verschiedene Psychotherapiemethoden (Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, systemische Familientherapie). Körpertherapeutische Ansätze (Mal-, Musik-, Tanztherapie) und Entspannungstechniken werden ebenfalls erläutert.
Wie wird Prävention von Essstörungen behandelt?
Der Abschnitt zur Prävention definiert den Begriff und beleuchtet die Bedeutung der Identifizierung von Risikofaktoren und deren Reduzierung. Es werden konkrete Projekte zur Präventionsarbeit vorgestellt (z.B. „BodyTalk“, „Korrekt Kochen!“) und eigene Überlegungen zur Präventionsarbeit eingebracht.
Welche Ziele verfolgt die Diplomarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Schönheitsidealen und Essstörungen zu untersuchen, Präventionsmaßnahmen zu beleuchten und gesundheitsfördernde Aspekte im Kontext dieser Entwicklung zu analysieren. Es soll ein umfassendes Verständnis der Entstehung, Aufrechterhaltung und Behandlung von Essstörungen geschaffen werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Disorder, Schönheitsideale, Körperbild, Selbstwertgefühl, Prävention, Gesundheitsförderung, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Familientherapie, soziokulturelle Einflüsse, Medien, Risikofaktoren.
- Quote paper
- Susann Grösch/Freudenthal (Author), Carolin Licht (Author), 2007, Schönheitsideale im Wandel der Zeit und ihr Zusammenhang mit Essstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126988