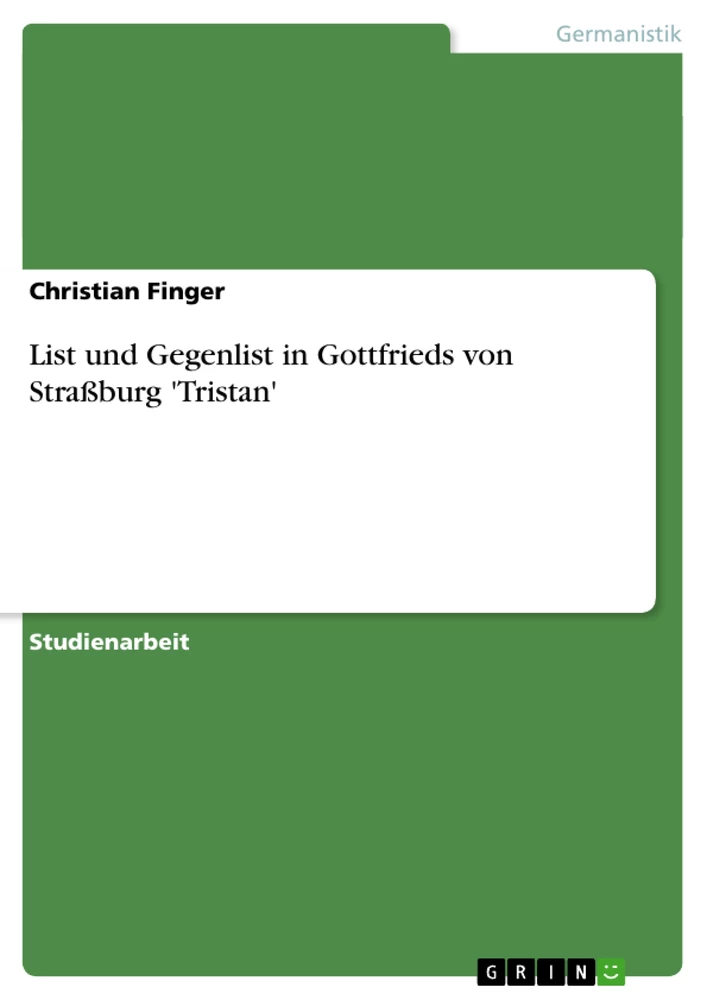Während sich der Großteil der literaturwissenschaftlichen Forschung auf die Themen Liebe-Ästhetik-Gesellschaftskritik beschränkt, gibt es nur wenige Interpretationen zum Listmotiv, obwohl in Gottfrieds Tristanepos über 40 Listen geschildert werden und dieser Text damit eine Ausnahmestellung in der mittelalterlichen bzw. mittelhochdeutschen Literatur einnimmt.
So möchte ich in dieser Arbeit die verschiedenen Listen und List-Motive in Gottfrieds „Tristan“-Text analysieren und mich dabei wegen der Vielzahl der Listen insbesondere mit den drei Listen und Gegenlisten am Hofe Markes auseinandersetzen.
Zuvor ist allerdings eine Klärung des „List“-Begriffes notwendig, da dieser vom mittelhochdeutschen hin zum neuhochdeutschen einem Bedeutungswandel unterzogen war und auch im heutigen (zumindest dem abendländischen) Sprachgebrauch nicht eindeutig konnotiert ist.
Dazu werde ich das Modell von Harro von Senger mit zur Hilfe heranziehen, in dem die List mit dem – im deutschen Sprachraum „neutral“ konnotierten – „Strategem“ verglichen wird.
Abschließendes Ziel meiner Arbeit soll dann der Versuch sein, anhand der exemplarisch ausgesuchten Listen aus dem „Tristan“-Text eine Intention bzw. Beurteilung der angewendeten Listen durch den Autor Gottfried von Straßburg herauszuarbeiten und (so) das Werk (literaturgeschichtlich und ethisch) in die Literatur der mittelhochdeutschen Epik bzw. in seine Zeit um 1200 einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung der „List" im Wandel der Zeit
- Listhandeln vs. Wahrhandeln
- Listhandeln aus „philosophischer“ Sicht
- List als Strategem
- Gottfrieds,,Tristan“ vs. Theologisches „,ordo".
- List und Gegenlist am Hofe Markes
- Markes Listen und Isoldes Gegenlisten
- Die Baumgartenszene
- Der,,Tristan"-Text als Lügengeschichte ?!.
- Mit der Wahrheit lügen
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Listmotiv in Gottfrieds „Tristan“-Text und untersucht insbesondere die Listen und Gegenlisten am Hofe Markes. Ziel ist es, die Intention und Beurteilung der angewendeten Listen durch den Autor Gottfried von Straßburg herauszuarbeiten und das Werk in die Literatur der mittelhochdeutschen Epik um 1200 einzuordnen.
- Bedeutungswandel des „List“-Begriffes im Mittelalter
- Analyse der verschiedenen Listen und List-Motive in Gottfrieds „Tristan“
- Untersuchung der Listen und Gegenlisten am Hofe Markes
- Ethische und literaturgeschichtliche Einordnung des Werkes
- Vergleich von Gottfrieds „Tristan“ mit dem theologischen „ordo“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungslücke zum Listmotiv in Gottfrieds „Tristan“ dar und erläutert die Notwendigkeit einer Klärung des „List“-Begriffes. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und die Vorgehensweise.
Das erste Kapitel beleuchtet den Bedeutungswandel des „List“-Begriffes im Mittelalter. Es werden verschiedene Bedeutungen des Wortes „List“ in der mittelhochdeutschen Zeit und im heutigen Sprachgebrauch vorgestellt. Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Konnotationen des Wortes „List“ und stellt die Bedeutung von „List“ als „zielstrebige, wohlüberlegte, vom Gegenüber nicht erwartete Vorgehensweise“ heraus.
Das zweite Kapitel untersucht die Listen und Gegenlisten am Hofe Markes. Es analysiert die Listen von Markes und die Gegenlisten von Isolde und zeigt, wie diese Listen die Handlung des Epos vorantreiben. Das Kapitel beleuchtet die Baumgartenszene als Beispiel für eine List und Gegenlist und analysiert die Rolle der List im Kontext der Liebe und des Verrats.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Listmotiv, Gottfried von Straßburg, Tristan, mittelhochdeutsche Literatur, Epik, List und Gegenlist, Hofe Markes, Liebe, Verrat, „ordo“, „List“-Begriff, Bedeutungswandel, Täuschung, Strategem, ethische Beurteilung, literaturgeschichtliche Einordnung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Motiv der „List“ im Tristan von Gottfried von Straßburg?
Mit über 40 geschilderten Listen nimmt das Epos eine Ausnahmestellung ein; die List dient den Protagonisten als Werkzeug, um ihre verbotene Liebe im höfischen Umfeld zu schützen.
Wie unterschied sich der Begriff „List“ im Mittelalter von heute?
Im Mittelhochdeutschen war „List“ oft neutraler besetzt und bedeutete Klugheit, Wissen oder handwerkliches Geschick, während es heute meist negativ als Täuschung konnotiert ist.
Was versteht man unter „mit der Wahrheit lügen“?
Es ist eine spezielle Form der List, bei der die Protagonisten (besonders Isolde) Aussagen machen, die faktisch wahr sind, aber vom Gegenüber so missverstanden werden, dass sie die Unwahrheit verschleiern.
Was passiert in der berühmten „Baumgartenszene“?
Tristan und Isolde bemerken den im Baum versteckten König Marke und nutzen eine List (ein inszeniertes Gespräch), um ihn von ihrer Unschuld zu überzeugen.
Wie bewertet Gottfried von Straßburg das Listhandeln ethisch?
Gottfried scheint die List als notwendiges Mittel der „edelen herzen“ gegen eine starre gesellschaftliche Ordnung (ordo) zu rechtfertigen, solange sie der Liebe dient.
- Citar trabajo
- Christian Finger (Autor), 2007, List und Gegenlist in Gottfrieds von Straßburg 'Tristan', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127071