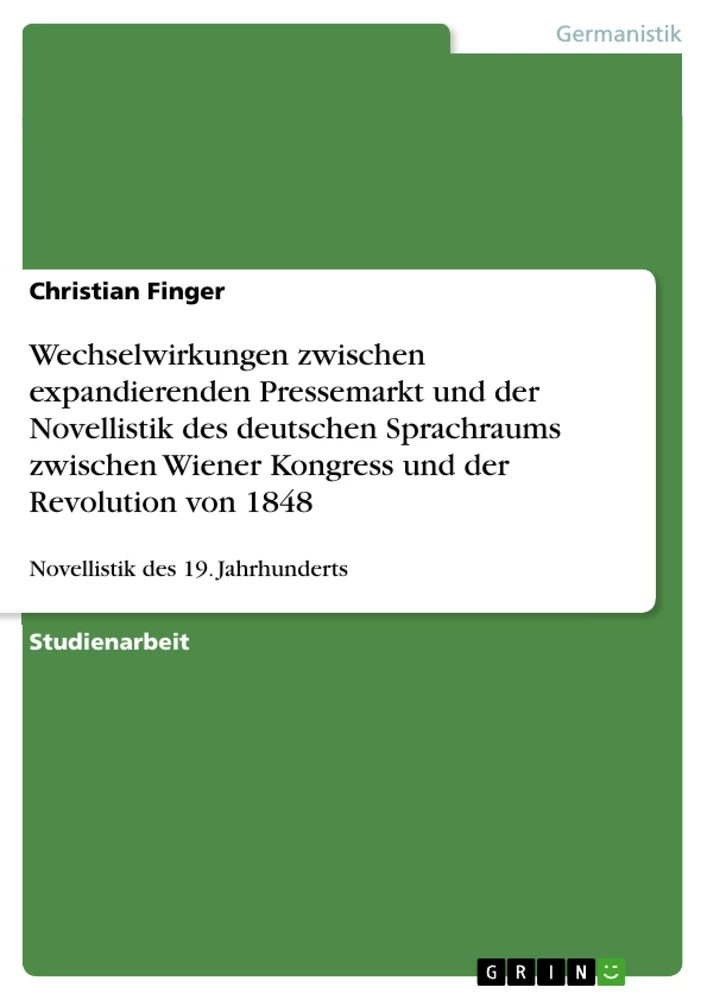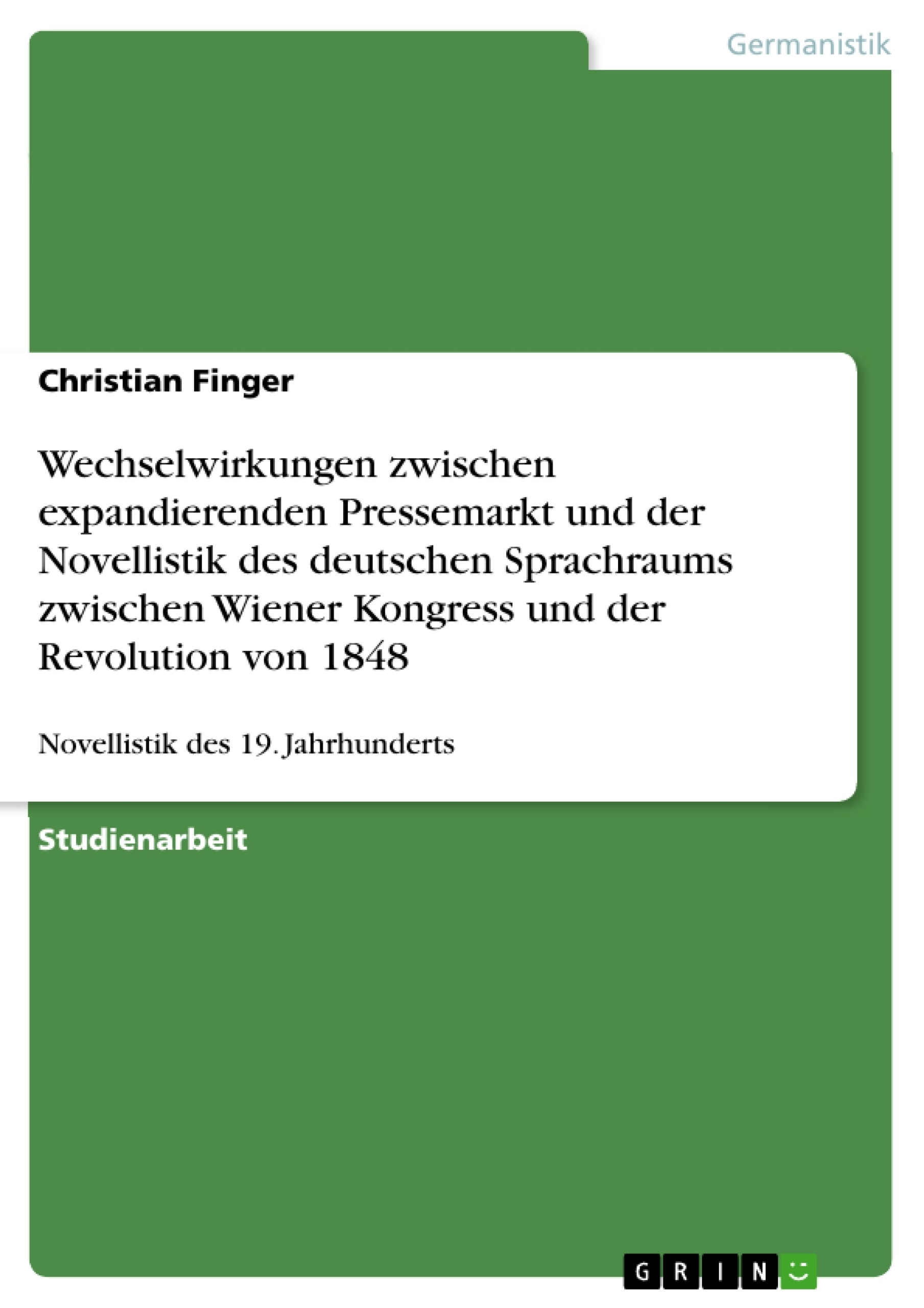In dieser Arbeit sollen die Zusammenhänge zwischen der Expansion des Pressemarktes und der sprunghaft anwachsenden Nachfrage nach Lesestoff in Novellenform aufgezeigt werden. Dabei soll eine literaturwissenschaftliche Methode Anwendung finden, die Literatur im Feld mentaler, sozialer und kultureller Kontexte untersucht. Mit diesem Ansatz, der sich u.a. auf Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur stützt, soll vermieden werden, dass „Literaturgeschichte [...] als Anhäufung isolierter, autonomer Einzelwerke oder Dichterfiguren“ behandelt wird. Allerdings soll Literatur hier auch nicht als ein „bloßer Reflex auf ökonomische Umstände“ verstanden werden.
Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Fallbeispiele können veranschaulichen, wie die Beschaffenheit der Journale Einfluss nahm sowohl auf die Form der Novellen als auch auf Arbeitsweise und Selbstverständnis der Textproduzenten. Im Hintergrund dieser Explikationen stehen sowohl theoretische Arbeiten Pierre Bourdieus mit dem darin enthaltenen Grundgedanken des Literaturfeldes , in dem die Bereiche Autor und Verleger als in einem gemeinsamen Feld agierend und sich gegenseitig beeinflussend gedacht werden, als auch Niklas Luhmanns Systemtheorie, in welcher neben anderen Gesellschaftssystemen auch das insbesondere von Niels Werber herausgearbeitete System Literatur untersucht wird. Die von Bourdieu und Luhmann entwickelten Theorien brechen mit der Überzeugung von einer Hochliteratur, deren angebliche autonome Beschaffenheit ausschließlich text- und biografiebezogene Exegesen rechtfertigen sollen, und machen u. a. auf weitere Faktoren wie die Einflussmechanismen des Marktes auf den Literaturproduzenten und sein Produkt aufmerksam.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Lesewut oder das explosionsartige Wachstum des Pressemarktes im 19. Jahrhundert
- 1.1. Voraussetzungen für die steigende Nachfrage nach Lesestoffen
- 1.2. Die Kapitalisierung des Buchmarktes
- 1.3. Die Macht der Zensur im Kampf mit Geist und Kapital
- II. Novellenwut oder die Hochphase der deutschsprachigen Novellistik im 19. Jahrhundert
- 2.1. Begriffsbestimmung und Anfänge der Novelle
- 2.2 Hochphasen der Novelle und wechselnde Autorengenerationen
- 2.3 „Autoreninflation“ und „fabrikmäßige Literatur“ in der Novellistik des 19. Jahrhunderts
- III. Die Wechselwirkungen zwischen Journalpresse und Novellenproduktion
- 3.1. Literaten werden zu Journalautoren
- 3.2. Die veränderte (soziale) Situation von Autoren um 1830: Der Berufs-Schriftsteller als Literatur-Lieferant
- 3.3. Der Einfluss der Journal-Strukturen auf die novellistische Erzählprosa
- IV. Exkurs: Die integrative Funktion des Erzählrahmens als Zweitverwertungsstrategie in deutschsprachigen Novellensammlungen des 19. Jahrhunderts
- V. Ausblick und Schlussbemerkung
- 5.1 Die weitere Entwicklung von Buchmarkt, Novellistik und Journalistik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- 5.2 Die Novelle verschwindet wie ein fliehendes Pferd / Die Presse wird zum Leitmedium des 20. Jahrhunderts
- 5.3 Schlussbemerkung: Schwierigkeiten der Literaturwissenschaft mit dem kapitalisierten Literatur-Markt
- - Literaturverzeichnis -
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen dem expandierenden Pressemarkt und der Novellistik des deutschen Sprachraums zwischen Wiener Kongress und der Revolution von 1848. Sie analysiert die Ursachen für das explosionsartige Wachstum des Pressemarktes und die damit einhergehende Hochphase der deutschsprachigen Novellistik. Dabei werden die spezifischen Anpassungs- und Wandlungsstrategien von Novellenproduzenten im Kontext der veränderten sozialen Situation von Autoren um 1830 beleuchtet.
- Die Expansion des Pressemarktes im 19. Jahrhundert
- Die Hochphase der deutschsprachigen Novellistik im 19. Jahrhundert
- Die Wechselwirkungen zwischen Journalpresse und Novellenproduktion
- Die integrative Funktion des Erzählrahmens in Novellensammlungen
- Der Einfluss des kapitalisierten Literaturmarktes auf Literaturproduktion und -verständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Relevanz der deutschsprachigen Novellistik im 19. Jahrhundert und den zeitgleichen Aufstieg des Pressemarktes dar. Sie skizziert die Forschungsmethodik und die theoretischen Grundlagen der Arbeit, die sich auf die Sozialgeschichte der Literatur und die Theorien von Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann stützt.
Kapitel I beleuchtet die Faktoren, die die Expansion und Kapitalisierung des Pressemarktes im 19. Jahrhundert ausgelöst haben. Dazu gehören technische Innovationen wie neue Druckverfahren und die Erfindung der Eisenbahn, die beschleunigte Mobilität und die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung.
Kapitel II gibt einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der deutschsprachigen Novelle. Es werden die Hochphasen der Novelle und die wechselnden Autorengenerationen des 19. Jahrhunderts beleuchtet.
Kapitel III analysiert die Wechselwirkungen zwischen Journalpublizistik und Literaturproduktion. Es werden die veränderte soziale Situation von Autoren um 1830 und der Einfluss der Journal-Strukturen auf die novellistische Erzählprosa untersucht.
Kapitel IV widmet sich dem literarischen Phänomen der gerahmten Novellensammlung. Es wird die integrative Funktion des Erzählrahmens als Zweitverwertungsstrategie für Novellen, die zuvor in Journalen veröffentlicht wurden, erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Pressemarkt, die Novellistik, die Journalpublizistik, die Literaturproduktion, die soziale Situation von Autoren, die Kapitalisierung des Literaturmarktes, die integrative Funktion des Erzählrahmens und die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur im 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zur Novellistik und dem Pressemarkt im 19. Jh.
Warum boomte die Novelle im 19. Jahrhundert so stark?
Der explosionsartig wachsende Pressemarkt und die steigende Alphabetisierung schufen eine enorme Nachfrage nach kurzem, unterhaltsamem Lesestoff, den die Novelle ideal bediente.
Wie beeinflussten Journale die Form der Novellen?
Die Strukturen der Journale (z.B. Platzvorgaben, Fortsetzungsdruck) nahmen direkten Einfluss auf die Erzählweise, die Länge und die Arbeitsweise der Autoren.
Was versteht man unter der "integrativen Funktion des Erzählrahmens"?
Der Erzählrahmen diente oft als Strategie zur Zweitverwertung: Einzelne Novellen, die zuvor in Journalen erschienen waren, wurden durch eine Rahmenerzählung zu einer Buchsammlung zusammengefasst.
Welchen Einfluss hatte die Zensur auf den Buchmarkt?
Die Zensur stand in einem ständigen Kampf mit dem Geist der Aufklärung und dem Kapitalismus des Marktes, was Autoren oft zu vorsichtigen oder verschlüsselten Erzählweisen zwang.
Was änderte sich für die Autoren um 1830?
Es entstand der Typus des Berufs-Schriftstellers, der als "Literatur-Lieferant" für den kapitalisierten Markt fungierte, was das Selbstverständnis vom autonomen Dichter radikal veränderte.
- Arbeit zitieren
- Christian Finger (Autor:in), 2008, Wechselwirkungen zwischen expandierenden Pressemarkt und der Novellistik des deutschen Sprachraums zwischen Wiener Kongress und der Revolution von 1848, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127080