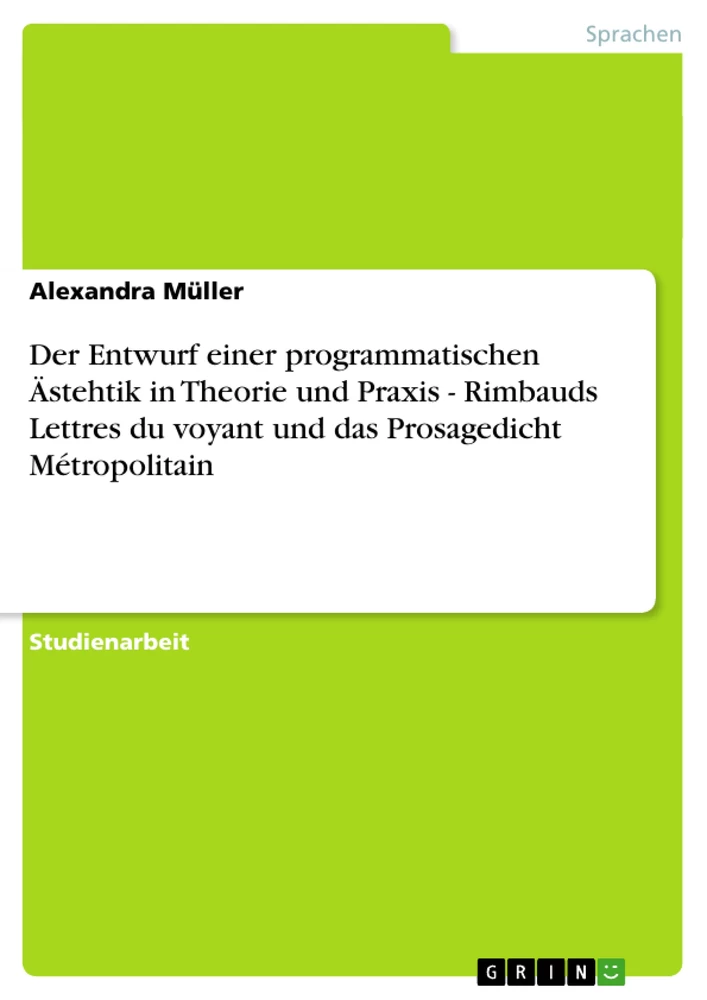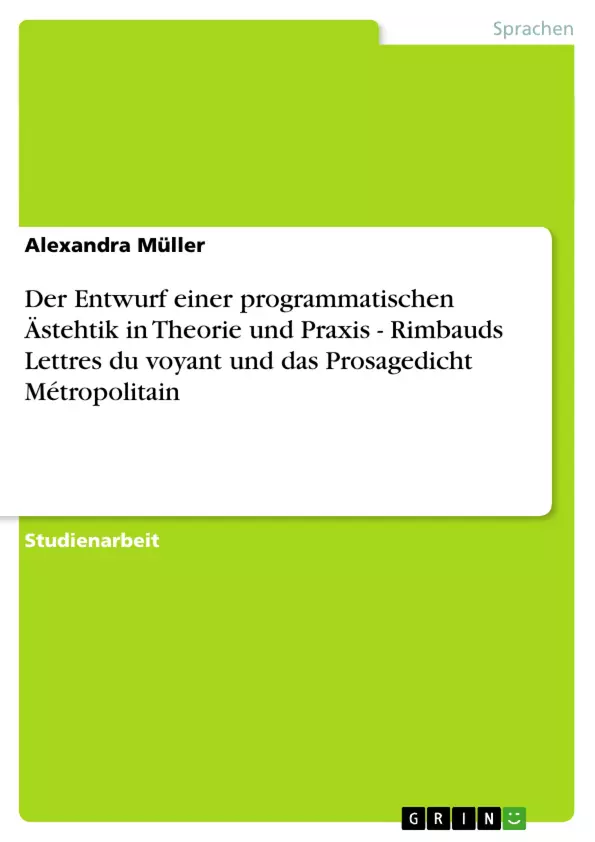"Trouver une langue" – das rimbaudsche Postulat steht paradigmatisch für die
Schwierigkeit, einen geeigneten Beschreibungsmodus für Texte zu finden, die mit
der mimetischen Bestimmung von Literatur brechen.
Die Notwendigkeit, neue Kategorien für die Beschreibung moderner Lyrik zu finden,
wurde bereits 1956 von Hugo Friedrich erkannt.1 Doch mündete diese Erkenntnis bei
Friedrich in die Beschreibung moderner Lyrik durch negative Kategorien wie
"Abnormität" oder "Zerstörungswut", die zwar die Texte eines Rimbaud von
traditioneller europäischer Versdichtung absetzen, aber nicht zu ihrem tieferen
Verständnis beitragen.
Die Interpretationen beziehungsweise Textbeschreibungen von Stierle2 (1966) und
Kloepfer/Oomen3 (1970) weisen dahingegen in eine andere Richtung: durch die
systematische Untersuchung semantischer und phonologischer Textkonstituenten
zeigen sie auf, daß das scheinbare Chaos und die vielbeschworene Sprachzerstörung
in den Illuminations nicht Zweck, sondern Mittel zur Schaffung einer neuen
Kohärenz ist, die die Funktion des referentiellen Zusammenhangs übernimmt.
Im Rahmen der Seminararbeit soll durch eine exemplarische Analyse der
Vertextungsverfahren des Prosagedichts Métropolitain einer kohärenzbildenden
Struktur hinter der Fremdheit der sprachlichen Zeichen nachgegangen werden.
Gleichzeitig soll den oben genannten negativen Kategorien der sprach- und
weltschöpferische Impuls, dem die Zerstörungsarbeit vorausläuft, entgegengesetzt
werden.
Vor dem Hintergrund eines Bruchs mit den zeitgenössischen Regel- und
Normsystemen illustrieren die Lettres du voyant den radikalen ästhetischen Anspruch
des jungen Rimbaud an zukünftige Dichtung.5 [...]
1 Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 1956.
2 K.-H. Stierle, „Möglichkeiten des dunklen Stils in den Anfängen moderner Lyrik in Frankreich“,
in: W. Iser (Hg.), Immanente Ästhetik – ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne,
München 1966, S. 157-194.
3 Kloepfer/Oomen, Sprachliche Konstituenten moderner Dichtung, Bad Homburg 1970 gelingt es
durch minutiöse Textbeschreibungen nach linguistischen Kriterien, klare sprachliche Strukturen
herauszuarbeiten.
5 Rimbaud setzte sich intensiv mit den zeitgenössischen literarischen Systemen wie dem Parnasse
und der Romantik auseinander und fand über die Imitation , an dieser Stelle sei lediglich das Hugo-Patiche Le Forgeron genannt, zu einem genuinen Ausdruck.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Voyant-Briefe
- Poiesis oder handlungsbezogene Dichtung
- Le poète-voyant
- Trouver une langue
- Analyse des Prosagedichts Métropolitain
- Thematischer Impuls und Titelgebung
- Vertextungsverfahren in Métropolitain
- "Déconstruction et reconstruction" - die zwei Pole des "poème-illumination"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der programmatischen Ästhetik Arthur Rimbauds, die in seinen Lettres du voyant zum Ausdruck kommt. Durch eine exemplarische Analyse des Prosagedichts Métropolitain soll die kohärenzbildende Struktur hinter der scheinbaren Sprachfremdheit aufgezeigt werden. Die Arbeit widerspricht den negativen Kategorien der "Abnormität" und "Zerstörungswut", die in der traditionellen Literaturwissenschaft zur Beschreibung von Rimbauds Werk verwendet werden.
- Die programmatische Ästhetik Arthur Rimbauds in den Lettres du voyant
- Die Analyse des Prosagedichts Métropolitain und die Herausarbeitung einer kohärenzbildenden Struktur
- Die Überwindung negativer Kategorien in der Beschreibung von Rimbauds Werk
- Die Bedeutung des "Trouver une langue" für die moderne Lyrik
- Die Verbindung zwischen Poiesis und handlungsbezogener Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Problematik der Beschreibung moderner Lyrik ein. Es wird die Notwendigkeit neuer Kategorien für die Analyse von Texten hervorgehoben, die mit der mimetischen Bestimmung von Literatur brechen.
Das Kapitel "Die Voyant-Briefe" befasst sich mit Rimbauds einzigartigem programmatischem Text in Form von zwei Briefen, die im Abstand von nur zwei Tagen geschrieben wurden. Der Fokus liegt auf dem zweiten Brief, der die zentralen ästhetischen Ideen Rimbauds ausführt, und zeigt, wie Rimbaud die Dichtung als integrativen Bestandteil des Lebens versteht.
Das Kapitel "Analyse des Prosagedichts Métropolitain" untersucht die thematischen Impulse und die Vertextungsverfahren des Gedichts. Es wird die "Déconstruction et reconstruction" - also die Zerlegung und Wiederaufbau - als zentrale Strategie der "poème-illumination" beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arthur Rimbaud, Lettres du voyant, Métropolitain, Prosagedicht, programmatische Ästhetik, "Trouver une langue", Poiesis, handlungsbezogene Dichtung, "Déconstruction et reconstruction", "poème-illumination"
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Rimbauds „Lettres du voyant“?
Rimbaud fordert darin eine neue dichterische Sprache („Trouver une langue“) und definiert den Dichter als „Seher“, der über traditionelle Formen hinausgeht.
Wie analysiert die Arbeit das Prosagedicht „Métropolitain“?
Es wird untersucht, wie durch das Verfahren der „Déconstruction et reconstruction“ eine neue Kohärenz hinter der scheinbaren Sprachzerstörung entsteht.
Warum lehnt die Arbeit Begriffe wie „Abnormität“ ab?
Anstatt Rimbauds Werk als bloße Zerstörung zu sehen, begreift die Arbeit seine Ästhetik als weltschöpferischen Impuls und Mittel zur Schaffung neuer Strukturen.
Was bedeutet „Poiesis“ im Kontext von Rimbaud?
Es beschreibt eine handlungsbezogene Dichtung, die nicht nur abbildet, sondern als integrativer Bestandteil des Lebens neue Realitäten schafft.
Welche Rolle spielt die mimetische Bestimmung der Literatur?
Rimbaud bricht mit der Mimesis (Nachahmung der Wirklichkeit), was die Literaturwissenschaft vor die Herausforderung stellt, neue Beschreibungsmodi zu finden.
- Quote paper
- Alexandra Müller (Author), 1998, Der Entwurf einer programmatischen Ästehtik in Theorie und Praxis - Rimbauds Lettres du voyant und das Prosagedicht Métropolitain, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12713