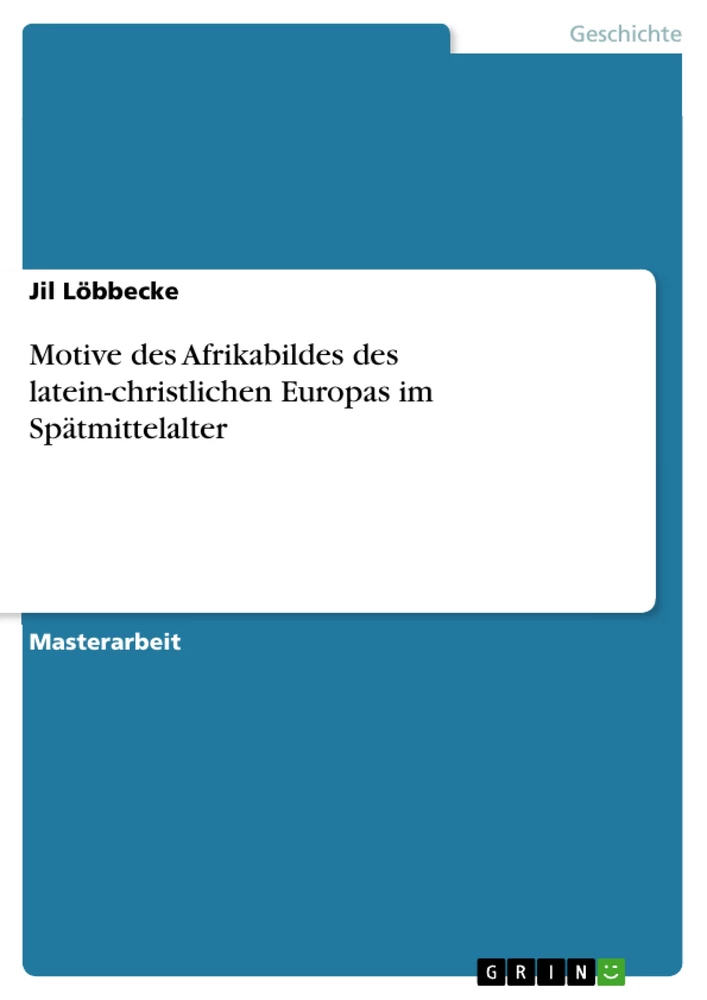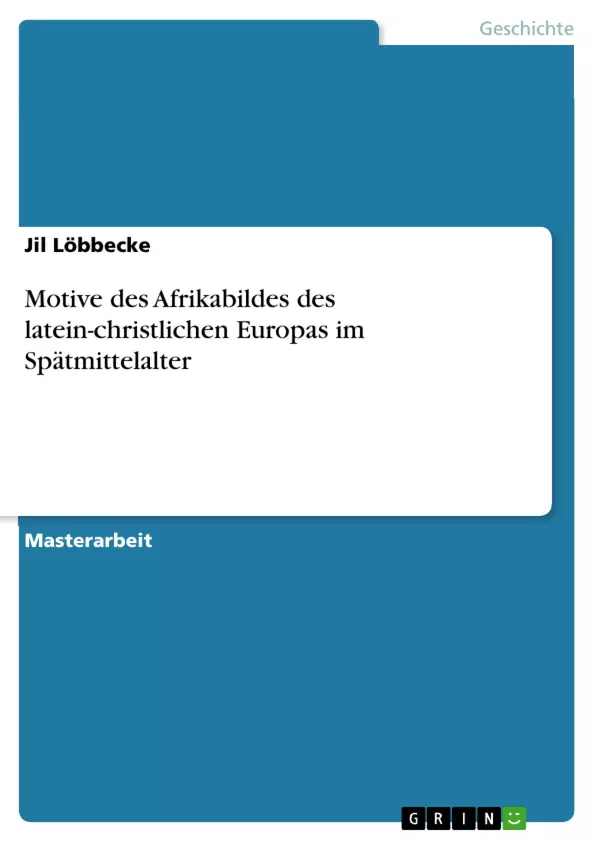Die Forschungsfrage in dieser Arbeit lässt sich wie folgt formulieren: Welche Motive tauchen in der Darstellung Afrikas in den latein-christlichen Quellen Europas im Spätmittelalter auf? Und werden Motive, die sich nachweisen lassen, stringent das Spätmittelalter hindurch verwendet? Es können im Rahmen dieser Masterarbeit nicht alle Motive aufgezeigt und anhand des Quellenmaterials untersucht werden. Im Vordergrund sollen daher jene stehen, die am präsentesten sind; weniger prominente Motive werden an gegebener Stelle kurz angeführt, aber nicht ausführlich behandelt.
Für die Untersuchung müssen zunächst grundlegende Begriffe definiert werden, auch wenn sie vielleicht zunächst eindeutig erscheinen mögen. Der Europabegriff, der in der folgenden Arbeit verwendet wird, ist nicht analog zu dem uns heute bekannten Europa zu verstehen. Gemeint ist vielmehr das Kollektiv der Latein-Christen im Raum des heutigen Europas. Dieses Kollektiv ist zwar in verschiedene Reiche und Herrschaftsgebiete unterteilt, kann jedoch aufgrund der religiösen Homogenität, des ständigen Austausches und der Verbundenheit mit Rom als ein Kulturraum verstanden werden. Von dieser Annahme geht ein gewisser Verlust der Differenzierung aus, der jedoch im Rahmen der Möglichkeiten dieser Arbeit in Kauf genommen werden muss.
Auch wenn immer wieder sowohl in den Quellen als auch in der Literatur von Afrika die Rede ist, liegt der Fokus der Untersuchung vor allem auf dem Nord-Osten Afrikas. Dies ist vor allem den ausgewählten Quellen geschuldet, da diese primär den Norden und den Osten Afrikas thematisieren, obgleich nicht immer eindeutig ist, welcher Teil in den Quellen beschrieben wird, da die Namen der Regionen sehr divergent genutzt werden. Vor allem in Berichten von Autoren, die bekanntlich die Gegenden, von denen sie berichten, nie bereist haben, ist die Darstellung teilweise konfus und es kommt auch zu einer Vermischung von Elementen verschiedener Regionen. Es könnte argumentiert werden, dass offensichtlich fingierte Berichte aus dem Quellenkorpus gestrichen werden sollten, doch gerade solche Berichte spiegeln die Vorstellungen latein-christlicher Europäer in hohem Maße wider: Sie basieren nicht auf real gemachten Erfahrungen, sondern auf dem vorherrschenden Afrikabild und auf anderen Berichten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Methodisches Vorgehen
- Methodik
- Quellenkorpus
- Geschichte der Beziehung zwischen Afrika und Europa
- Antike
- Früh- und Hochmittelalter
- Nach den Kreuzzügen
- Weltbilder im Spätmittelalter
- Entstehung eines Weltbildes
- Das Afrikabild im Spätmittelalter
- Vorstellungen und Wissen der latein-christlichen Europäer über Afrika im
Spätmittelalter
- Geographische Vorstellungen
- Aethiopia und Nubien
- Der Nil
- Die Mondberge
- Das Klima
- Adaption antiker Motive
- Wundervölker und ‚Fabelrassen‘
- Wundersame Tiere
- Region der Antipoden
- Biblische Elemente in der Rezeption Afrikas
- Trias der Erdteilung an die Söhne Noahs
- Suche nach dem irdischen Paradies: hortus delicarum
- Die Heiligen Drei Könige
- Ethnologische Motive
- Die dunkle Hautfarbe
- Eingebranntes Kreuz auf der Stirn
- Grad der Zivilisierung der Fremden
- Der Mythos des Priesterkönigs Johannes
- Geographische Vorstellungen
- Fazit
- Ausblick
- Quellenkorpus – Tabellarische Übersicht
- Abbildungsverzeichnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung Afrikas in spätmittelalterlichen Quellen des latein-christlichen Europas. Sie befasst sich mit der Frage, welche Motive in diesen Darstellungen auftauchen und wie sie sich im Laufe des Spätmittelalters möglicherweise durchsetzten oder veränderten.
- Die verschiedenen geographischen Vorstellungen über Afrika, insbesondere die Verortung von Äthiopien und Nubien, die Beschreibung des Nils und die Vorstellung von der Hitze des Kontinents
- Die Adaption antiker Motive, wie die Darstellung von Wundervölkern und Fabelwesen, die Beschreibung wundersamer Tiere und die Vorstellung von der Region der Antipoden
- Die Integration biblischer Elemente in das Afrikabild, wie die Aufteilung der Welt an die Söhne Noahs, die Suche nach dem irdischen Paradies und die afrikanisierte Erzählung der Heiligen Drei Könige
- Ethnologische Aspekte wie die Wahrnehmung der Hautfarbe, die Vorstellung vom eingebrannten Kreuz auf der Stirn und die Einschätzung des Zivilisierungsgrads der afrikanischen Völker
- Die Bedeutung des Mythos vom Priesterkönig Johannes für die Vorstellung von Afrika im Spätmittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit der Einführung der Forschungsfrage, der Methodik und dem Quellenkorpus. Anschließend werden die historischen Beziehungen zwischen Afrika und Europa beleuchtet, beginnend mit der Antike und abschließend mit dem Einfluss der Kreuzzüge im Spätmittelalter. In einem weiteren Kapitel werden die Informationskanäle der latein-christlichen Europäer, aus denen sie Wissen über Afrika erhielten, vorgestellt. Es wird erläutert, wie die Menschen im Spätmittelalter ein Weltbild von Afrika entwickelten und welche Rolle geographische Vorstellungen dabei spielten. Im Fokus stehen dabei die Regionen Äthiopien und Nubien, der Nil und die klimatischen Bedingungen.
Die Analyse der Quellenbeispiele erfolgt in Kapitel 5. Dabei wird eine sachlogische Unterteilung nach Motiven vorgenommen. Es werden geographische Vorstellungen, antike Elemente, biblische Elemente, ethnologische Vorstellungen und der Mythos des Priesterkönigs Johannes betrachtet.
Abschließend wird im Fazit eine zusammenfassende und vergleichende Darstellung der Quellen gegeben, um mögliche repräsentative Motive des Afrikabildes des latein-christlichen Europas im Spätmittelalter zu skizzieren. Im Anschluss wird ein kurzer Ausblick auf noch nicht beantwortete Fragen gegeben, die in einer ausführlicheren Bearbeitung dieser Thematik aufgegriffen werden könnten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Afrika, latein-christliches Europa, Spätmittelalter, Afrikabild, Imagologie, Geographie, Ethnologie, Bibel, Priesterkönig Johannes, Wundervölker, Fabelwesen, Wundersame Tiere, Antipoden, Zivilisation, Hautfarbe, Kargheit, Hitze, Paradies, Noachidensystem, Reiseberichte, Weltkarten, Enzyklopädien, Schrift, Bild, Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte.
- Citation du texte
- Jil Löbbecke (Auteur), 2020, Motive des Afrikabildes des latein-christlichen Europas im Spätmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1271521