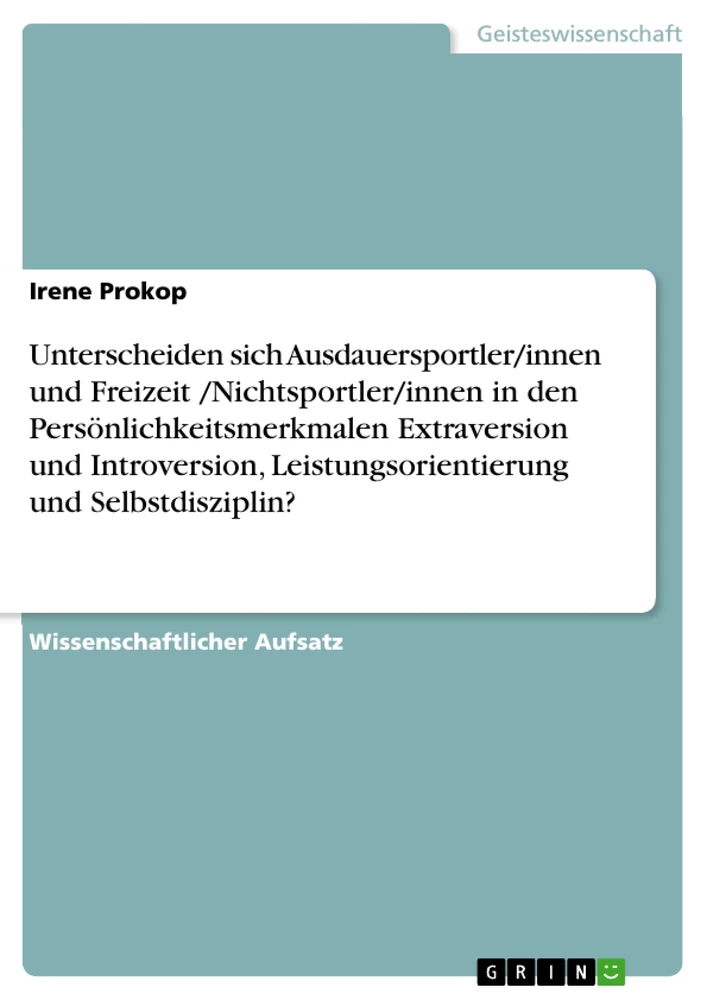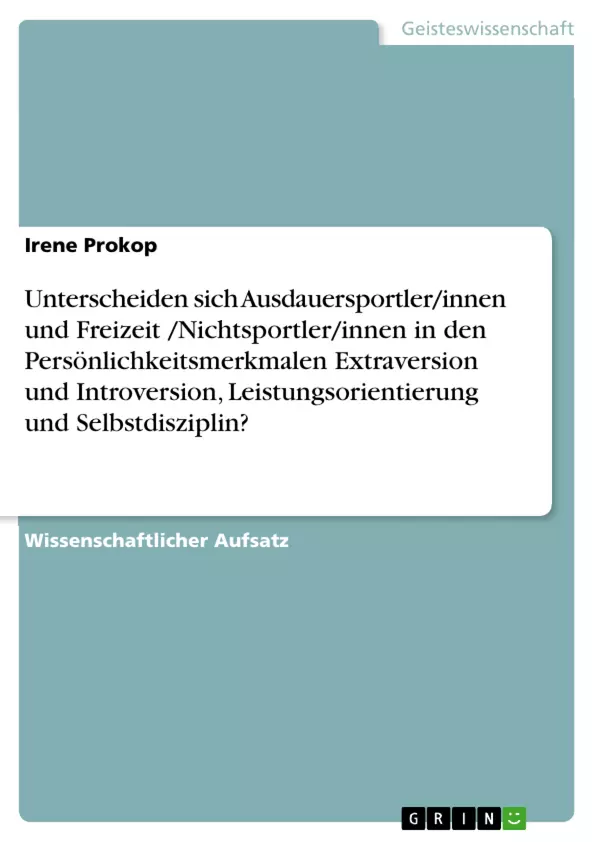Das Allgemeine Lineare Modell und seine Anwendung in der entwicklungspsychologischen Forschung:
Theorie: Die Theorie meint, dass es einen signifikanten Unterschied hinsichtlich den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion und Introversion gibt. (Bierhoff-Alfermann, 1986)
Fragestellung: Gibt es signifikante Unterschiede zwischen Freizeitsportler/innen und Nichtsportler/innen in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion und Introversion ?
Methode: Das Allgemeine Lineare Modell
Ergebnisse: Ja, es gibt signifikante Unterschiede zwischen Freizeitsportlern/innen und Nichtsportler/innen hinsichtlich Extraversion und Introversion.
Literaturverzeichnis:
Bierhoff-Alfermann, D. (1986). Sportpsychologie. Stuttgart; Berlin; Mainz: Kohlhammer
Kaminski, G., & Ruoff, B.A.(1979). Auswirkungen des Hochleistungssports bei Jugendlichen
und Erwachsenen. Sportwissenschaft, 9, 200-217
Morgan, L. (1980). Sport and Personality. London: Britch & Hodson
Pirkner, P. (1989). Intelligenz und Persönlichkeitstheorien II. WUV/Universitätsverlag/Skriptum
zur Vorlesung von Universitäts-Professor Dr. G. Fischer
Vanek, Hosek, Rychtecky & Slepicka.(1980). Sportpschyologie; Prag: Hatschek
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Trait-Ansatz
- 2.2. Sportpsychologie
- 2.3. Selektions- und Sozialisationshypothese
- 2.4. Sport und Persönlichkeit
- 2.5 Sport und Persönlichkeit: Zwei gegenläufige Positionen
- 2.6 Persönlichkeit
- 2.7 Persönlichkeitseigenschaften
- 2.7.1 Kritik an Persönlichkeitseigenschaften
- 2.8 Welche Beziehung besteht zwischen Persönlichkeit und Sport?
- 2.8.1 Einfluß sportlicher Betätigung auf die Persönlichkeit
- 2.9.Unterschiede zwischen Sportlern und Nichtsportlern
- 3. Fragestellung
- 3.1. Hypothesen
- 4. Material und Methoden
- 4.1. Testpersonen
- 4.2. Materialien und Bedingungen
- 4.3. Versuchsplan (operationale Hypothesen)
- 5. Statistische Auswertung
- 5.1. Statistische Hypothesen
- 5.2 Statistische Methoden
- 6. Ergebnisse: Prüfungen und Voraussetzungen
- 6.1 Prüfungen und Vorraussetzungen
- 6.2. Tabellen
- 7. Interpretationen
- 8. Diskussion und Kritik
- 9. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, ob signifikante Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion/Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin zwischen Ausdauersportlern und Freizeit-/Nichtsportlern bestehen. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Theorien der Sportpsychologie und Persönlichkeitspsychologie.
- Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen zwischen Sportlergruppen
- Anwendung des Trait-Ansatzes in der Sportpsychologie
- Selektions- und Sozialisationshypothese im Kontext von Sport und Persönlichkeit
- Statistische Analyse von Persönlichkeitsdaten
- Interpretation und kritische Diskussion der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thema: Die Arbeit untersucht Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion/Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin zwischen Leistungssportlern und Freizeit-/Nichtsportlern. Es handelt sich um eine empirische Untersuchung im Rahmen einer Lehrveranstaltung.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt den Trait-Ansatz der Persönlichkeitspsychologie und vergleicht ihn mit situationalen und interaktionistischen Ansätzen. Der Trait-Ansatz betont die Bedeutung stabiler Persönlichkeitseigenschaften. Das Kapitel beleuchtet die Sportpsychologie als empirische Wissenschaft, die das Verhalten und Erleben im Sport untersucht. Die Selektions- und Sozialisationshypothese werden eingeführt, welche die Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und Sportlicher Aktivität erörtern. Die Sozialisationshypothese postuliert, dass die Sportliche Aktivität die Persönlichkeit beeinflusst, während die Selektionshypothese annimmt, dass Persönlichkeitsmerkmale die Wahl der Sportart beeinflussen. Das Kapitel erörtert auch kritische Aspekte der Persönlichkeitsmessung.
3. Fragestellung: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: Gibt es Unterschiede zwischen Leistungssportlern und Freizeit-/Nichtsportlern in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion/Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin? Es werden dazugehörige Hypothesen aufgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit empirisch überprüft werden.
4. Material und Methoden: Hier wird die Methodik der Studie detailliert beschrieben. Es werden die Auswahl der Testpersonen, die verwendeten Messinstrumente, sowie der Versuchsplan erläutert, einschließlich der operationalisierten Hypothesen.
5. Statistische Auswertung: In diesem Kapitel werden die statistischen Hypothesen und die angewendeten statistischen Methoden vorgestellt. Der Fokus liegt auf den Verfahren zur Datenanalyse und der Prüfung von Voraussetzungen.
6. Ergebnisse: Prüfungen und Voraussetzungen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen. Es umfasst die Prüfung der methodischen Voraussetzungen sowie die Darstellung der Ergebnisse in Tabellen.
7. Interpretationen: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse im Kontext der Forschungsfrage und der theoretischen Grundlagen.
8. Diskussion und Kritik: Hier werden die Ergebnisse kritisch diskutiert und im Lichte der bestehenden Literatur eingeordnet. Mögliche Limitationen der Studie werden angesprochen und Anregungen für zukünftige Forschung gegeben.
Schlüsselwörter
Ausdauersport, Freizeit-/Nichtsportler, Persönlichkeit, Extraversion, Introversion, Leistungsorientierung, Selbstdisziplin, Trait-Ansatz, Sportpsychologie, Selektionshypothese, Sozialisationshypothese, empirische Untersuchung, statistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Persönlichkeit und Ausdauersport
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und der Ausübung von Ausdauersport. Konkret werden Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion/Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin zwischen Ausdauersportlern und Freizeit-/Nichtsportlern untersucht. Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Sportpsychologie und Persönlichkeitspsychologie, insbesondere den Trait-Ansatz, die Selektions- und Sozialisationshypothese.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet den Trait-Ansatz der Persönlichkeitspsychologie als theoretische Grundlage. Dieser Ansatz betont die Bedeutung stabiler Persönlichkeitseigenschaften. Zusätzlich werden die Sportpsychologie, die Selektions- und Sozialisationshypothese im Kontext von Sport und Persönlichkeit erläutert. Die Selektionshypothese besagt, dass Persönlichkeitsmerkmale die Wahl der Sportart beeinflussen, während die Sozialisationshypothese postuliert, dass Sport die Persönlichkeit beeinflusst. Kritische Aspekte der Persönlichkeitsmessung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Gibt es signifikante Unterschiede in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion/Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin zwischen Ausdauersportlern und Freizeit-/Nichtsportlern?
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Dies beinhaltet die Auswahl der Testpersonen, die verwendeten Messinstrumente und den Versuchsplan. Die operationalisierten Hypothesen werden ebenfalls erläutert.
Wie wurden die Daten statistisch ausgewertet?
Das Kapitel zur statistischen Auswertung beschreibt die statistischen Hypothesen und die angewendeten statistischen Methoden. Es werden die Verfahren zur Datenanalyse und die Prüfung der methodischen Voraussetzungen detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der statistischen Analysen werden präsentiert, einschließlich der Prüfung der methodischen Voraussetzungen. Die Ergebnisse werden in Tabellen dargestellt.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die Ergebnisse werden im Kontext der Forschungsfrage und der theoretischen Grundlagen interpretiert. Eine kritische Diskussion der Ergebnisse, mögliche Limitationen der Studie und Anregungen für zukünftige Forschung werden ebenfalls gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ausdauersport, Freizeit-/Nichtsportler, Persönlichkeit, Extraversion, Introversion, Leistungsorientierung, Selbstdisziplin, Trait-Ansatz, Sportpsychologie, Selektionshypothese, Sozialisationshypothese, empirische Untersuchung, statistische Analyse.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte prägnant beschreibt.
Für wen ist diese Seminararbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich für den Zusammenhang zwischen Sport und Persönlichkeit interessiert. Sie eignet sich besonders für Studierende der Sportwissenschaft, Psychologie und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Mag. a .rer. nat. Irene Prokop (Author), 1999, Unterscheiden sich Ausdauersportler/innen und Freizeit /Nichtsportler/innen in den Persönlichkeitsmerkmalen Extraversion und Introversion, Leistungsorientierung und Selbstdisziplin?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127177