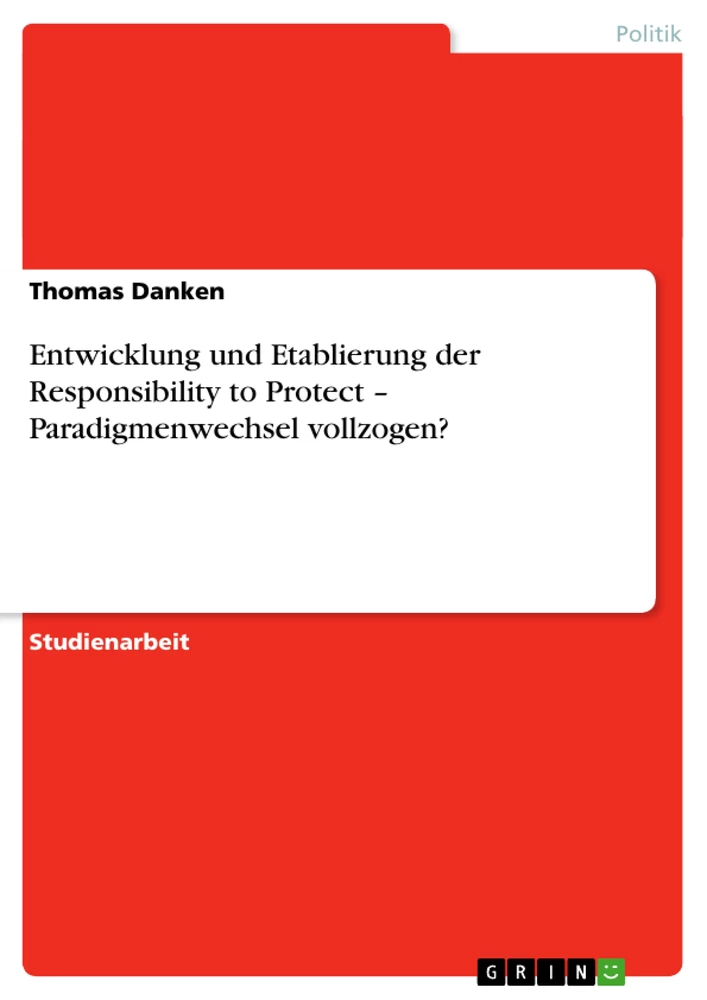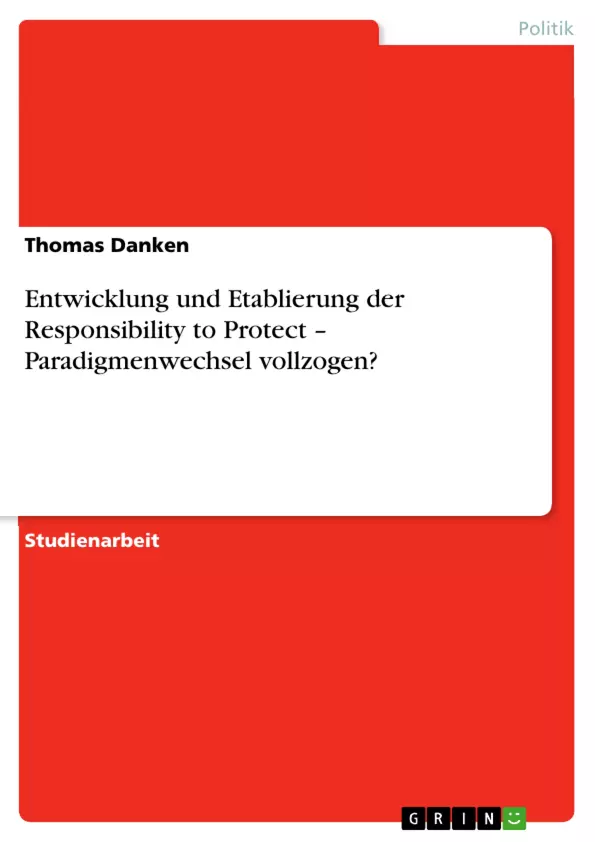Seit dem westfälischen Frieden war das Konzept der Souveränität und die Maxime der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten die vorherrschende Norm innerhalb der Internationalen Beziehungen. Mit der seit 1945 zunehmenden Bedeutung, Forderung und Anerkennung der Menschenrechte, die Jedem nur durch sein Mensch-sein zustehen, folgte auch für die Norm der Souveränität ein zunächst latenter Veränderungsdruck. Nach dem Ende der bipolaren Weltordnung zeigten eine Reihe von Krisen und humanitären Katastrophen in den 1990er, dass der normative Anspruch an örtlich ungebundene, universelle Menschenrechte nicht von einer adäquaten politischen Praxis ihrer Umsetzung flankiert wird. Es ergab sich gleichsam ein völkerrechtlicher Wechsel der Perspektive von einer Staatszentriertheit hin zu einer individualistischen Sicht auf die Rechte des Einzelnen bzw. der Bevölkerung. Das Prinzip der Souveränität des Staates als leitende Norm wurde zunächst durch die Debatte um die „humanitäre Intervention“, später durch die Diskussion um die Responsibility to Protect1, dem Konzept einer internationalen Schutzverantwortung, zur Disposition gestellt.
Diese Arbeit wird zu klären versuchen, inwieweit bei der R2P von einer etablierten internationalen Norm gesprochen werden kann. Dazu ist zunächst nötig, darzustellen, welche Rolle Normen aus sozialkonstruktivistischer Perspektive für die Internationalen Beziehungen spielen und wie der Einfluss von Überzeugungen als Motiv für die Generierung und Verbreitung neuer Normen einzuschätzen ist. Im zweiten Schritt folgt eine Vorstellung der R2P im Sinne ihrer Entwicklung, ihrer Dimensionen und der um sie weltweit geführten Debatten. Die Ereignisse in Myanmar im Mai 2008 und die international geführte Debatte um die Anwendbarkeit der R2P auf diesen Fall sollen als empirische Verdeutlichung dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialkonstruktivismus in den internationalen Beziehungen
- Einführung
- Lebenszyklus einer internationalen Norm
- Responsibility to Protect
- Dimensionen der Norm
- Entwicklung der Norm
- Debatten um R2P
- Myanmar als Feuerprobe der R2P?
- Zusammenfassung & Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung und Etablierung der Responsibility to Protect (R2P) als internationale Norm. Sie analysiert, ob ein Paradigmenwechsel in den internationalen Beziehungen stattgefunden hat, der die traditionelle Souveränitätsdoktrin in Frage stellt. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Normen aus sozialkonstruktivistischer Perspektive und untersucht, wie die R2P als neue Norm entstanden ist und sich verbreitet hat.
- Entwicklung und Etablierung der R2P als internationale Norm
- Paradigmenwechsel in den internationalen Beziehungen
- Rolle von Normen aus sozialkonstruktivistischer Perspektive
- Genese und Verbreitung der R2P
- Anwendung der R2P in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Hausarbeit vor und erläutert den Forschungsstand. Sie zeigt auf, dass die traditionelle Souveränitätsdoktrin durch die zunehmende Bedeutung der Menschenrechte und die Herausforderungen durch humanitäre Katastrophen in den 1990er Jahren in Frage gestellt wurde. Die R2P wird als ein Konzept vorgestellt, das die internationale Schutzverantwortung für die Bevölkerung in den Vordergrund stellt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Sozialkonstruktivismus in den internationalen Beziehungen. Es werden die Grundprämissen des Konstruktivismus erläutert und die Bedeutung von Normen, Ideen und Identitäten für die internationale Politik hervorgehoben. Der Lebenszyklus einer internationalen Norm wird vorgestellt und die verschiedenen Theorien zur Normgenese diskutiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Responsibility to Protect. Es werden die Dimensionen der Norm, ihre Entwicklung und die um sie geführten Debatten dargestellt. Die Ereignisse in Myanmar im Mai 2008 dienen als empirische Verdeutlichung der Anwendbarkeit der R2P.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Responsibility to Protect (R2P), die Souveränität, die Menschenrechte, den Sozialkonstruktivismus, die internationale Politik, die Normgenese, die humanitäre Intervention und die internationalen Beziehungen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung und Etablierung der R2P als internationale Norm und untersucht, ob ein Paradigmenwechsel in den internationalen Beziehungen stattgefunden hat.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'Responsibility to Protect' (R2P)?
R2P ist ein Konzept der internationalen Schutzverantwortung, das besagt, dass die internationale Gemeinschaft eingreifen darf (oder muss), wenn ein Staat seine Bevölkerung nicht vor schweren Menschenrechtsverletzungen schützt.
Wie verändert R2P das klassische Souveränitätsverständnis?
Es findet ein Paradigmenwechsel statt: Souveränität wird nicht mehr als absolute Nichteinmischung, sondern als Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung definiert.
Welche Rolle spielt der Sozialkonstruktivismus in der Arbeit?
Er dient als theoretischer Rahmen, um zu erklären, wie internationale Normen entstehen, sich verbreiten und den Lebenszyklus einer Norm durchlaufen.
Was war die 'Feuerprobe' für R2P im Jahr 2008?
Die Ereignisse in Myanmar im Mai 2008 und die Debatte über die Anwendbarkeit der R2P in diesem Fall dienen als empirisches Beispiel für die Herausforderungen der Umsetzung.
Ist R2P bereits eine etablierte internationale Norm?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert die weltweiten Debatten sowie die Genese der Norm in den internationalen Beziehungen.
- Quote paper
- Thomas Danken (Author), 2009, Entwicklung und Etablierung der Responsibility to Protect – Paradigmenwechsel vollzogen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127302