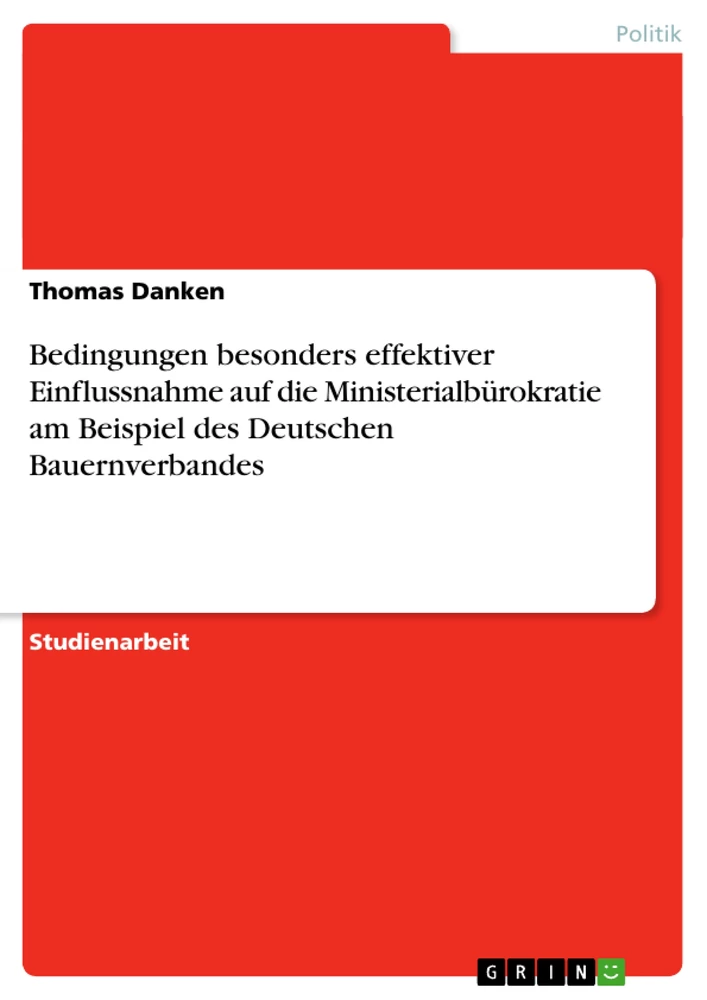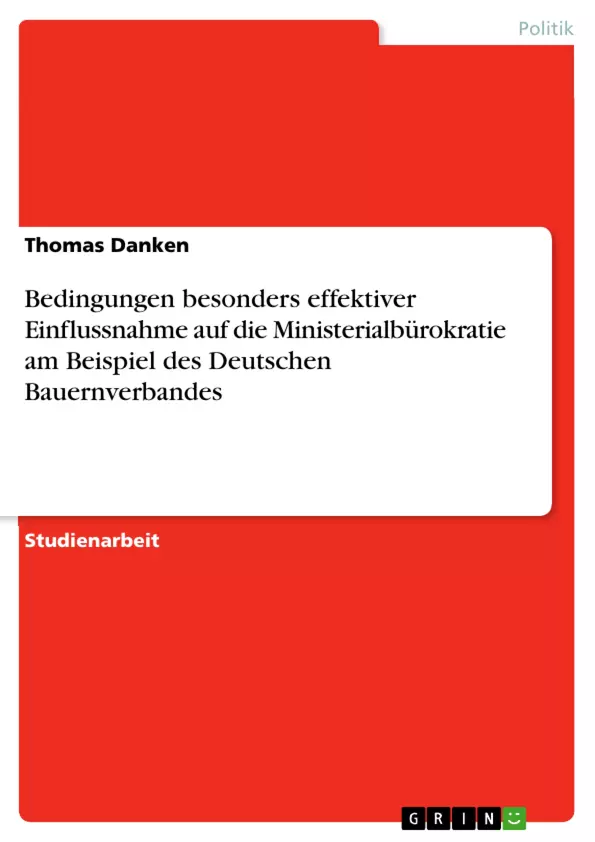Interessenverbände sind sowohl an Formulierung als auch an Implementation von Gesetzen beteiligt. Sie sind Gegenstand anhaltender normativ geführter Debatten, die sie einerseits als legitime intermediäre Organisationen gesellschaftlichen Inputs oder als Störfaktor innerhalb staatlicher Entscheidungsabläufe klassifizieren. Durch die exekutive Dominanz während der Politikformulierung richtet sich der Fokus der Interessenverbände vornehmlich auf die Ministerialbürokratie, da die Chance einer Einbringung eigener Vorschläge mit zunehmendem Formulierungsprozess schwindet.
Die vorliegende Arbeit wird versuchen, Determinanten einer besonders engen Verflechtung zwischen Interessenverbänden und entsprechenden Ministerien aufzuzeigen. Dies soll, aufgrund der exemplarischen Eignung, am Beispiel des Deutschen Bauernverbandes1 geschehen. Obwohl durch die Agrarwende im Jahre 2001 große Veränderungen auch für das Einflusspotential des DBV mit sich brachte, kann doch aus einer ex-post Perspektive verdeutlicht werden, welche Bedingungen zum relativen Erfolg des Verbandes hinsichtlich der Einflussnahme auf die Ministerialbürokratie führten.
Dazu sollen zuerst zentrale Begriffe der Arbeit geklärt werden und im zweiten Schritt eine Skizze der Interessengruppenforschung verdeutlichen, welch große normative Unterschiede innerhalb der akademischen Debatte existieren. Drittens werde die formalen, in GGO und GOBT auffindbaren, Einflusskanäle der Interessenverbände aufgezeigt. Schließlich werden die Determinanten besonders enger Verflechtung zwischen Ministerialbürokratie und Interessenverbänden dargestellt und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen und einleitende Erläuterungen
- 2.1. Sozialwissenschaftliche Eingrenzung des Begriffs „Interessenverband“
- 2.3. Der Akteur „Deutscher Bauernverband“
- 3. Regieren mit Verbänden
- 3.1. Skizze der Interessengruppenforschung
- 3.2. Netzwerktheorie
- 4. Formelles Einflusspotential der Verbände auf die Ministerialbürokratie
- 5. Bestimmungsgrößen des Einflusses eines Verbandes auf die Ministerialbürokratie
- 5.1. Politikfeld und Repräsentationsmonopol
- 5.2. Personalrekrutierung und personelle Verflechtung
- 5.3. Strategische Positionierung in parlamentarischen Fachausschüssen
- 5.4. Interessenidentität zwischen Verband und Ministerium
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Determinanten einer besonders engen Verflechtung zwischen Interessenverbänden und Ministerien am Beispiel des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Sie analysiert, welche Faktoren zum relativen Erfolg des DBV bei der Einflussnahme auf die Ministerialbürokratie führten, insbesondere im Kontext der Agrarwende 2001. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl formale Einflusskanäle als auch die Bedeutung von Faktoren wie Politikfeld, Personalverflechtung und strategischer Positionierung.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Interessenverband“
- Analyse des Einflusspotentials des Deutschen Bauernverbandes
- Formale und informelle Einflusskanäle von Verbänden auf die Ministerialbürokratie
- Bedeutung von Politikfeld, Personalverflechtung und strategischer Positionierung
- Bewertung der Determinanten enger Verflechtung zwischen Ministerialbürokratie und Interessenverbänden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Einflussnahme von Interessenverbänden auf die Ministerialbürokratie ein. Sie stellt die Relevanz des Themas heraus, indem sie auf die anhaltende Debatte über die Rolle von Interessenverbänden im staatlichen Entscheidungsprozess hinweist. Der Fokus liegt auf dem Deutschen Bauernverband (DBV) als exemplarischem Fall, dessen Einflussnahme trotz der Agrarwende von 2001 untersucht wird. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz und die Struktur der folgenden Kapitel.
2. Begriffsdefinitionen und einleitende Erläuterungen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe, beginnend mit einer sozialwissenschaftlichen Einordnung des Begriffs „Interessenverband“ und einer Diskussion der verschiedenen Bezeichnungen und ihrer jeweiligen Implikationen. Es hebt die Unterschiede zwischen Interessenverbänden und Parteien hervor, wobei der Verzicht auf politische Verantwortung als Hauptunterscheidungsmerkmal betont wird. Anschließend wird der Deutsche Bauernverband (DBV) als Hauptakteur der Arbeit vorgestellt, seine Struktur, seine Mitgliederzahl und seine hegemoniale Stellung im Bereich der Agrarinteressenvertretung werden erläutert. Der Kapitel verdeutlicht die Veränderungen durch die Agrarwende und die Herausforderungen, denen sich der DBV aufgrund der Differenzierung der Mitgliederinteressen gegenübersieht.
3. Regieren mit Verbänden: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Interessengruppenforschung und die Netzwerktheorie, um den theoretischen Kontext für die Analyse des Einflusses von Verbänden zu schaffen. Es werden die verschiedenen normativen Ansätze in der akademischen Debatte aufgezeigt, die Interessenverbände mal als legitime intermediäre Organisationen, mal als Störfaktor betrachten. Die Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der komplexen Interaktionen zwischen Verbänden, Ministerien und anderen Akteuren im politischen System.
4. Formelles Einflusspotential der Verbände auf die Ministerialbürokratie: Dieses Kapitel untersucht die formalen Einflusskanäle von Interessenverbänden auf die Ministerialbürokratie, die in Gesetzen und Vorschriften verankert sind. Es beschreibt die Möglichkeiten, wie Verbände ihre Interessen formal geltend machen können und analysiert die jeweiligen rechtlichen Grundlagen. Die Analyse konzentriert sich auf die Wege, wie Verbände an der Formulierung und Implementierung von Gesetzen beteiligt werden können.
5. Bestimmungsgrößen des Einflusses eines Verbandes auf die Ministerialbürokratie: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die den Einfluss eines Verbandes auf die Ministerialbürokratie bestimmen. Es untersucht die Bedeutung von Politikfeldern und Repräsentationsmonopolen, die Rolle der Personalrekrutierung und personeller Verflechtungen, sowie die strategische Positionierung in parlamentarischen Fachausschüssen und die Übereinstimmung der Interessen zwischen Verband und Ministerium. Das Kapitel liefert eine detaillierte Aufschlüsselung der wesentlichen Determinanten des Einflusses.
Schlüsselwörter
Interessenverbände, Deutscher Bauernverband (DBV), Ministerialbürokratie, Einflussnahme, Agrarpolitik, Agrarwende, Interessengruppenforschung, Netzwerktheorie, Politikfeld, Repräsentationsmonopol, Personalverflechtung, strategische Positionierung, Interessenidentität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einflussnahme des Deutschen Bauernverbandes auf die Ministerialbürokratie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Determinanten der engen Verflechtung zwischen dem Deutschen Bauernverband (DBV) und Ministerien. Im Fokus steht die Analyse der Faktoren, die zum Einfluss des DBV auf die Ministerialbürokratie führten, insbesondere im Kontext der Agrarwende 2001. Dabei werden sowohl formale als auch informelle Einflusskanäle berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Interessenverband“, die Analyse des Einflusspotentials des DBV, formale und informelle Einflusskanäle, die Bedeutung von Politikfeld, Personalverflechtung und strategischer Positionierung sowie die Bewertung der Determinanten enger Verflechtung zwischen Ministerialbürokratie und Interessenverbänden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen und einleitende Erläuterungen (inkl. Vorstellung des DBV), Regieren mit Verbänden (inkl. Interessengruppenforschung und Netzwerktheorie), Formelles Einflusspotential der Verbände, Bestimmungsgrößen des Einflusses eines Verbandes und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Einflussnahme des DBV.
Wie wird der Deutsche Bauernverband (DBV) in der Arbeit dargestellt?
Der DBV wird als Hauptakteur vorgestellt, seine Struktur, Mitgliederzahl und hegemoniale Stellung im Bereich der Agrarinteressenvertretung werden erläutert. Die Arbeit beleuchtet auch die Herausforderungen des DBV aufgrund der Agrarwende und der Differenzierung der Mitgliederinteressen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt die Interessengruppenforschung und die Netzwerktheorie, um den Einfluss von Verbänden zu analysieren. Es werden verschiedene normative Ansätze diskutiert, die Interessenverbände entweder als legitime intermediäre Organisationen oder als Störfaktor betrachten.
Welche Faktoren bestimmen den Einfluss des DBV?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Faktoren, die den Einfluss des DBV bestimmen, darunter Politikfelder und Repräsentationsmonopole, Personalrekrutierung und personelle Verflechtungen, strategische Positionierung in parlamentarischen Fachausschüssen und die Interessenidentität zwischen Verband und Ministerium.
Welche formalen Einflusskanäle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die formalen Einflusskanäle, die in Gesetzen und Vorschriften verankert sind. Es werden die Möglichkeiten beschrieben, wie Verbände ihre Interessen formal geltend machen können und die jeweiligen rechtlichen Grundlagen analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interessenverbände, Deutscher Bauernverband (DBV), Ministerialbürokratie, Einflussnahme, Agrarpolitik, Agrarwende, Interessengruppenforschung, Netzwerktheorie, Politikfeld, Repräsentationsmonopol, Personalverflechtung, strategische Positionierung, Interessenidentität.
- Citar trabajo
- Thomas Danken (Autor), 2009, Bedingungen besonders effektiver Einflussnahme auf die Ministerialbürokratie am Beispiel des Deutschen Bauernverbandes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127304