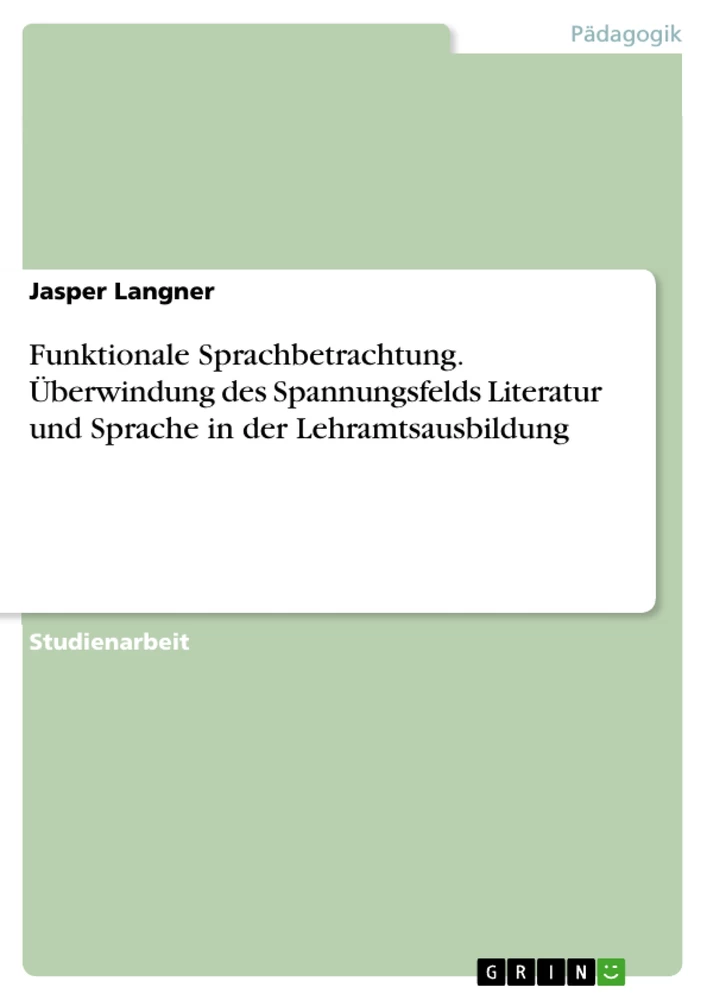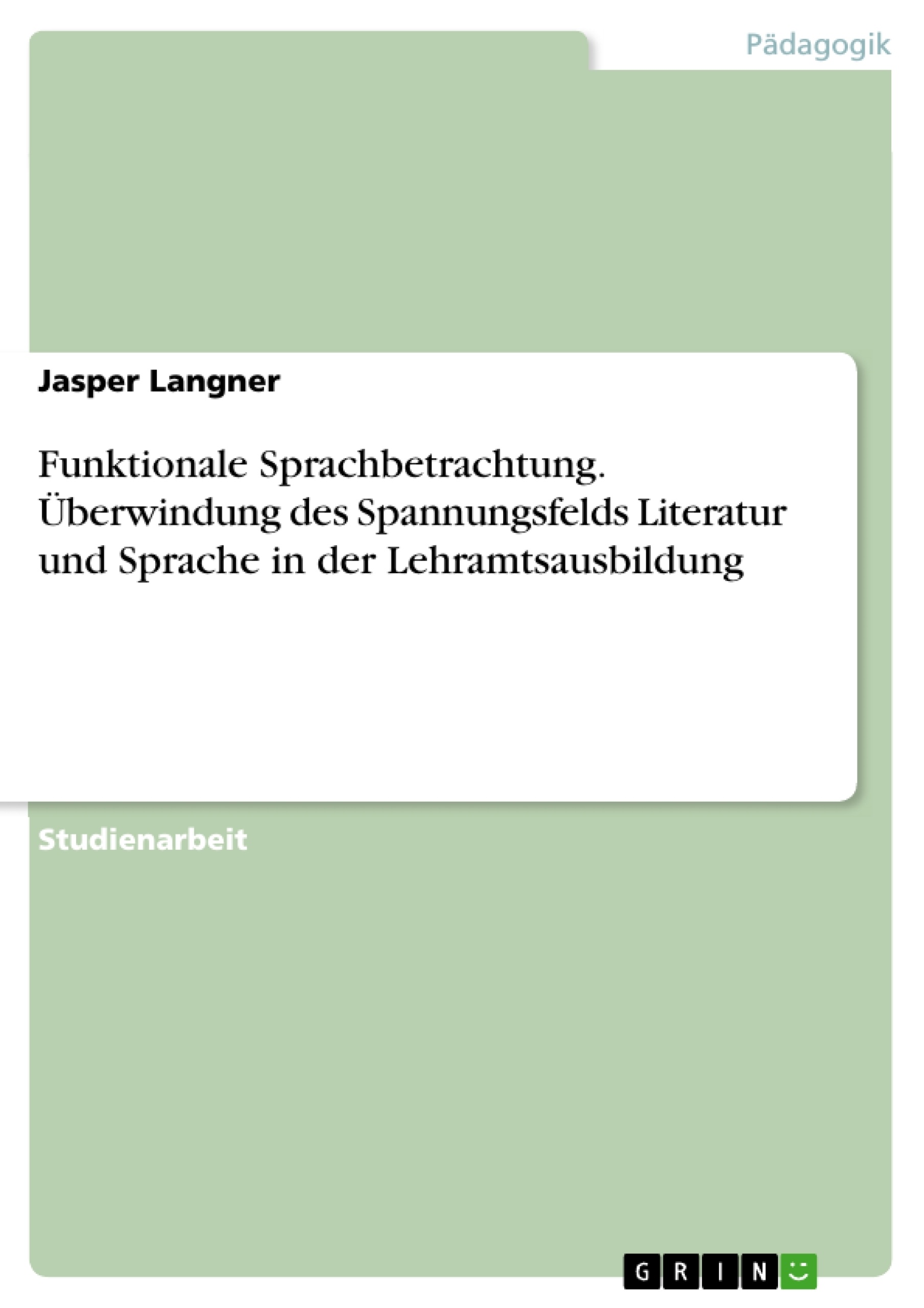Diese Arbeit richtet den Blick auf eine funktionale Sprachbetrachtung, die das Spannungsfeld von Literatur und Sprache zu überwinden versucht und eine reflektierte Durchdringung der Grammatiklehre in der Lehramtsausbildung möglich machen kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht versucht, einen dezidierten Lösungsweg dieser multidimensionalen Problematik zu postulieren, sondern einen perspektivischen Weg zu skizzieren, der den Grammatikunterricht in ein neues Licht rücken lässt.
Der Grammatikunterricht nimmt schon seit geraumer Zeit sowohl in der universitären Lehramtsausbildung als auch im Deutschunterricht eine zentrale Rolle ein. Unbeschadet dessen gibt es kritische Stimmen zu dieser Bedeutung. Daniela Elsner trug 2021 in ihrem Aufsatz über Grammatik und die Rolle von epistemologischen Überzeugungen markante Studienergebnisse zusammen: So stellte Andrews in seinen Studien von 1994 fest, dass mehr als 50 % der Auszubildenden über unzureichende Grammatikkenntnisse verfügen. Diese Studie wurde durch eine Studie von Alderson und Hudson (2013) ergänzt, die herausstellte, dass die Sprachkenntnisse der Studierenden im Grundstudi-um von 1986 bis 2009 kontinuierlich zurückgegangen sind. Das Thema der Seminararbeit richtet den Blick auf eine funktionale Sprachbetrachtung, die das Spannungsfeld von Literatur und Sprache zu überwinden versucht und eine reflektierte Durchdringung der Grammatiklehre in der Lehramtsausbildung möglich machen kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht versucht, einen dezidierten Lösungsweg dieser multidimensionalen Problematik zu postulieren, sondern einen perspektivischen Weg zu skizzieren, der den Grammatikunterricht in ein neues Licht rücken lässt.
Der erste Teil der Arbeit erläutert die theoretische Konzeption über Ziele und Probleme des Grammatikunterrichts in der Lehramtsausbildung. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit einer funktionalen Sprachbetrachtung als methodischen Weg, um zu zeigen, dass "eine isolierte Betrachtung eines einzelnen sprachlichen Phänomens nicht weit führt, dass vielmehr Interpretationshinweise aus dem weiteren Kontext nicht nur wünschenswert, sondern notwendig sind." Im dritten Teil werden kritische Positionen zur funktionalen Sprachbetrachtung beleuchtet. Abschließend wird im Fazit erläutert, warum der methodische Weg eine interessante Perspektive für die universitäre Ausbildung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ziele und Probleme der Grammatiklehre im Lehramtsstudium
- 3. Funktionale Sprachbetrachtung als methodischer Weg
- 4. Warum eine funktionale Sprachbetrachtung in der Lehramtsausbildung sinnvoll ist
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen des Grammatikunterrichts im Lehramtsstudium und schlägt einen funktionalen Ansatz als methodischen Weg vor. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen deklarativem und prozeduralem Grammatikwissen bei Lehramtsstudierenden und analysiert die Gründe für die Unzufriedenheit mit dem traditionellen Grammatikunterricht. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines alternativen Ansatzes, der die Anwendung des grammatikalischen Wissens in praxisrelevanten Kontexten fördert.
- Defizite im Grammatikunterricht des Lehramtsstudiums
- Die Unterscheidung zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen
- Funktionale Sprachbetrachtung als methodischer Ansatz
- Anwendung des grammatikalischen Wissens in praxisrelevanten Kontexten
- Verbesserung der Grammatikkompetenz von angehenden Lehrkräften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert das zentrale Problem der Arbeit: Die unzureichenden Grammatikkenntnisse und die mangelnde Anwendungskompetenz von Lehramtsstudierenden. Sie stützt sich auf diverse Studien, die einen Rückgang der Sprachkenntnisse und Unbeliebtheit des Grammatikunterrichts aufzeigen. Die Arbeit kündigt einen funktionalen Ansatz an, der die Grammatiklehre in einen neuen Kontext stellt und eine reflektierte Durchdringung der Thematik ermöglichen soll. Der Fokus liegt auf der Beschreibung eines perspektivischen Weges, nicht auf der Präsentation fertiger Lösungen.
2. Ziele und Probleme der Grammatiklehre im Lehramtsstudium: Dieses Kapitel differenziert zwischen deklarativem (theoretisches Wissen) und prozeduralem Wissen (anwendungsbezogenes Wissen) im Kontext der Grammatik. Es wird erläutert, dass deklaratives Wissen allein nicht ausreicht, um Grammatik kompetent anzuwenden. Es werden die Ansätze von Elsner (naives vs. reifes Wissen) und Ossner (kommunikative Funktion der Sprache) vorgestellt, die die Bedeutung einer funktionalen und kontextuellen Betrachtungsweise hervorheben. Das Kapitel diskutiert kritisch die Zielsetzung des Grammatikunterrichts im Lehramtsstudium und bezieht die Bildungsstandards und das „Kerncurriculum Grammatik“ mit ein, die den Aufbau von prozeduralem und kontextuellem Wissen betonen.
3. Funktionale Sprachbetrachtung als methodischer Weg: Dieses Kapitel präsentiert die funktionale Sprachbetrachtung als methodischen Ansatz zur Überwindung der in Kapitel 2 beschriebenen Probleme. Es wird argumentiert, dass eine isolierte Betrachtung einzelner sprachlicher Phänomene unzureichend ist und eine kontextuelle Interpretation notwendig ist, um ein tieferes Verständnis zu erreichen. Die Kapitel erläutert die Vorteile dieses Ansatzes für die Lehramtsausbildung, ohne jedoch konkrete didaktische Methoden im Detail vorzustellen.
4. Warum eine funktionale Sprachbetrachtung in der Lehramtsausbildung sinnvoll ist: Dieses Kapitel vertieft die Argumentation für den funktionalen Ansatz und untermauert die Notwendigkeit einer solchen Herangehensweise in der Lehramtsausbildung. Es wird wahrscheinlich auf die Vorteile für den zukünftigen Grammatikunterricht an Schulen eingegangen und die Bedeutung von prozeduralem und kontextuellem Wissen nochmals betont.
Schlüsselwörter
Grammatikunterricht, Lehramtsausbildung, deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, funktionale Sprachbetrachtung, kontextuelle Interpretation, Kompetenzorientierung, Sprachdidaktik, Bildungsstandards.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Funktionale Sprachbetrachtung im Grammatikunterricht des Lehramtsstudiums"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen des Grammatikunterrichts im Lehramtsstudium und schlägt einen funktionalen Ansatz als methodischen Weg vor. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen deklarativem und prozeduralem Grammatikwissen bei Lehramtsstudierenden und konzentriert sich auf die Entwicklung eines alternativen Ansatzes, der die Anwendung des grammatikalischen Wissens in praxisrelevanten Kontexten fördert.
Welche Probleme im Grammatikunterricht des Lehramtsstudiums werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Defizite im Grammatikunterricht, die Unterscheidung zwischen deklarativem (theoretisches Wissen) und prozeduralem Wissen (anwendungsbezogenes Wissen), und die unzureichende Anwendungskompetenz von Lehramtsstudierenden. Es wird kritisiert, dass deklaratives Wissen allein nicht ausreicht und die Bedeutung von prozeduralem und kontextuellem Wissen betont.
Was ist der vorgeschlagene methodische Ansatz?
Die Arbeit schlägt eine funktionale Sprachbetrachtung als methodischen Ansatz vor. Dieser Ansatz betont die kontextuelle Interpretation sprachlicher Phänomene und die Anwendung des grammatikalischen Wissens in praxisrelevanten Kontexten. Im Gegensatz zu einer isolierten Betrachtung einzelner sprachlicher Phänomene, soll ein tieferes Verständnis durch kontextuelle Interpretation erreicht werden.
Welche Vorteile bietet die funktionale Sprachbetrachtung in der Lehramtsausbildung?
Die funktionale Sprachbetrachtung soll die Überwindung der beschriebenen Probleme im Grammatikunterricht ermöglichen. Sie fördert die Entwicklung von prozeduralem und kontextuellem Wissen und verbessert somit die Grammatikkompetenz von angehenden Lehrkräften. Die Arbeit argumentiert für die Notwendigkeit dieses Ansatzes in der Lehramtsausbildung und betont die Vorteile für den zukünftigen Grammatikunterricht an Schulen.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Grammatikunterricht, Lehramtsausbildung, deklaratives Wissen, prozedurales Wissen, funktionale Sprachbetrachtung, kontextuelle Interpretation, Kompetenzorientierung, Sprachdidaktik und Bildungsstandards.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) skizziert das Problem unzureichender Grammatikkenntnisse. Kapitel 2 (Ziele und Probleme) differenziert zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen. Kapitel 3 (Funktionale Sprachbetrachtung) präsentiert den methodischen Ansatz. Kapitel 4 (Funktionaler Ansatz in der Lehramtsausbildung) vertieft die Argumentation für den funktionalen Ansatz. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen (obwohl der Inhalt von Kapitel 5 nicht explizit beschrieben ist).
Werden konkrete didaktische Methoden vorgestellt?
Nein, die Arbeit konzentriert sich auf die Beschreibung des funktionalen Ansatzes als perspektivischen Weg und nicht auf die Präsentation konkreter didaktischer Methoden im Detail.
Welche Studien oder Theorien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf Studien, die einen Rückgang der Sprachkenntnisse und Unbeliebtheit des Grammatikunterrichts aufzeigen, sowie auf die Ansätze von Elsner (naives vs. reifes Wissen) und Ossner (kommunikative Funktion der Sprache). Die Bildungsstandards und das „Kerncurriculum Grammatik“ werden ebenfalls miteinbezogen.
- Citar trabajo
- Jasper Langner (Autor), 2021, Funktionale Sprachbetrachtung. Überwindung des Spannungsfelds Literatur und Sprache in der Lehramtsausbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1273985