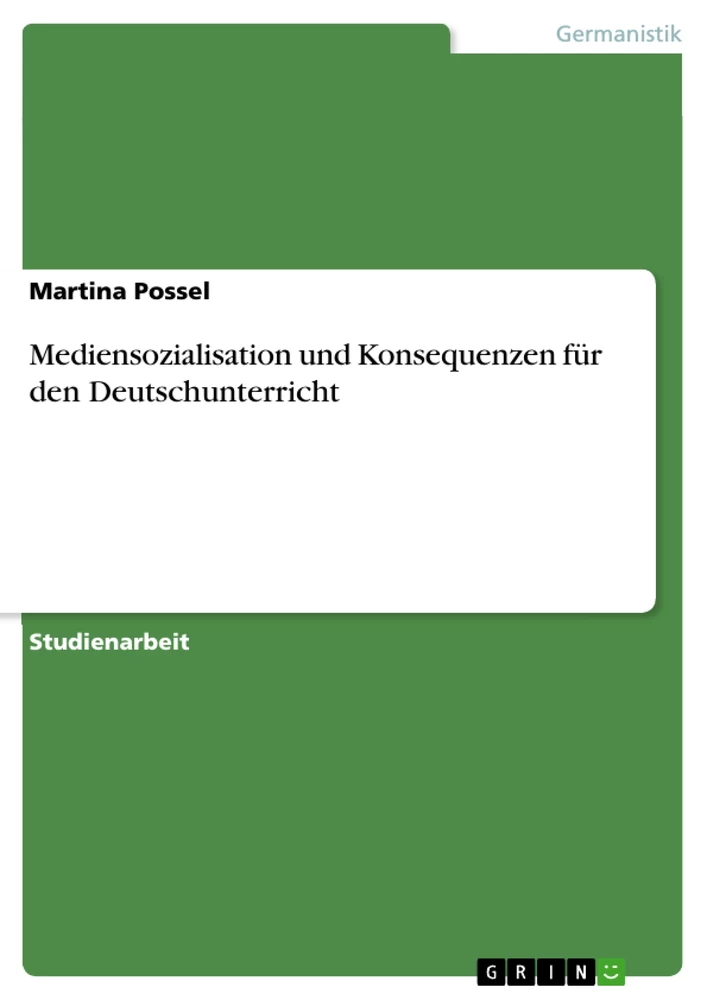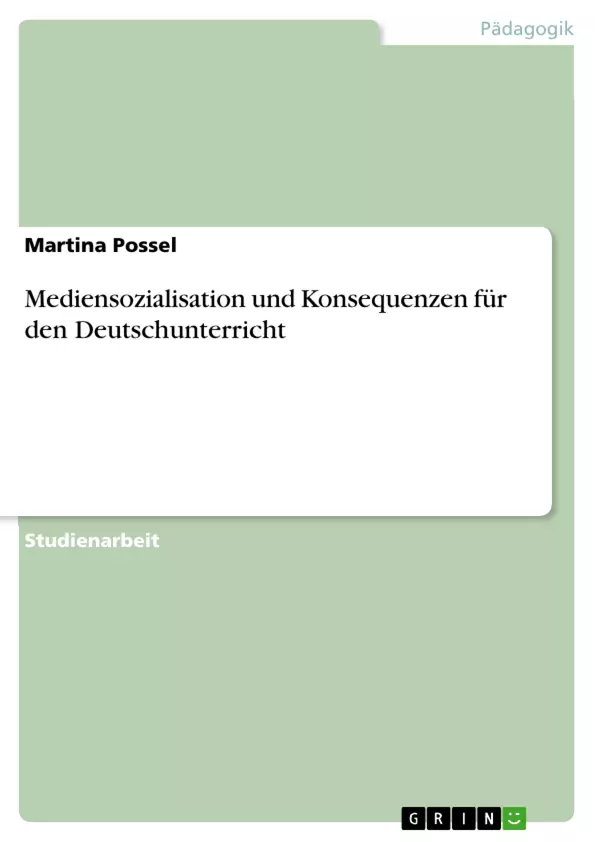Kinder sehen immer mehr Fernsehen, dies belegen mehrere Studien wie z.B. die IZI - oder die KIM - Studie. Warum aber schauen Kinder heute so viel fern, bringt dies Gefahren mit sich oder ist es vielleicht sogar von Vorteil? Hat es Konsequenzen für den Deutschunterricht dass Kinder mehr Zeit vordem Fernseher verbringen? Wenn ja welche? All das sind Fragen, auf die ich in folgender Arbeit eingehen möchte. Laut einer Untersuchung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen Studie schauen Kinder täglich 93 Minuten fern. Je älter die Kinder
werden, desto länger schauen sie. So schauen 3-5 jährige 69 Minuten, 6-9 jährige 87 Minuten 10-13 jährige 113 Minuten und 14-29 jährige sogar 142 Minuten fern.1 In den Vereinigten Staaten von Amerika schauen Kinder im Durchschnitt täglich sogar 4 Stunden fern. Auch hat man untersucht, ob Mädchen mehr fern schauen als Jungen. Hier ist aber nur ein minimaler Unterschied festzustellen. Bei einer Befragung von Kindern zwischen 3 und 13 Jahren nach ihren täglichen Freizeitaktivitäten, liegt das Fernsehen nach den Hausaufgaben auf dem zweiten Platz. 78% der Befragten schauen täglich fern und 80% machen täglich Hausaufgaben. Täglich draußen oder drinnen spielen aber nur 60%, bzw. 51%. Ein Buch lesen täglich sogar nur 13%, bzw. 46% in der Woche. Eine Umfrage in der Seminarsitzung ergab, dass die Kursteilnehmer in ihrer Kindheit vor ca. 10-15 Jahren deutlich weniger vor dem Fernseher gesessen haben, als die Kinder heutzutage.
Einige Teilnehmer berichteten, dass das Fernsehen für sie früher etwas ganz besonderes war und nur zu besonderen Anlässen eine Sendung geguckt wurde, andere hatten eine Sendung wie zum Beispiel die „Sendung mit der Maus“, die sie am Sonntag immer anschauen durften. Nicht nur die Dauer des Fernschauens hat sich verändert, sondern auch das Angebot, und das in vielerlei Hinsicht.
Inhaltsverzeichnis
- Grunddaten Kinder und Medien
- Warum schauen Kinder so viel fern?
- Mediennutzung hat Einfluss auf Gefühle, Vorstellungen und Orientierung von Kindern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit sich der zunehmende Fernsehkonsum von Kindern auf ihre Mediensozialisation und den Deutschunterricht auswirkt. Dabei werden die veränderten Nutzungsgewohnheiten, die Ursachen des Fernsehkonsums und die potenziellen Folgen für die Entwicklung und das Lernen von Kindern analysiert.
- Veränderung des Fernsehkonsums bei Kindern
- Gründe für den erhöhten Fernsehkonsum
- Einfluss des Fernsehkonsums auf die Entwicklung von Kindern
- Konsequenzen für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Grunddaten Kinder und Medien
Dieser Abschnitt beleuchtet die aktuellen Daten zum Fernsehkonsum von Kindern. Er zeigt die durchschnittliche tägliche Fernsehdauer in verschiedenen Altersgruppen und vergleicht diese mit früheren Daten. Weiterhin werden Veränderungen in der Ausstattung von Haushalten, im Fernsehsenderangebot und im Programm für Kinder analysiert.
Warum schauen Kinder so viel fern?
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Beweggründen, warum Kinder heute so viel fernsehen. Er untersucht verschiedene Faktoren, wie Langeweile, Gruppenzwang, soziale Isolation und die Bequemlichkeit der Eltern. Dabei werden auch die fünf Bedingungen von Gerhard Tulodziecki vorgestellt, die den Medienkonsum von Kindern beeinflussen: Lebenssituation, Erfahrungsstand, intellektuelle und sozial-moralische Entwicklung, Folgen des Medienhandelns und Bedürfnisse.
Mediennutzung hat Einfluss auf Gefühle, Vorstellungen und Orientierung von Kindern
Dieser Abschnitt diskutiert die Auswirkungen des Fernsehkonsums auf die Gefühlswelt, die Vorstellungen und die Orientierung von Kindern. Er analysiert sowohl positive Aspekte, wie die Vermittlung von Sachthemen, als auch negative Aspekte, wie die Beeinflussung durch fiktionale Figuren und die Entstehung von Ängsten.
Schlüsselwörter
Mediensozialisation, Fernsehkonsum, Kinder, Deutschunterricht, Bildung, Entwicklung, Mediennutzung, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Lebenswelt, Lernen, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange schauen Kinder heute durchschnittlich täglich fern?
Laut Studien schauen Kinder im Durchschnitt 93 Minuten täglich fern, wobei die Dauer mit zunehmendem Alter steigt (bis zu 142 Minuten bei 14-29-Jährigen).
Welche Auswirkungen hat hoher Fernsehkonsum auf den Deutschunterricht?
Der erhöhte Konsum beeinflusst die Sprachentwicklung, die Vorstellungskraft und das Leseverhalten, da nur noch ein Bruchteil der Kinder täglich Bücher liest.
Warum schauen Kinder laut Gerhard Tulodziecki so viel fern?
Tulodziecki nennt fünf Bedingungen: Lebenssituation, Erfahrungsstand, intellektuelle/sozial-moralische Entwicklung, Folgen des Medienhandelns und individuelle Bedürfnisse.
Gibt es auch positive Aspekte des Fernsehens für Kinder?
Ja, das Fernsehen kann zur Vermittlung von Sachthemen beitragen (z. B. „Sendung mit der Maus“) und die Wissensbasis erweitern, sofern es gezielt genutzt wird.
Wie hat sich das Fernsehangebot in den letzten 15 Jahren verändert?
Sowohl die Dauer als auch die Vielfalt der Sender und Programme haben massiv zugenommen, was Fernsehen von einem „besonderen Ereignis“ zu einer allgegenwärtigen Freizeitbeschäftigung gemacht hat.
- Citation du texte
- Martina Possel (Auteur), 2006, Mediensozialisation und Konsequenzen für den Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127467