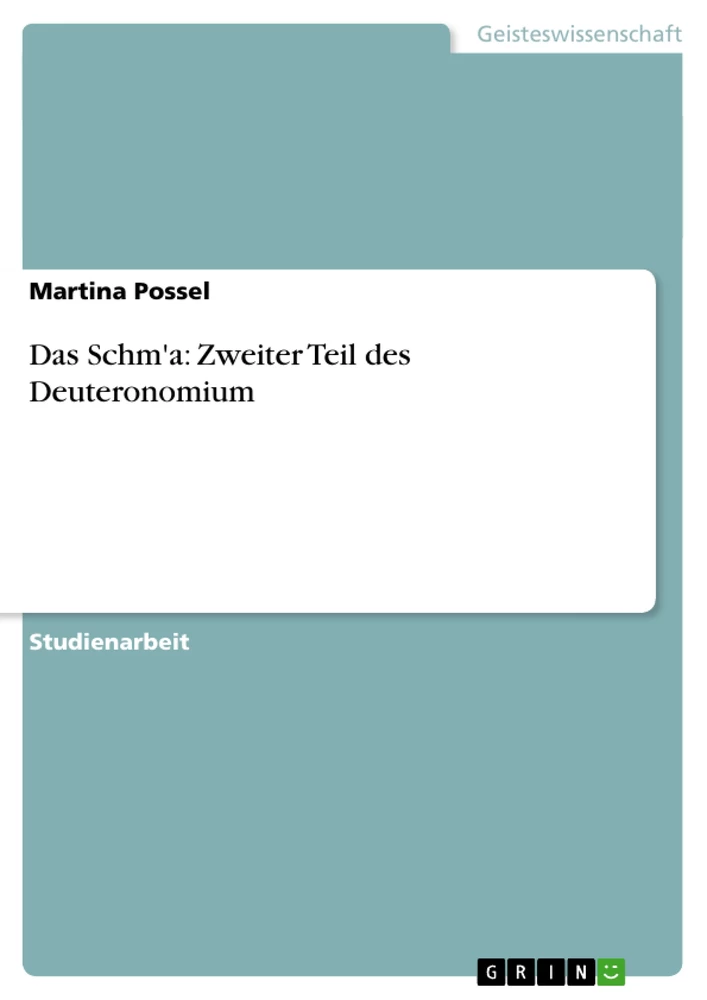Das Buch Deuteronomium ist das fünfte Buch Moses. Es enthält drei Ausführungen, die Moses an die Israeliten richtet. In dem ersten Teil (Dtn 1-4) beschreibt Moses die bedeutendsten Ereignisse der letzen 40 Jahre der Wüstenwanderung. In Dtn 5-26, dem zweiten Teil, welcher den Hauptteil des Buches darstellt, werden zunächst die zehn Gebote wiederholt, bevor weitere Regeln und Gesetze aufgestellt werden, die nötig sind um im Land Kanaan zu leben. Im letzte Teil (Dtn 27-30) werden die positiven und negativen Konsequenzen besprochen, mit denen man zu rechnen hat, wenn man sich nicht an die Gebote hält.
Das Schm’a, welches im Folgenden besprochen wird, ist dem zweiten Teil zuzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Deuteronomium, das fünfte Buch Moses
- 2. Bedeutung des Schm'as
- 3. Übersetzungsprobleme
- 4. Aufbau des Schm'as
- 4.1 Dtn 6,4-9
- 4.2 Dtn 11, 13-21
- 4.3 Num 15,37-41
- 5. Die Liebe zu Gott im Schm'a
- 6. Das jüdische Gebet
- 6.1 Tefillin
- 6.2 Mesusot
- 7. Matisyahu
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das jüdische Glaubensbekenntnis Schm'a Israel. Sie beleuchtet die Bedeutung des Schm'a im Judentum, analysiert Herausforderungen bei der Übersetzung des Textes und erörtert den Aufbau des Schm'a aus seinen drei konstituierenden Bibelstellen. Der Fokus liegt auf der theologischen und sprachlichen Komplexität des zentralen Gebets.
- Bedeutung des Schm'a im jüdischen Glauben
- Übersetzungsprobleme des hebräischen Originals
- Der Aufbau des Schm'a aus drei Bibelstellen
- Theologische Implikationen des Schm'a
- Das Schm'a als Ausdruck des Monotheismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Deuteronomium, das fünfte Buch Moses: Das Buch Deuteronomium, das fünfte Buch Moses, gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil (Dtn 1-4) beschreibt die Ereignisse der vierzigjährigen Wüstenwanderung. Der zweite Teil (Dtn 5-26), der Hauptteil des Buches, wiederholt die zehn Gebote und legt weitere Regeln für das Leben im Land Kanaan fest. Der letzte Teil (Dtn 27-30) diskutiert die Folgen der Einhaltung beziehungsweise Nicht-Einhaltung der Gebote. Das Schm'a, der Fokus dieser Arbeit, gehört zum zweiten Teil.
2. Bedeutung des Schm'as: Das Schm'a Israel ist das zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums. Es bezeugt die Einheit und Einzigartigkeit Gottes und beinhaltet zentrale Gebote. Es geht jedoch über die bloße Auflistung von Geboten hinaus, indem es die stete Verpflichtung Israels betont, Gott zu lieben und als den einzigen Gott anzuerkennen. Das Schm'a unterstreicht den Monotheismus und die Verwandtschaft aller Menschen.
3. Übersetzungsprobleme: Die genaue Bedeutung des ersten Satzes des Schm'a („Sch'ma Jisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad“) ist aufgrund verschiedener Übersetzungsmöglichkeiten unsicher. Das Hebräische fehlt Satzzeichen und das Hilfsverb „sein“ wird nicht explizit ausgedrückt, was zu unterschiedlichen Interpretationen der Beziehung zwischen den Wörtern führt. Die unterschiedlichen Übersetzungen des Wortes „echad“ (eins, allein, einzig, einzigartig) tragen zusätzlich zur Unsicherheit bei. Die Wirkung der ersten beiden Wörter „Höre Israel“ hängt stark vom Kontext ab (Aufforderung vs. Teil einer Aussage).
4. Aufbau des Schm'as: Das Schm'a besteht aus drei Bibelstellen (Dtn 6, 4-9; Dtn 11, 13-21; Num 15, 37-41), die gemeinsam das Glaubensbekenntnis bilden. Der Titel „Schm'a Israel“ bezieht sich hauptsächlich auf den ersten Abschnitt (Dtn 6, 4-9). Die Rabbinen gaben jedem Teil einen eigenen Namen („qabbalat `ol malkut schamajim“ – Annahme des Jochs der göttlichen Herrschaft für Dtn 6,4-9 und „qabbalat `ol hamizwot“ – Annahme des Jochs der Gebote für Dtn 11, 13-21). Die Reihenfolge der Abschnitte betont die Abhängigkeit der Gebotsannahme von der Anerkennung Gottes Herrschaft.
Schlüsselwörter
Schm'a Israel, Deuteronomium, Monotheismus, Glaubensbekenntnis, Judentum, Übersetzungsprobleme, hebräische Sprache, Bibelauslegung, Gottes Einheit, Gottes Gebote.
Häufig gestellte Fragen zum Schm'a Israel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das jüdische Glaubensbekenntnis „Schm'a Israel“, beleuchtet dessen Bedeutung im Judentum, untersucht Übersetzungsschwierigkeiten des hebräischen Originals und erörtert den Aufbau des Schm'a aus seinen drei konstituierenden Bibelstellen (Dtn 6,4-9; Dtn 11,13-21; Num 15,37-41). Der Fokus liegt auf der theologischen und sprachlichen Komplexität dieses zentralen Gebets.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Deuteronomium, das fünfte Buch Moses; 2. Bedeutung des Schm'as; 3. Übersetzungsprobleme; 4. Aufbau des Schm'as (inkl. Unterkapiteln zu den drei Bibelstellen); 5. Die Liebe zu Gott im Schm'a; 6. Das jüdische Gebet (inkl. Tefillin und Mesusot); 7. Matisyahu.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung des Schm'a im jüdischen Glauben, die Übersetzungsprobleme des hebräischen Originals, den Aufbau des Schm'a aus drei Bibelstellen, die theologischen Implikationen des Schm'a und das Schm'a als Ausdruck des Monotheismus.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Kapitel 1 beschreibt das Buch Deuteronomium und dessen Dreiteilung. Kapitel 2 erklärt die zentrale Bedeutung des Schm'a als Glaubensbekenntnis des Judentums. Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen bei der Übersetzung des Schm'a aufgrund fehlender Satzzeichen und verschiedener Interpretationen hebräischen Vokabulars. Kapitel 4 erläutert den Aufbau des Schm'a aus drei Bibelstellen und die Namensgebung durch die Rabbinen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Schm'a Israel, Deuteronomium, Monotheismus, Glaubensbekenntnis, Judentum, Übersetzungsprobleme, hebräische Sprache, Bibelauslegung, Gottes Einheit, Gottes Gebote.
Wie ist der Aufbau des Schm'a?
Das Schm'a besteht aus drei Bibelstellen: Dtn 6, 4-9; Dtn 11, 13-21; Num 15, 37-41. Die Rabbinen nannten die ersten beiden Abschnitte „qabbalat `ol malkut schamajim“ (Annahme des Jochs der göttlichen Herrschaft) und „qabbalat `ol hamizwot“ (Annahme des Jochs der Gebote). Die Reihenfolge unterstreicht die Abhängigkeit der Gebotsannahme von der Anerkennung Gottes Herrschaft.
Welche Übersetzungsprobleme werden angesprochen?
Die Übersetzung des ersten Satzes „Sch'ma Jisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad“ ist aufgrund fehlender Satzzeichen im Hebräischen und der Mehrdeutigkeit von Wörtern wie „echad“ (eins, allein, einzig, einzigartig) schwierig. Auch die Interpretation von „Höre Israel“ als Aufforderung oder Teil einer Aussage ist kontextabhängig.
Welche Rolle spielt die Liebe zu Gott im Schm'a?
Das Schm'a geht über die bloße Auflistung von Geboten hinaus und betont die stete Verpflichtung Israels, Gott zu lieben und als den einzigen Gott anzuerkennen. Es unterstreicht den Monotheismus und die Verwandtschaft aller Menschen.
- Quote paper
- Martina Possel (Author), 2007, Das Schm'a: Zweiter Teil des Deuteronomium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127470