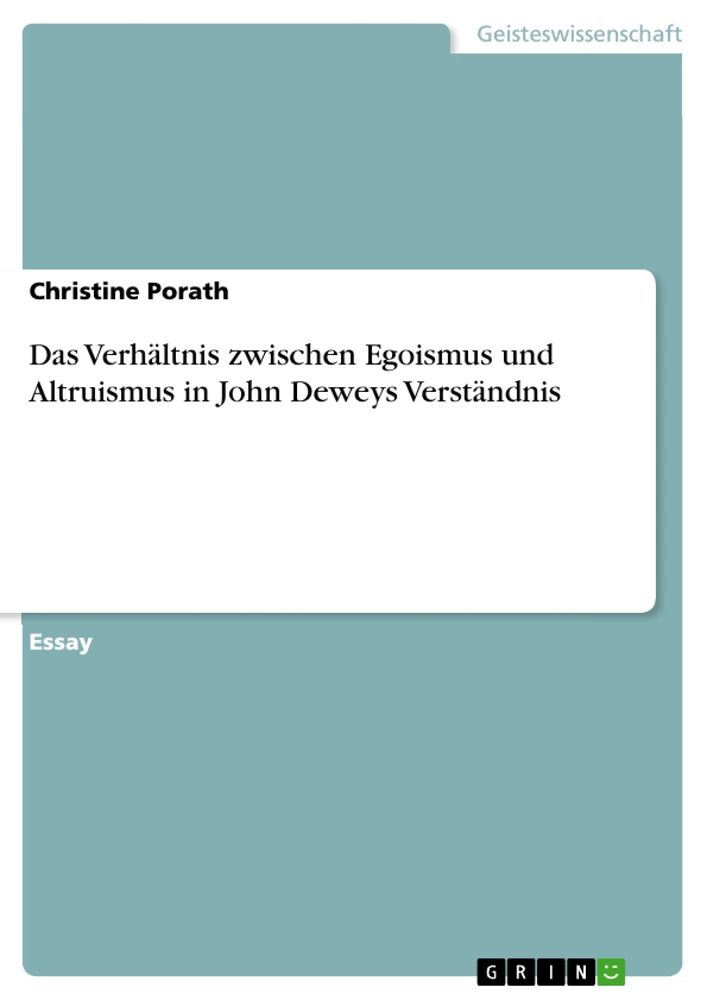Eine wichtige Frage in der Ethik, die daran interessiert ist zu bestimmen, welche Handlungen moralisch gut oder schlecht sind, ist, ob die Menschen egoistisch oder altruistisch sind, d.h. ob wir allein mit Rücksicht auf unsere eigenen Interessen handeln, oder ob wir darüber hinaus mit Rücksicht auf andere Menschen handeln und welche dieser Handlungsweisen einen moralischen Wert haben. Es gibt unterschiedliche philosophische Strömungen, die entweder annehmen, dass Menschen unmittelbar nur egoistisch sind oder dass der Mensch sowohl egoistisch als auch altruistisch handelt und dass nur Handlungen, die nicht egoistisch sind, einen moralischen Wert haben. Aber alle sehen beide Handlungsweisen getrennt, d.h. dass
sich beide gegenseitig ausschließen. Im Gegensatz dazu argumentiert John Dewey in seinem Essay „The Moral Self“ dafür, dass es nicht gegensätzlich ist, sowohl egoistisch als auch altruistisch zu handeln. Wenn man den moralischen Wert einer Handlung mit Hinblick darauf bestimmt, ob diese egoistisch ist oder nicht, dann bedeutet dies, dass man die Handlung in Bezug auf das Resultat dieser Handlung beurteilt, d.h. dass man fragt, ob die nachfolgenden Konsequenzen nur gut für mich selbst oder für die Allgemeinheit (andere Menschen) ist. In diesem Sinne ist das Ende der Handlung am wichtigsten.
Inhaltsverzeichnis
- Das Verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus in John Deweys Verständnis
- Einleitung
- Die Trennung von Egoismus und Altruismus
- Das Selbst und die Handlung
- Die moralische Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern
- Die moralische Beurteilung von Handlungen
- Die traditionelle ethische Philosophie
- Der Mensch als soziales Wesen
- Die Selbstverwirklichung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert John Deweys Verständnis des Verhältnisses zwischen Egoismus und Altruismus in seinem Essay „The Moral Self“. Ziel ist es, Deweys Argumentation zu verstehen, dass Egoismus und Altruismus nicht als gegensätzliche Kräfte betrachtet werden sollten, sondern als gleichberechtigte Motive für menschliches Handeln. Der Text beleuchtet, wie Dewey die traditionelle ethische Philosophie kritisiert, die den Menschen als isoliertes Wesen betrachtet und die Moralität von der Frage abhängig macht, ob Handlungen egoistisch oder altruistisch motiviert sind.
- Deweys Kritik an der traditionellen ethischen Philosophie
- Das Selbst als soziales Wesen
- Die Bedeutung der Selbstverwirklichung
- Das Verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus
- Die Rolle der Gemeinschaft in der Moralität
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus in John Deweys Verständnis: Der Text beginnt mit einer Einführung in die ethische Frage nach dem Verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus und stellt Deweys Argumentation vor, dass diese beiden Handlungsweisen nicht gegensätzlich sind.
- Die Trennung von Egoismus und Altruismus: Der Text analysiert Deweys Argumentation, dass Handlungen ursprünglich weder egoistisch noch altruistisch sind, sondern aus einem instinktiven Interesse für ein Objekt resultieren. Er zeigt, dass Handlungen nicht automatisch egoistisch sind, nur weil sie mit Rücksicht auf das eigene zukünftige Wohlbefinden ausgeführt werden.
- Das Selbst und die Handlung: Der Text beleuchtet Deweys Argumentation, dass ein Selbst die Voraussetzung für Handlungen ist und dass jede Handlung auch eine Wirkung auf das Selbst hat. Er zeigt, dass ein Interesse die Voraussetzung für Handlungen ist und dies nichts damit zu tun hat, ob eine Handlung egoistisch ist oder nicht.
- Die moralische Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern: Der Text analysiert Deweys Argumentation, dass es eine moralische Pflicht ist, sich um sich selbst zu kümmern, aufgrund der Folgen, die entstehen könnten, wenn man nicht mit Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse handelt.
- Die moralische Beurteilung von Handlungen: Der Text zeigt, dass das Urteil darüber, ob eine Handlung moralisch gut ist oder nicht, nicht davon abhängig ist, ob diese nur Rücksicht auf meine eigenen Bedürfnisse oder nur auf die Bedürfnisse meiner Mitmenschen nimmt. Er analysiert Deweys Argumentation, dass eine Handlung moralisch gut sein kann, selbst wenn diese egoistisch ist oder ihren Ursprung in einem privaten Interesse hat, sofern diese das Wohl der Mitmenschen respektiert oder befördert.
- Die traditionelle ethische Philosophie: Der Text analysiert Deweys Kritik an der traditionellen ethischen Philosophie, die von der Annahme ausgeht, dass der Mensch ein isoliertes Wesen ist und die Moralität von der Frage abhängig macht, ob Handlungen ein egoistisches oder altruistisches Motiv als Ursache haben.
- Der Mensch als soziales Wesen: Der Text beleuchtet Deweys Argumentation, dass die Menschen soziale Wesen sind und dass die Moralität an soziale Zusammenhänge gebunden ist. Er zeigt, dass nur das Bedürfnis der Gruppe, der man angehört, das, was wichtig ist und dass nur das moralisch gut ist, was der Gemeinschaft dient oder diese befördert.
- Die Selbstverwirklichung: Der Text analysiert Deweys Argumentation, dass es eine Verantwortung für den Menschen ist, sich selbst zu verwirklichen, d.h. dass er seine Freiheit nutzt, um selbstbestimmt zu handeln und um zu bestimmen, für welche Objekte er Interesse hat, und alles dafür tut, seinen eigenen Wachstum (jedoch nicht zum Schaden anderer Menschen) zu befördern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Egoismus, Altruismus, Moralität, Selbstverwirklichung, soziale Wesen, Gemeinschaft, traditionelle ethische Philosophie, John Dewey, „The Moral Self“.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert John Dewey das Verhältnis von Egoismus und Altruismus?
Dewey lehnt die strikte Trennung ab. Er argumentiert, dass Handlungen ursprünglich weder rein egoistisch noch altruistisch sind, sondern aus einem Interesse an einem Objekt entstehen, das beide Aspekte vereinen kann.
Warum kritisiert Dewey die traditionelle ethische Philosophie?
Er kritisiert, dass sie den Menschen als isoliertes Wesen betrachtet. Für Dewey ist der Mensch ein soziales Wesen, dessen Moralität untrennbar mit der Gemeinschaft verbunden ist.
Was versteht Dewey unter "Selbstverwirklichung"?
Selbstverwirklichung bedeutet, die eigene Freiheit zu nutzen, um das eigene Wachstum zu fördern. Dies ist eine moralische Verantwortung, darf jedoch nicht zum Schaden anderer geschehen.
Kann eine egoistische Handlung moralisch gut sein?
Ja, laut Dewey kann eine Handlung moralisch wertvoll sein, auch wenn sie ein privates Interesse verfolgt, solange sie gleichzeitig das Wohl der Mitmenschen respektiert oder fördert.
Gibt es eine moralische Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern?
Ja, Dewey sieht darin eine Pflicht, da die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse negative Folgen für das Individuum und damit auch für dessen soziale Umwelt haben kann.
Welche Rolle spielt die Gemeinschaft in Deweys Ethik?
Die Gemeinschaft ist zentral: Moralisch gut ist das, was der Gruppe dient oder sie befördert. Das Individuum findet seine Bestimmung innerhalb dieser sozialen Zusammenhänge.
- Quote paper
- Christine Porath (Author), 2007, Das Verhältnis zwischen Egoismus und Altruismus in John Deweys Verständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127489