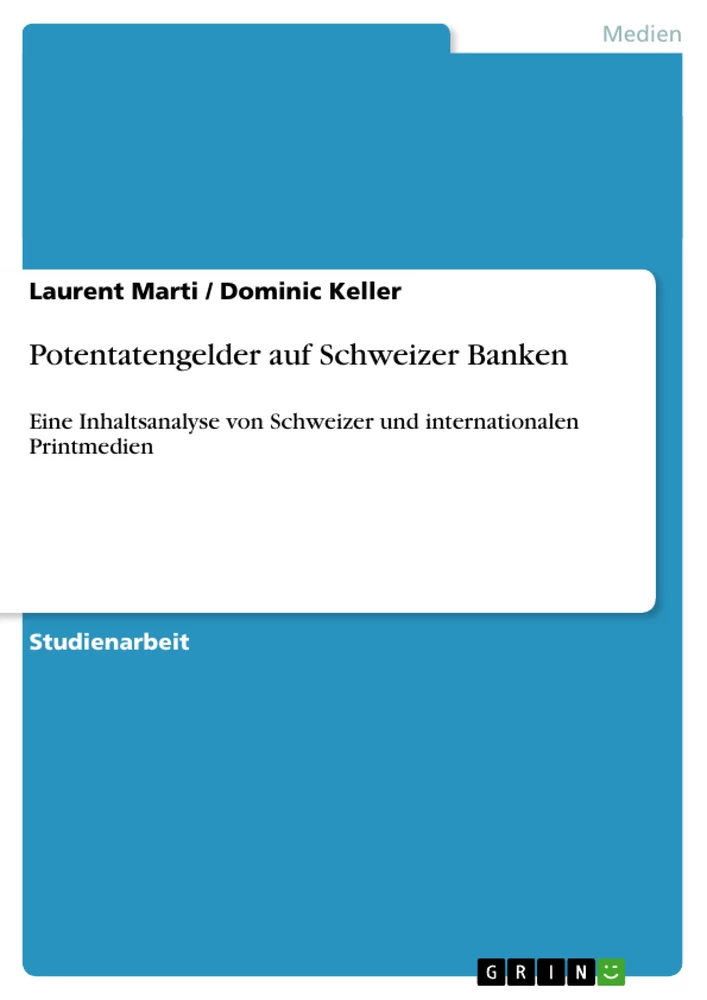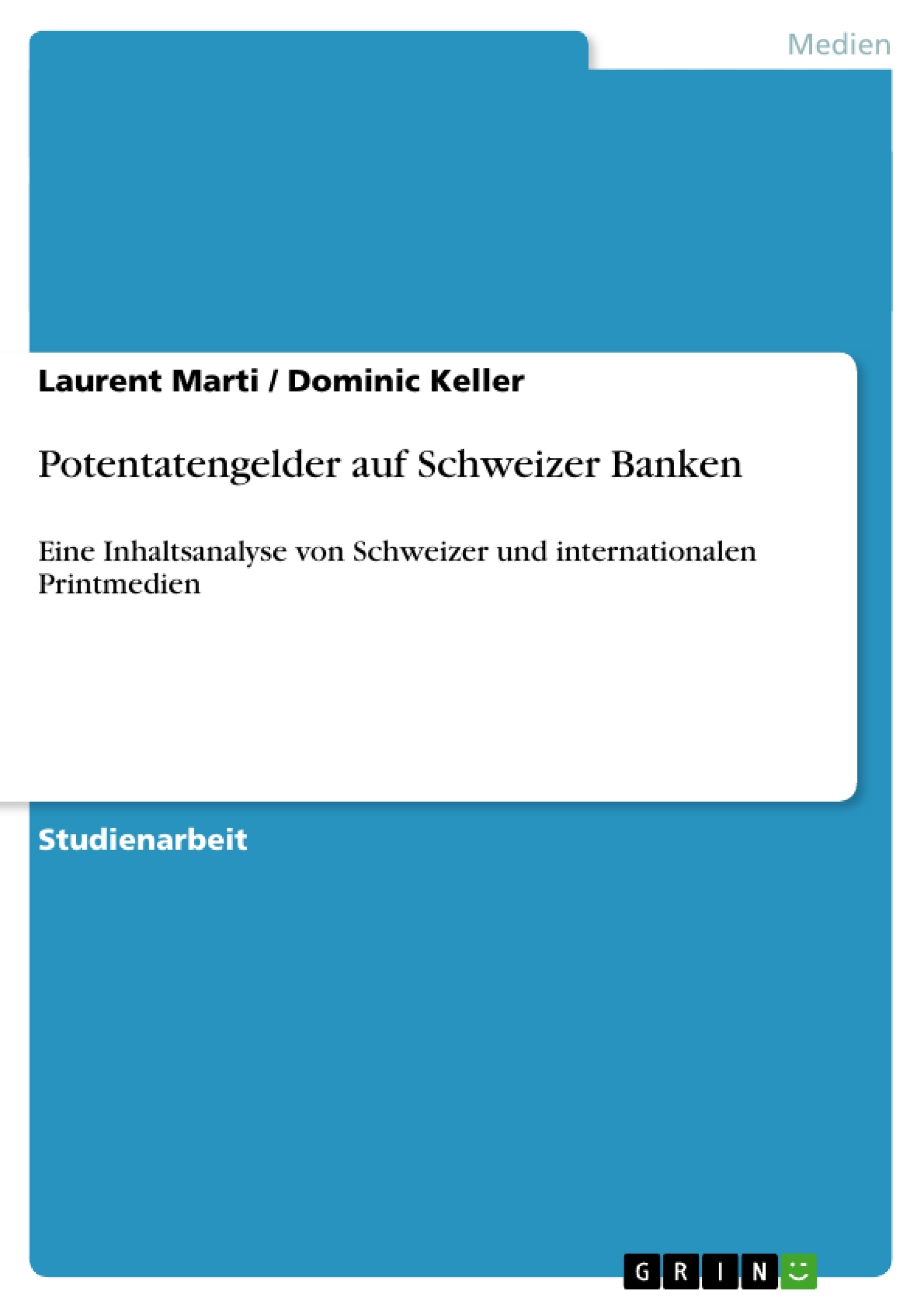Die Affären um die Potentatengelder des 1986 verstorbenen philippinischen Diktators Ferdinand Marcos und des nigerianischen Präsidenten Sani Abacha liegen mehr als 10 Jahre auseinander. In einer Inhaltsanalyse von Schweizer und internationalen Printmedien wurden die beiden Verläufe der Skandale erstmals direkt miteinander verglichen. Dies vor den Theoriegerüsten des Strukturwandels der Öffentlichkeit uns des sozialen Wandels.
Die Leithypothesen der Autoren, wonach die zunehmend nach ökonomischen Logiken operierenden Medienunternehmen eine zunehmend eigenständige, negative, personalisierte und skandalisierende Berichterstattung pflegen würden, konnte in einer ersten Grobanalyse nicht bestätigt werden. Eine vertiefte Analyse der Skandalverläufe löst den scheinbaren Wiederspruch jedoch auf und liefert eine vielschichtige und empirisch gestützte Erklärung für die zunächst ungewöhnlichen Skandalunterschiede. Dies geschieht durch die Berücksichtigung des sozialen Wandels nach Ende des kalten Krieges.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Der Begriff der Öffentlichkeit
- Strukturwandel der Öffentlichkeit
- Die Vermischung von Skandalmedium und Kritiker
- Die Personalisierung
- Die Skandalkette
- Der Wirtschaftsskandal
- Die Theorie des sozialen Wandels
- Facetten des sozialen Wandels
- Medienskandale als Indikatoren sozialen Wandels
- Potentatengelder im Kontext von These und Theorie
- Hypothesen
- Die forschungsleitende Fragestellung
- Intensitätshypothese
- Rollenbildhypothese
- Personalisierungshypothese
- Verstärkungshypothese
- Beeinflussungshypothese
- Negativitätshypothese
- Normativitätshypothese
- Specialinteresthypothese
- Regulierungshypothese
- Reputationshypothese
- Methodenteil
- Die Inhaltsanalyse
- Theoretische Grundlagen der Inhaltsanalyse
- Das Codebuch als Teil des Forschungsablaufes
- Die inhaltsanalytischen Techniken
- Operationalisierung der Hypothesen
- Intensitätshypothese
- Rollenbildhypothese
- Personalisierungshypothese
- Verstärkungshypothese
- Beeinflussungshypothese
- Negativitätshypothese
- Normativitätshypothese
- Specialinteresthypothese
- Regulierungshypothese
- Reputationshypothese
- Das Codebuch
- Samplediskussion und Problematik
- Die Planung des Samples
- Die Erhebung des Samples
- Der Inhalt des Samples
- Samplespezifische Probleme
- Die Intercoderreliabilität
- Die Inhaltsanalyse
- Empirie
- Auswertung Intensitätshypothese
- Auswertung Rollenbildhypothese
- Personalisierungshypothese
- Verstärkungshypothese
- Beeinflussungshypothese
- Negativitätshypothese
- Normativitätshypothese
- Exkurs: Das Verhalten der NZZ
- Specialinteresthypothese
- Regulierungshypothese
- Reputationshypothese
- Zusammenfassung der Auswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Fachliteratur
- Artikel & Quellenverzeichnis
- Grafiken
- Anhang
- Codebuch zu den Potentatengeldern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht die mediale Berichterstattung über Potentatengelder auf Schweizer Banken. Die Arbeit analysiert Schweizer und internationale Printmedien, um die Intensität, die Rolle der Akteure, die Personalisierung, die Verstärkung, die Beeinflussung, die Negativität, die Normativität, die Specialinteressen, die Regulierung und die Reputation im Zusammenhang mit diesen Skandalen zu beleuchten. Die Arbeit zielt darauf ab, die mediale Konstruktion dieser Skandale zu verstehen und die Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz zu analysieren.
- Die mediale Konstruktion von Skandalen
- Die Rolle der Akteure in Skandalen
- Die Auswirkungen von Skandalen auf den Finanzplatz Schweiz
- Die Bedeutung von Potentatengeldern für die Schweizer Wirtschaft
- Die Rolle der Medien in der öffentlichen Meinungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Potentatengelder auf Schweizer Banken ein und stellt den Fall Marcos als Ausgangspunkt der Untersuchung dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Bankgeheimnisses und die Rolle der Medien in der Skandalisierung dieser Thematik.
Das Theoriekapitel behandelt den Begriff der Öffentlichkeit, den Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Theorie des sozialen Wandels. Es wird erläutert, wie Medienskandale als Indikatoren sozialen Wandels betrachtet werden können und wie Potentatengelder in diesen Kontext passen.
Das Kapitel "Hypothesen" stellt die forschungsleitenden Fragestellungen und die Hypothesen vor, die im Rahmen der Inhaltsanalyse untersucht werden. Es werden verschiedene Aspekte der medialen Berichterstattung über Potentatengelder beleuchtet, wie z.B. die Intensität, die Personalisierung und die Normativität.
Der Methodenteil beschreibt die Inhaltsanalyse als Forschungsmethode und erläutert die theoretischen Grundlagen, das Codebuch und die inhaltsanalytischen Techniken. Es wird detailliert auf die Operationalisierung der Hypothesen und die Samplediskussion eingegangen.
Das Kapitel "Empirie" präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse. Es werden die einzelnen Hypothesen anhand der erhobenen Daten ausgewertet und interpretiert. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die mediale Konstruktion von Skandalen und die Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Potentatengelder, Schweizer Banken, Bankgeheimnis, Medienskandale, Inhaltsanalyse, Strukturwandel der Öffentlichkeit, soziale Veränderungen, Finanzplatz Schweiz, Reputation, Medienberichterstattung, Marcos, Abacha, Rechtshilfegesuch, PEP (politisch exponierte Persönlichkeiten).
Häufig gestellte Fragen
Was sind Potentatengelder?
Unter Potentatengeldern versteht man Vermögenswerte, die von ausländischen Herrschern oder Diktatoren (wie Ferdinand Marcos oder Sani Abacha) auf Schweizer Banken hinterlegt wurden und oft im Zusammenhang mit Korruption oder Veruntreuung stehen.
Welche Fälle werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die medialen Skandalverläufe um die Gelder des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos (verstorben 1986) und des nigerianischen Präsidenten Sani Abacha.
Welche Rolle spielen die Medien bei diesen Skandalen?
Die Medien fungieren als Akteure der Skandalisierung. Die Untersuchung analysiert, ob Medienunternehmen eine zunehmend eigenständige, negative und personalisierte Berichterstattung pflegen.
Welche theoretischen Grundlagen werden genutzt?
Die Analyse basiert auf den Theorien des Strukturwandels der Öffentlichkeit sowie des sozialen Wandels nach Ende des Kalten Krieges.
Was war das Ergebnis der Inhaltsanalyse?
Eine vertiefte Analyse löste scheinbare Widersprüche auf und zeigte, dass Unterschiede in den Skandalverläufen durch den sozialen Wandel und ökonomische Logiken der Medien erklärt werden können.
Welche Auswirkungen haben diese Skandale auf den Finanzplatz Schweiz?
Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen auf die Reputation des Finanzplatzes Schweiz und die Bedeutung des Bankgeheimnisses in der öffentlichen Wahrnehmung.
- Quote paper
- Herr Laurent Marti (Author), Dominic Keller (Author), 2003, Potentatengelder auf Schweizer Banken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127493