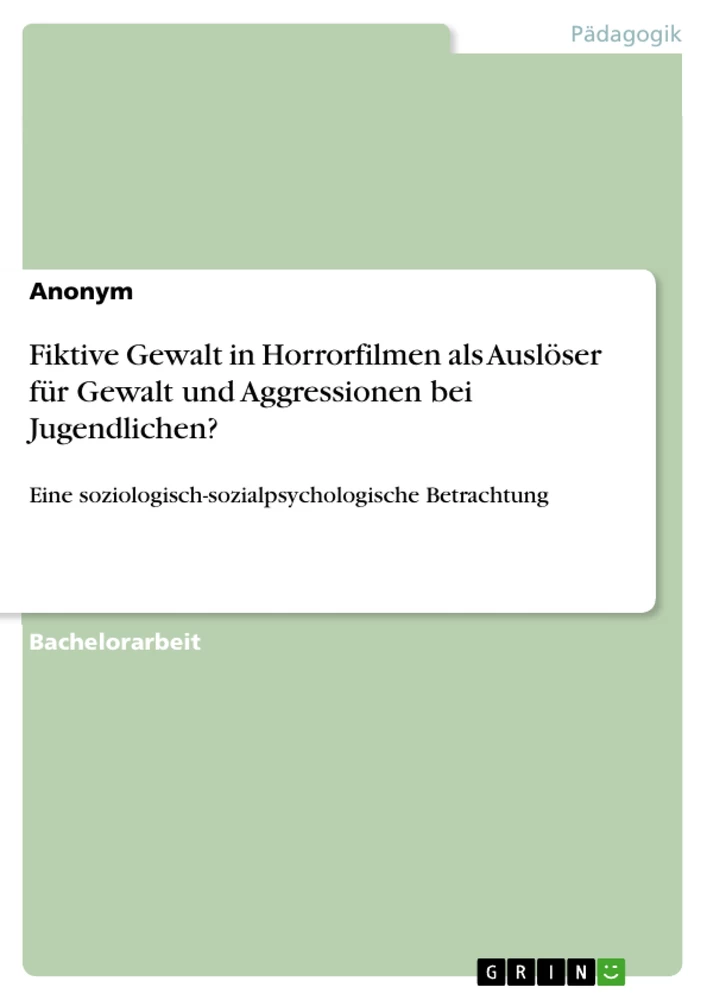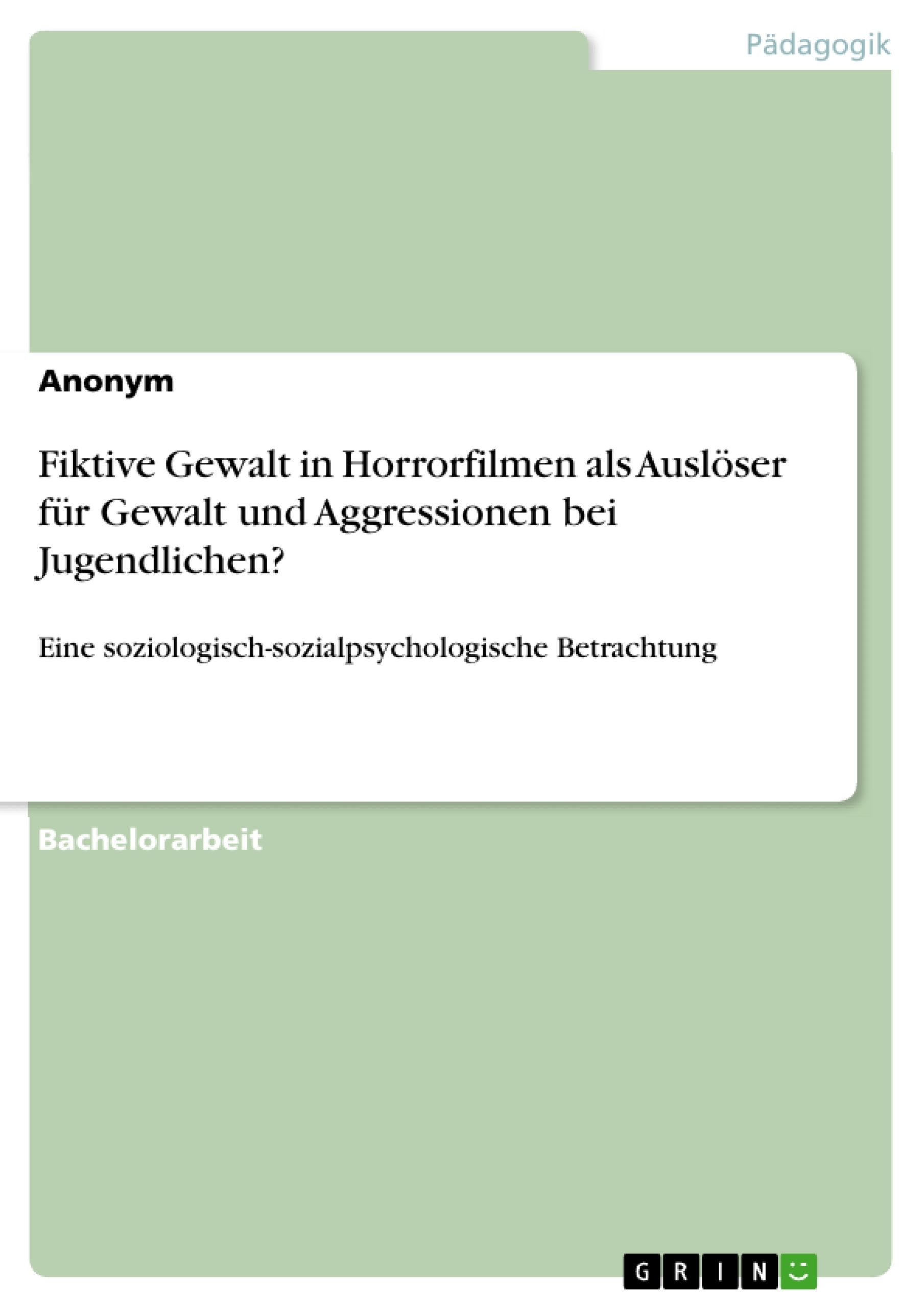Gewalt in den Medien. Ein Thema, das stark diskutiert wird und vor allem in Bezug auf Horrorfilme bei Eltern, Jugendschützern und Analytikern auf starke Kritik stößt. Dennoch fasziniert dieses Kunstgenre viele Menschen und begeistert mit Filmen, Videospielen und Musik.
Horrorfilme haben einen gesellschaftskritischen Ursprung. Sie entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts, um die Auswirkungen und Probleme einer Gesellschaft und die Folgen in extremer und erschreckender Form darzustellen.
Soziale, gesellschaftliche und politische Missstände in der Gesellschaft sollen durch Übertreibung und Zuspitzung aufgezeigt werden. Beispielsweise stützen sich liberal politische Theorien auf das Horrorgenre, um auf rhetorische Weise eine liberale Regierungsführung zu verteidigen. Zudem wird die Ausgrenzung einzelner Menschen oder ganzer Gesellschaftsgruppen sowie die Angst vor dem Fremden thematisiert. Dennoch sind Regisseure und Produzenten mit dem Vorwurf und der Angst vor negativer Beeinflussung von Aggression und Gewalt konfrontiert. Gewalt und Aggressionen haben verschiedene Auslöser, die einerseits in diesen Filmen gezeigt werden und andererseits durch diese angeregt werden können.
Mit den Jahren hatten Horrorfilme, wie „Saw“, „Freitag der 13.“, und „Scream“ mit Anschuldigungen von Kritikern zu kämpfen, dass sie Gewalt verherrlichen, die diesbezügliche Hemmschwelle senken und Jugendliche beeinflussen würden. Bis jetzt stehen Videospiele, insbesondere Ego-Shooter (ein Spieler agiert aus der Ich-Perspektive, in einem dreidimensionalen Raum, mit Schusswaffen), im Zentrum der Vorwürfe und der Analysen, da sie eine stärkere Nähe zur Gewalthandlung aufweisen.
Das Horrorgenre, vertreten sowohl in Videospielen als auch in Filmen, wird für Amokläufe und Morde, insbesondere in Form von Nachahmungstaten verantwortlich gemacht. Nachahmungstaten sind ein reales und gegenwärtiges Phänomen, dessen Untersuchung äußerst relevant ist und größtenteils auf fiktive Gewalt zurückzuführen ist. Solche Forschungen beziehen sich meist auf Videospiele, weswegen Horrorfilme meist keine große Beachtung finden und weiterhin frei zugänglich sind und im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden.
Die vorliegende Forschung dient dazu, Ursachen von Gewalt und Aggressionen im Zusammenhang mit fiktiver Gewalt in Horrorfilmen anhand eines konkreten Fallbeispiels und mithilfe von soziologisch und (sozial)-psychologischen Theorien aufzuzeigen und zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Relevanz
- 1.2 Fragestellung und Vorgehen
- 2. Fiktive Gewalt
- 2.1 Gewalt und fiktive Gewalt Definition
- 2.2 Fiktive Gewalt in Filmen, im Fernsehen und in Videospielen
- 3. Horrorfilme
- 3.1 Horrorfilme Definition und Ursprung
- 3.2 Subgenre des Horrorfilms
- 3.3 ,,Scream\" der Kulthorrorfilm
- 4. Copycat Killer
- 4.1 Copycat Killer Definition, Formen und Forschungsstand
- 4.2 Der Film „Scream\" und die Gewalttat in Gersthofen 2002
- 5. Theoretischer Rahmen und Analyse
- 5.1 Theorien zu Ursachen von Gewalt und Aggression
- 5.2 Anwendung der Desintegration- und Verunsicherungstheorie
- 5.3 Anwendung der Identitätstheorie
- 5.4 Anwendung des General Aggression Model (GAM)
- 5.5 Anwendung der sozial-kognitiven Lerntheorie
- 5.6 Diskussion und Kritik
- 6. Das Fallverstehen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Ursachen von Gewalt und Aggression im Zusammenhang mit fiktiver Gewalt am Beispiel von Horrorfilmen. Sie fokussiert sich auf den Film „Scream“ und die Gewalttat in Gersthofen 2002, um die mögliche Verbindung zwischen fiktiver Gewalt und realen Gewaltakten zu analysieren. Die Arbeit verfolgt das Ziel, anhand soziologischer und sozialpsychologischer Theorien, die möglichen Einflüsse des Films auf das reale Geschehen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Gewalt und fiktiver Gewalt
- Analyse des Horrorgenres und des Slasherfilms „Scream“
- Das Phänomen des Copycat Crimes und der Forschungsstand dazu
- Anwendung verschiedener Theorien zur Erklärung von Gewalt und Aggression
- Diskussion der möglichen Verbindung zwischen „Scream“ und der Gewalttat in Gersthofen 2002
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas und führt die Forschungsfrage ein. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff der Gewalt und der fiktiven Gewalt, wobei besonders auf die Darstellung von Gewalt in Filmen, im Fernsehen und in Videospielen eingegangen wird. Kapitel 3 beleuchtet das Genre des Horrorfilms, seine Subgenres und den Kultfilm „Scream“. In Kapitel 4 wird das Phänomen des Copycat Killers definiert und der Forschungsstand dazu präsentiert. Kapitel 5 stellt verschiedene Theorien zur Erklärung von Gewalt und Aggression vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf das Fallbeispiel von „Scream“ und der Gewalttat in Gersthofen 2002 angewendet werden.
Schlüsselwörter
Fiktive Gewalt, Horrorfilme, „Scream“, Copycat Crime, Gewalt und Aggression, Desintegration- und Verunsicherungstheorie, Identitätstheorie, General Aggression Model (GAM), sozial-kognitive Lerntheorie
Häufig gestellte Fragen
Können Horrorfilme reale Gewalt auslösen?
Die Arbeit untersucht anhand von Theorien wie dem General Aggression Model (GAM), ob fiktive Gewalt die Hemmschwelle senken und Aggressionen fördern kann.
Was ist ein "Copycat Killer"?
Ein Copycat Killer begeht Taten, die fiktive Verbrechen aus Filmen oder Medien nachahmen, wie es im Fall der Gewalttat in Gersthofen 2002 im Bezug zum Film „Scream“ vermutet wurde.
Welchen Ursprung hat das Horrorgenre?
Horrorfilme entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem gesellschaftskritischen Hintergrund, um Ängste vor dem Fremden oder soziale Missstände überspitzt darzustellen.
Was besagt die Desintegrations- und Verunsicherungstheorie?
Diese Theorie erklärt Gewalt als Folge von fehlender sozialer Einbindung und persönlicher Verunsicherung, die durch Medienkonsum verstärkt werden kann.
Warum stehen oft Videospiele stärker in der Kritik als Filme?
Videospiele wie Ego-Shooter weisen eine stärkere Nähe zur Gewalthandlung auf (Interaktivität), weshalb ihnen oft ein höheres Beeinflussungspotenzial zugeschrieben wird.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Fiktive Gewalt in Horrorfilmen als Auslöser für Gewalt und Aggressionen bei Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275415