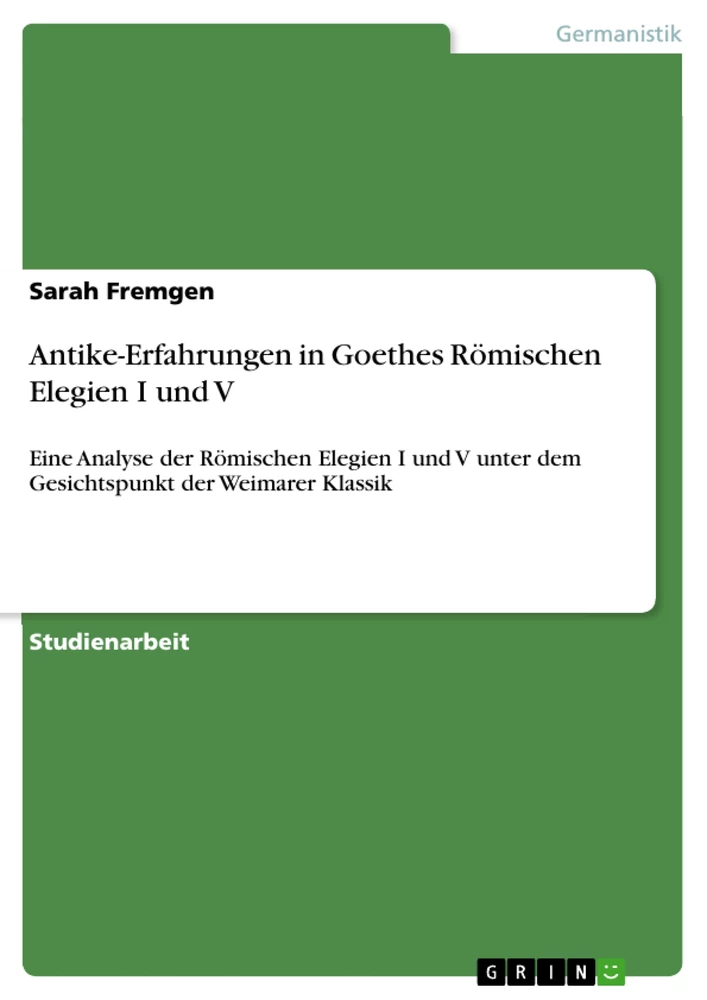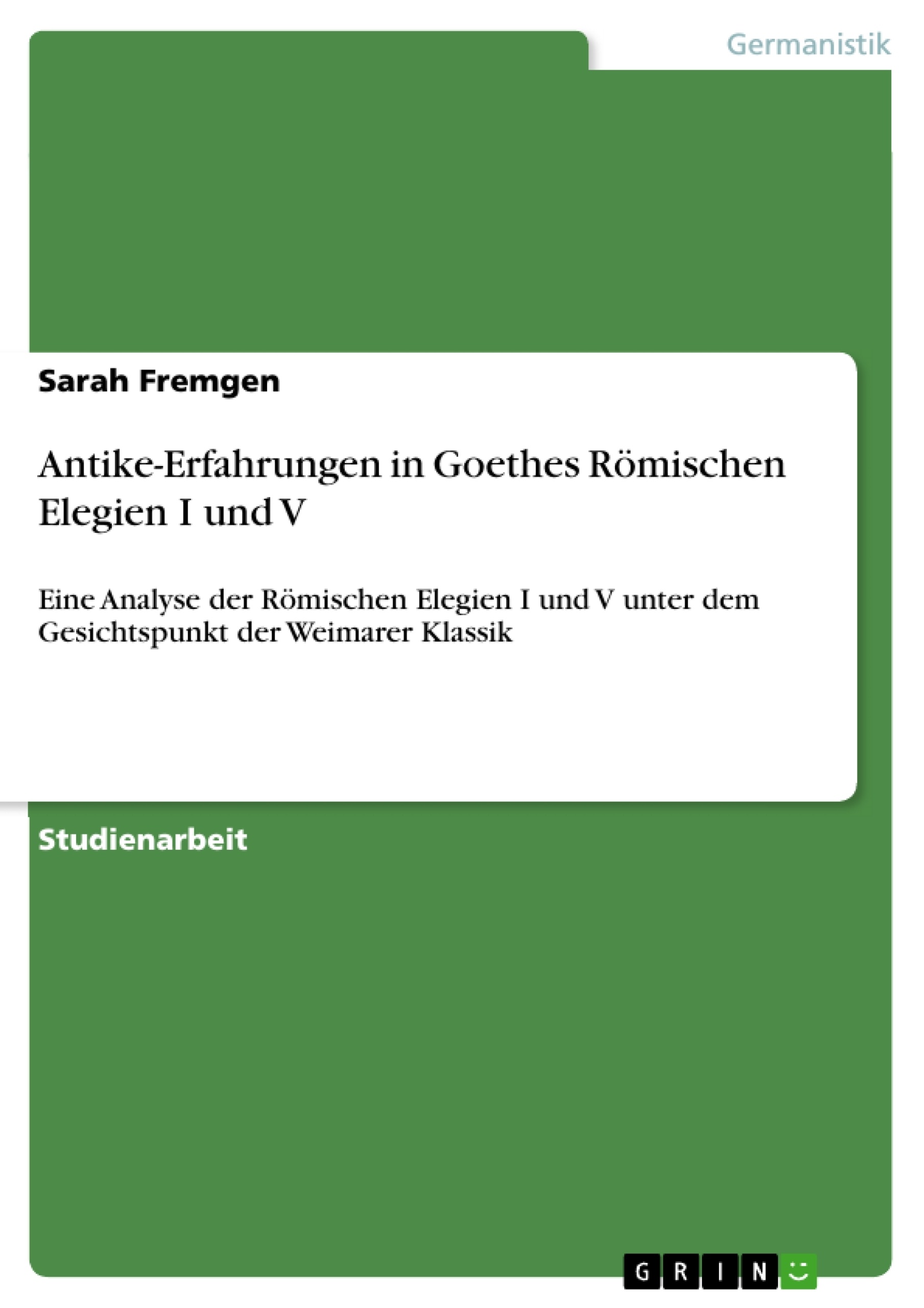Johann Wolfgang Goethe zählt zu den einflussreichsten und bekanntesten Literaten der deutschen Literaturgeschichte, wenn es sich nicht sogar um die prägendste Person in diesem Kontext seit jeher handelt. In seiner Leb- und Wirkzeit zwischen 1749 und 1832 wirkte Goethe im Kontext unterschiedlicher Epochen oder prägte diese maßgeblich mit, so sind vorwiegend Sturm und Drang und die Weimarer Klassik zu nennen. In letztere Epoche sind die zu behandelnden Gedichte Römische Elegien einzuordnen, welche von Goethe nach seiner Italienreise von 1786 bis 1788 verfasst wurden und in Friedrich Schillers Horen 1795 erstpubliziert wurden. Goethe begeisterte sowohl mit epischen, als auch mit dramatischen und lyrischen Werken gleichermaßen, wobei die vorliegenden Gedichte aufgrund ihrer Machart für große Aufregung in Weimar sorgten. Diese Aufregung resultierte aus den erotischen Darstellungen in den Römischen Elegien, weshalb auf den nachfolgenden Seiten die Erfahrungen des lyrischen Ichs mit der Antike, mit besonderem Faktor auf der Liebe, entschlüsselt werden sollen.
In der vorliegenden Hausarbeit liegt der Fokus auf den Römischen Elegien I und V, um an diesen die Wahrnehmung des lyrischen Ichs mit der Umwelt zu prüfen. Eine Betrachtung des literaturhistorischen Kontextes der Lyrik der Weimarer Klassik wird sich hierzu als Erstes auf die Begrifflichkeit und Benennung dieser Epoche fokussieren und im Anschluss die Programmatik der Weimarer Klassik behandeln. Es folgt eine stilistische Analyse der Elegien I und V, in welcher besonders die sprachliche Konzeption der Elegien herausgearbeitet wird. In diesem Kapitel erfolgt ebenso eine Betrachtung der Entstehungsgeschichte der Römischen Elegien und der metrischen Form des Elegischen Distichons. In Kapitel 4 erfolgt die Herausarbeitung antiker Motive in den Elegien sowie eine Betrachtung des Ego in der römischen Gegenwart. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird die Arbeit schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literaturhistorischer Kontext: Die Lyrik der Weimarer Klassik
- Der Begriff „Weimarer Klassik“
- Programmatik der Weimarer Klassik
- Analyse der Römischen Elegien
- Die Entstehungsgeschichte der Römischen Elegien
- Das elegische Distichon
- Die Form der Römischen Elegien I und V
- Die rhetorischen Mittel
- Antike-Erfahrungen in den Römischen Elegien I und V
- Antike Motive in den Elegien I und V
- Das Ego und die römische Gegenwart
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Goethes Römische Elegien I und V im Kontext der Weimarer Klassik. Die Arbeit analysiert die Wahrnehmung des lyrischen Ichs in Bezug auf die römische Umwelt und die darin präsenten antiken Motive. Die Zielsetzung besteht darin, die antiken Erfahrungen des lyrischen Ichs, insbesondere im Hinblick auf die Liebe, zu entschlüsseln und im literaturhistorischen Kontext zu verorten.
- Die Definition und Datierung der Weimarer Klassik
- Die Programmatik der Weimarer Klassik und ihr Bezug zur Antike
- Stilistische Analyse der Römischen Elegien I und V (Metrik, Rhetorik)
- Identifikation antiker Motive in den Elegien
- Die Darstellung des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zur römischen Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Johann Wolfgang Goethe als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen Literaturgeschichte vor und ordnet seine Römischen Elegien in den Kontext der Weimarer Klassik ein. Sie hebt die kontroverse Reaktion auf die erotischen Darstellungen der Elegien hervor und kündigt die Analyse der antiken Erfahrungen des lyrischen Ichs an, mit besonderem Fokus auf die Liebe. Die Arbeit konzentriert sich auf die Elegien I und V, um die Interaktion des lyrischen Ichs mit seiner Umgebung zu untersuchen.
Literaturhistorischer Kontext: Die Lyrik der Weimarer Klassik: Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Begriffsbestimmung und Datierung der Weimarer Klassik. Die unterschiedlichen Ansätze zur zeitlichen Eingrenzung dieser Epoche werden diskutiert, von der Dauer der Freundschaft zwischen Schiller und Goethe bis hin zum Einfluss der Französischen Revolution. Der Begriff „Klassik“ selbst wird kritisch hinterfragt, seine doppelte Bedeutung als normative und historische Kategorie wird herausgestellt. Der Einfluss des Klassizismus und die Rückbesinnung auf die Antike als Ideal werden beleuchtet. Die Etablierung des Begriffs „Weimarer Klassik“ im 19. Jahrhundert im Kontext des kulturellen Zentrums Weimar wird ebenfalls thematisiert.
Programmatik der Weimarer Klassik: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung des Klassizismus für die Weimarer Klassik und die Antike als Vorbild einer „unbewussten Kunstproduktion“. Die Arbeit von Johann Joachim Winkelmann zur wissenschaftlichen Erschließung antiker Kunst wird als wichtiger Beitrag zum Klassizismus hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Legitimation einer Rückbesinnung auf die Antike als künstlerisches und literarisches Ideal.
Schlüsselwörter
Weimarer Klassik, Römische Elegien, Goethe, Antike, Klassizismus, Lyrik, Elegisches Distichon, lyrisches Ich, Erotik, Stilanalyse, literaturhistorischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes Römischen Elegien
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Römische Elegien I und V im Kontext der Weimarer Klassik. Der Fokus liegt auf der Analyse der Wahrnehmung des lyrischen Ichs in Bezug auf die römische Umwelt und die darin präsenten antiken Motive. Die Arbeit untersucht die antiken Erfahrungen des lyrischen Ichs, insbesondere im Hinblick auf die Liebe, und verortet diese im literaturhistorischen Kontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition und Datierung der Weimarer Klassik, die Programmatik der Weimarer Klassik und ihr Bezug zur Antike, stilistische Analyse der Römischen Elegien I und V (Metrik, Rhetorik), Identifikation antiker Motive in den Elegien, und die Darstellung des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zur römischen Gegenwart.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Literaturhistorischer Kontext: Die Lyrik der Weimarer Klassik (inkl. Der Begriff „Weimarer Klassik“ und Programmatik der Weimarer Klassik), Analyse der Römischen Elegien (inkl. Entstehungsgeschichte, elegisches Distichon, Form der Elegien I und V, und rhetorische Mittel), Antike-Erfahrungen in den Römischen Elegien I und V (inkl. Antike Motive und Das Ego und die römische Gegenwart), und Zusammenfassung der Ergebnisse.
Wie wird die Weimarer Klassik in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Begriffsbestimmung und Datierung der Weimarer Klassik, diskutiert unterschiedliche Ansätze zur zeitlichen Eingrenzung dieser Epoche und hinterfragt den Begriff „Klassik“ kritisch. Sie untersucht den Einfluss des Klassizismus und die Rückbesinnung auf die Antike als Ideal sowie die Etablierung des Begriffs „Weimarer Klassik“ im 19. Jahrhundert.
Welche Rolle spielt die Antike in Goethes Römischen Elegien?
Die Arbeit analysiert die antiken Motive in den Elegien I und V und untersucht, wie das lyrische Ich diese Motive in seiner Wahrnehmung der römischen Umwelt verarbeitet. Der Einfluss der Antike auf die Gestaltung der Elegien und die Darstellung des lyrischen Ichs wird detailliert untersucht.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methode, die stilistische Analyse (Metrik, Rhetorik), Motiv- und Themenanalyse sowie eine Kontextualisierung im Rahmen der Weimarer Klassik umfasst. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation der Texte und ihre Einordnung in den historischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weimarer Klassik, Römische Elegien, Goethe, Antike, Klassizismus, Lyrik, Elegisches Distichon, lyrisches Ich, Erotik, Stilanalyse, literaturhistorischer Kontext.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung stellt Goethe und seine Römischen Elegien vor und ordnet sie in den Kontext der Weimarer Klassik ein. Sie hebt die kontroverse Reaktion auf die erotischen Darstellungen hervor und kündigt die Analyse der antiken Erfahrungen des lyrischen Ichs an, mit besonderem Fokus auf die Liebe. Die Arbeit konzentriert sich auf die Elegien I und V, um die Interaktion des lyrischen Ichs mit seiner Umgebung zu untersuchen.
Was wird im Kapitel "Literaturhistorischer Kontext" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Begriffsbestimmung und Datierung der Weimarer Klassik, diskutiert unterschiedliche zeitliche Eingrenzungen und hinterfragt den Begriff "Klassik" kritisch. Es beleuchtet den Einfluss des Klassizismus und die Rückbesinnung auf die Antike als Ideal, sowie die Etablierung des Begriffs "Weimarer Klassik" im 19. Jahrhundert.
Was wird im Kapitel "Programmatik der Weimarer Klassik" behandelt?
Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung des Klassizismus für die Weimarer Klassik und die Antike als Vorbild. Die Arbeit von Johann Joachim Winkelmann wird als wichtiger Beitrag zum Klassizismus hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Legitimation einer Rückbesinnung auf die Antike als künstlerisches und literarisches Ideal.
- Citar trabajo
- Sarah Fremgen (Autor), 2022, Antike-Erfahrungen in Goethes Römischen Elegien I und V, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1276165