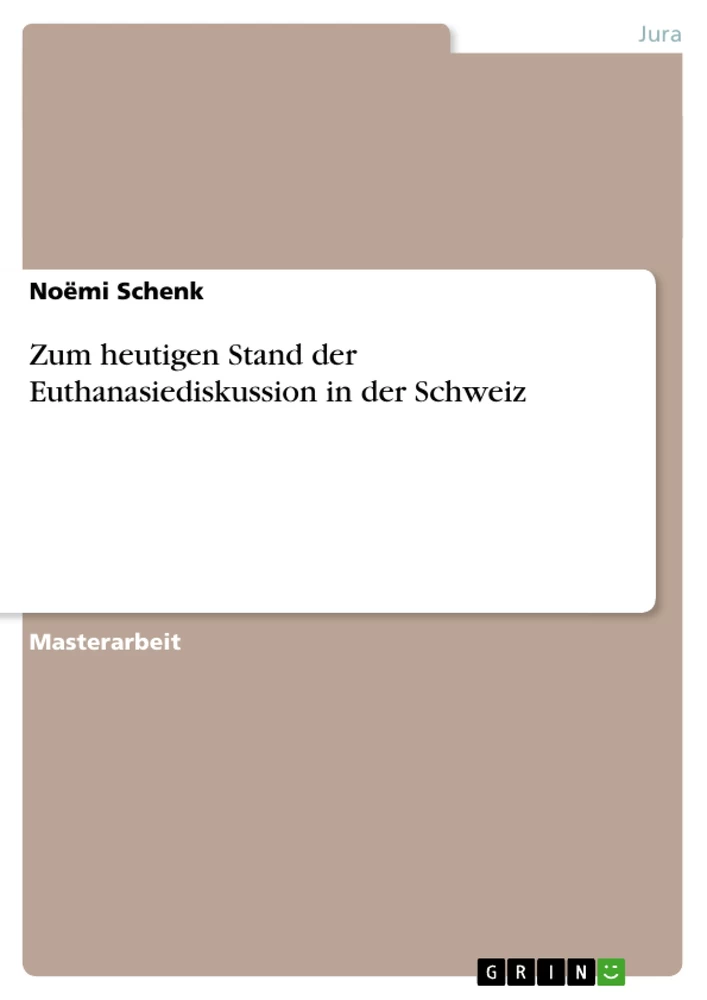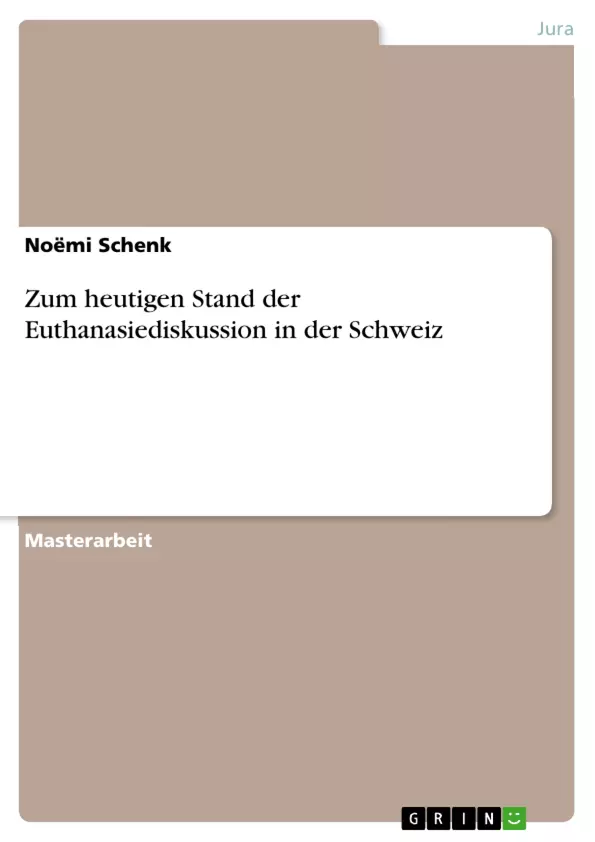Einfach eines Tages nicht mehr aufzuwachen, plötzlich tot umzufallen, ohne Schmerzen, ohne kräftezehrende Krankheit, ohne zu leiden. So stellen sich viele Leute ihren eigenen Tod vor. Hoffen und bangen, sie würden nicht zu denen gehören, die alleine und verlassen, von Alter und Krankheit gezeichnet, von übereifrigen Ärzten weit über das Sinnvolle am Leben erhalten, der Apparatemedizin zum Opfer gefallen, längst mit dem Leben abgeschlossen, einen künstlich verlängerten Sterbeprozess ausharrend, endlich durch den so lange ersehnten Tod erlöst werden. Aller Hoffnung zum trotz sterben heutzutage in der westlichen Welt die wenigsten Menschen in ihrem eigenen Bett, zu hause, in Geborgenheit. Eine veränderte Gesellschaft und Spitzenleistungen der Medizin haben dazu geführt, dass die Menschen immer älter werden. Doch meist wird nicht nur das Leben verlängert, sondern auch das Sterben. Es scheint nicht mehr erlaubt zu sein, von dieser Welt zu scheiden, ohne dass nicht das Letztmögliche, das Aussergewöhnlichste noch versucht worden wäre um der Allmacht des Todes zu entrinnen. Wen wundert es, dass der Ruf nach einem humanen Sterben auf offene Ohren stösst, ja bald von überallher widerhallt; dass in Zeiten immer grösserer Individualisierung das Selbstbestimmungsrecht auch über den eigenen Tod eingefordert wird; dass in einer Welt, in der nicht mehr gewartet sondern alles geplant wird und nach straffem Zeitplan abläuft, auch das Warten auf den Tod unerträglich wird; dass da wo es nicht mehr möglich ist das Leben zu ‚machen’, nun der Tod ‚gemacht’ werden soll. Der Schrei nach dem „schönen Tod“ scheint natürliche Konsequenz jenes Aktivismus zu sein, der die unbedingte Lebensverlängerung zu seiner eigenen Maxime erhoben hat.
In der vorliegenden Arbeit soll diesem Mythos nach dem „schönen Tod“ nachgegangen werden und dieser mit dem Tatsächlichen, Wünschenswerten und Machbaren verglichen werden. Dabei spielen unterschiedlichste Gesichtspunkte eine Rolle. Die Euthanasie beschäftigt keineswegs nur den Gesetzgeber und die Richter, Menschen, die sterben wollen aber nicht können, ihre Angehörigen, Bekannten, Pfleger und Ärzte sondern auch die Kirche, die Philosophen, ja die Gesellschaft als Ganzes und jeden Einzelnen zugleich. Manche weniger und manche mehr, doch für einen Grundkonsens über das Ende unseres irdischen Daseins braucht es alle. Denn irgendwann ist für jeden die Zeit gekommen mit seinem Leben abzuschliessen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Relevante Rechtsquellen und Stand der Diskussion
- 1. Exkurs: Begriffsklärung und Definition
- a) Euthanasie
- b) Beihilfe zum Suizid
- c) Passive Sterbehilfe
- d) Indirekte Aktive Sterbehilfe
- e) Direkte Aktive Sterbehilfe
- 2. Juristische Einordnung
- a) Verfassungsrechtlicher Grundrechtsschutz
- i) Art. 10 Abs. 1 BV: Recht auf Leben
- ii) Art. 10 Abs. 2 BV: Recht auf persönliche Freiheit
- aa. Umfang
- bb. Eingriffe
- cc. Passive und indirekte aktive Sterbehilfe
- dd. Aktive Sterbehilfe
- iii) Art. 13 Abs. 1 BV: Schutz des Privat- und Familienlebens
- b) Europäischer Grundrechtsschutz
- i) Art. 2 EMRK: Recht auf Leben
- ii) Art. 8 EMRK: Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
- aa. Umfang
- bb. Legitimität eines Eingriffs
- cc. Interessenabwägung zwischen zwei Grundrechten
- dd. Privatsphäre Dritter
- ee. EGMR und Europarat
- c) Strafgesetzbuch und standesrechtliche Regelungen
- i) Geschichtlicher Abriss
- ii) aktuelle Rechtslage
- aa. Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord
- bb. Passive Sterbehilfe
- cc. Indirekte Aktive Sterbehilfe
- dd. Direkte Aktive Sterbehilfe
- d) Privatrecht
- e) Verwaltungsrecht
- f) Zwischenfazit
- a) Verfassungsrechtlicher Grundrechtsschutz
- 1. Exkurs: Begriffsklärung und Definition
- III. Weitere Relevante Gesichtspunkte
- 1. Theologie
- 2. Philosophie
- a) Ethik
- i) Unterschiedliche Schulen
- ii) Selbstbestimmung / Autonomie
- iii) Kategorien
- iv) Leiden / Lebensqualität
- v) Handeln – Unterlassen
- vi) Töten – Sterbenlassen
- vii) Bringt aktive Sterbehilfe Verachtung für das Leben zum Ausdruck?
- viii) Assistierter Suizid – aktive Sterbehilfe
- b) Moral
- a) Ethik
- 3. „Gesellschaftspolitische“ Argumente und Gesichtspunkte
- a) Rationalität des Sterbewunsches
- b) Dammbruchargument
- c) Finanzielle Aspekte
- d) Gesellschaftlicher und familiärer Druck
- e) Arzt-Patienten-Verhältnis
- f) Steuerungsfähigkeit des Rechts
- 4. Zwischenfazit
- IV. Ausgewählte Einzelprobleme der rechtlichen Regelung
- 1. Menschenwürde
- 2. Urteilsfähigkeit
- a) Mündig und urteilsfähig
- b) Unmündig oder entmündigt aber urteilsfähig
- c) Urteilsunfähig
- d) Exkurs: Rechtsverbindlichkeit und Aussagekraft einer Patientenverfügung
- e) Erörterung des mutmasslichen Willens
- f) Ist Urteilsfähigkeit unbedingte Voraussetzung für Sterbehilfe?
- 3. Problematik der Sterbehilfeorganisationen
- a) Die Schweizer Sterbehilfeorganisationen und ihre Dienstleistungen
- b) Die Vorgehensweise bei einem assistierten Suizid
- c) Suizid in Züricher Pflege- und Altersheimen
- d) Die Problematik
- e) Überlegungen zu einer Neuregelung
- 4. Verfahrensfragen
- a) Staatliche Aufsicht
- b) Wille des Patienten
- c) Zweiter Arzt oder Experte
- d) Alternativen
- e) Leiden
- f) Spezielles Verfahren für aktive Sterbehilfe
- 5. Todeskausalität
- 6. Bedeutung und Stand der Palliative Care
- V. Berühmt-bewegende Einzelfälle
- 1. Falldarstellungen
- a) Ramón Sampedro
- b) Vincent Humbert
- c) Terri Schiavo
- d) Doppelter Schlaganfall
- e) Diane Pretty
- 2. Diskussion
- 1. Falldarstellungen
- VI. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert den aktuellen Stand der Euthanasiediskussion in der Schweiz. Ziel ist es, einen interdisziplinären Beitrag zu leisten, indem die rechtliche Situation, ethische, moralische, gesellschaftliche und theologische Aspekte beleuchtet werden. Die Arbeit soll zu einer zukunftsweisenden Regelung beitragen, ohne eine fertige Lösung zu präsentieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Euthanasie in der Schweiz
- Ethische und moralische Aspekte der Sterbehilfe
- Gesellschaftliche Debatte und relevante Argumente
- Die Rolle von Sterbehilfeorganisationen
- Mögliche Verbesserungen der rechtlichen Regelung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die gesellschaftliche Relevanz der Euthanasiediskussion dar, indem sie den Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben mit dem medizinischen Fortschritt und dem verlängerten Sterbeprozess kontrastiert. Der Mythos des "schönen Todes" wird hinterfragt und die Notwendigkeit eines interdisziplinären Diskurses betont. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und ihre Zielsetzung, die darin besteht, einen Beitrag zur aktuellen Debatte zu liefern und nicht, eine fertige Lösung vorzuschlagen.
II. Relevante Rechtsquellen und Stand der Diskussion: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die relevanten Rechtsquellen, beginnend mit einer Begriffsklärung von verschiedenen Arten der Sterbehilfe (Euthanasie, Beihilfe zum Suizid, passive, indirekte und direkte aktive Sterbehilfe). Es analysiert den verfassungsrechtlichen und europäischen Grundrechtsschutz (Recht auf Leben, persönliche Freiheit, Schutz des Privatlebens), die aktuelle Rechtslage im Schweizer Strafgesetzbuch, standesrechtliche Regelungen und die Aspekte des Privat- und Verwaltungsrechts. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit, welches die Unsicherheit der aktuellen Rechtslage im Umgang mit Euthanasie hervorhebt.
III. Weitere Relevante Gesichtspunkte: Dieser Abschnitt untersucht die theologischen, philosophischen und gesellschaftlichen Perspektiven auf die Sterbehilfe. Es werden die Positionen der katholischen und protestantischen Kirchen dargestellt und verschiedene ethische Schulen (deontologische, utilitaristische) verglichen. Die Rolle von Leid und Lebensqualität, sowie die Problematik der Unterscheidung zwischen Handeln und Unterlassen, Töten und Sterbenlassen werden ausführlich diskutiert. Die gesellschaftlichen Argumente (Rationalität des Sterbewunsches, Dammbruchargument, finanzielle Aspekte, gesellschaftlicher Druck, Arzt-Patienten-Verhältnis, Steuerungsfähigkeit des Rechts) werden kritisch beleuchtet und gewichtet. Ein Zwischenfazit fasst die gegensätzlichen Positionen und die Notwendigkeit eines offenen Diskurses zusammen.
IV. Ausgewählte Einzelprobleme der rechtlichen Regelung: Dieses Kapitel befasst sich mit spezifischen rechtlichen Problemen. Es analysiert die Bedeutung der Menschenwürde im Kontext von Sterbehilfe und diskutiert die Rolle der Urteilsfähigkeit bei der Entscheidungsfindung. Die Rechtsverbindlichkeit und Aussagekraft von Patientenverfügungen werden kritisch beleuchtet, sowie die Erörterung des mutmaßlichen Willens bei urteilsunfähigen Patienten. Die Problematik von Sterbehilfeorganisationen wird in Bezug auf ihre Vorgehensweise und die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Fragen untersucht. Das Kapitel stellt verschiedene Überlegungen zu einer Neuregelung vor, einschließlich der staatlichen Aufsicht, Verfahrensfragen und dem Umgang mit der Todeskausalität. Es schließt mit einer Diskussion der Bedeutung und des aktuellen Stands der Palliative Care.
V. Berühmt-bewegende Einzelfälle: Das Kapitel präsentiert und analysiert fünf bekannte Fälle von Sterbehilfe und Suizid (Ramón Sampedro, Vincent Humbert, Terri Schiavo, Doppelter Schlaganfall, Diane Pretty), um die Komplexität und Emotionalität des Themas zu verdeutlichen. Die Diskussion dieser Fälle veranschaulicht die Grenzen des aktuellen Rechts und die Notwendigkeit einer klaren und gerechten Regelung.
Schlüsselwörter
Euthanasie, Sterbehilfe, assistierter Suizid, passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, Recht auf Leben, Selbstbestimmung, Autonomie, Menschenwürde, Palliative Care, Rechtsquellen, Strafrecht, Verfassungsrecht, EMRK, Sterbehilfeorganisationen, gesellschaftliche Debatte, ethische Dilemmata, Urteilsfähigkeit, Patientenverfügung, Todeskausalität, gesetzliche Regelung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Euthanasie in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert die aktuelle Diskussion um Euthanasie in der Schweiz. Sie beleuchtet die rechtlichen, ethischen, moralischen, gesellschaftlichen und theologischen Aspekte und strebt einen interdisziplinären Beitrag an, ohne jedoch eine fertige Lösungsvorschrift zu präsentieren.
Welche Arten der Sterbehilfe werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Euthanasie, Beihilfe zum Suizid, passiver Sterbehilfe, indirekter aktiver Sterbehilfe und direkter aktiver Sterbehilfe. Diese Begriffe werden im Detail geklärt.
Welche Rechtsquellen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht relevante Rechtsquellen, darunter das Schweizerische Bundesverfassungsrecht (insbesondere Art. 10 und 13 BV), das Europäische Recht (EMRK, Art. 2 und 8), das Schweizerische Strafgesetzbuch, standesrechtliche Regelungen sowie Aspekte des Privat- und Verwaltungsrechts.
Welche ethischen und moralischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene ethische Schulen (deontologisch, utilitaristisch), diskutiert die Bedeutung von Selbstbestimmung/Autonomie, Leid/Lebensqualität, die Unterscheidung zwischen Handeln/Unterlassen und Töten/Sterbenlassen. Die Frage, ob aktive Sterbehilfe Verachtung für das Leben ausdrückt, wird ebenfalls behandelt.
Welche gesellschaftlichen Argumente werden betrachtet?
Die gesellschaftliche Debatte wird unter Berücksichtigung der Rationalität des Sterbewunsches, des Dammbrucharguments, finanzieller Aspekte, gesellschaftlichen und familiären Drucks, des Arzt-Patienten-Verhältnisses und der Steuerungsfähigkeit des Rechts beleuchtet.
Welche Einzelprobleme der rechtlichen Regelung werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Menschenwürde, die Rolle der Urteilsfähigkeit (inkl. Patientenverfügungen und mutmaßlicher Wille), die Problematik von Sterbehilfeorganisationen, Verfahrensfragen (staatliche Aufsicht, zweite Meinung, etc.), Todeskausalität und den Stand der Palliativmedizin.
Welche Einzelfälle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert die Fälle von Ramón Sampedro, Vincent Humbert, Terri Schiavo, einem Fall mit doppeltem Schlaganfall und Diane Pretty, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Beitrag zur aktuellen Debatte zu leisten und mögliche Verbesserungen der rechtlichen Regelung aufzuzeigen, ohne eine definitive Lösung vorzuschlagen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Euthanasie, Sterbehilfe, assistierter Suizid, passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, Recht auf Leben, Selbstbestimmung, Autonomie, Menschenwürde, Palliative Care, Rechtsquellen, Strafrecht, Verfassungsrecht, EMRK, Sterbehilfeorganisationen, gesellschaftliche Debatte, ethische Dilemmata, Urteilsfähigkeit, Patientenverfügung, Todeskausalität, gesetzliche Regelung.
- Quote paper
- Noëmi Schenk (Author), 2005, Zum heutigen Stand der Euthanasiediskussion in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127619