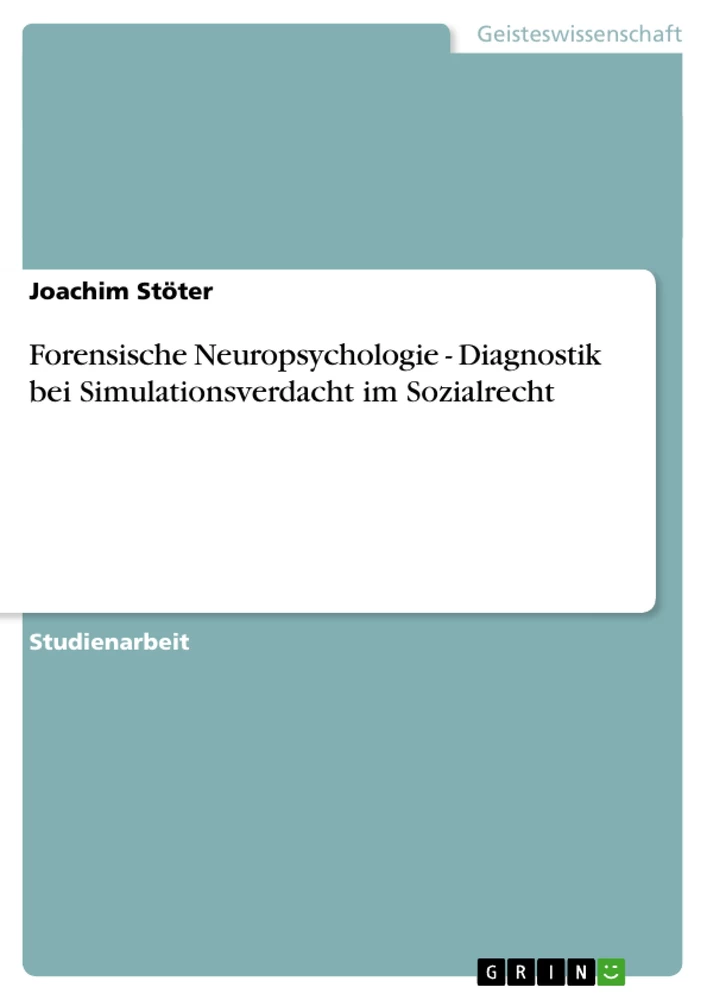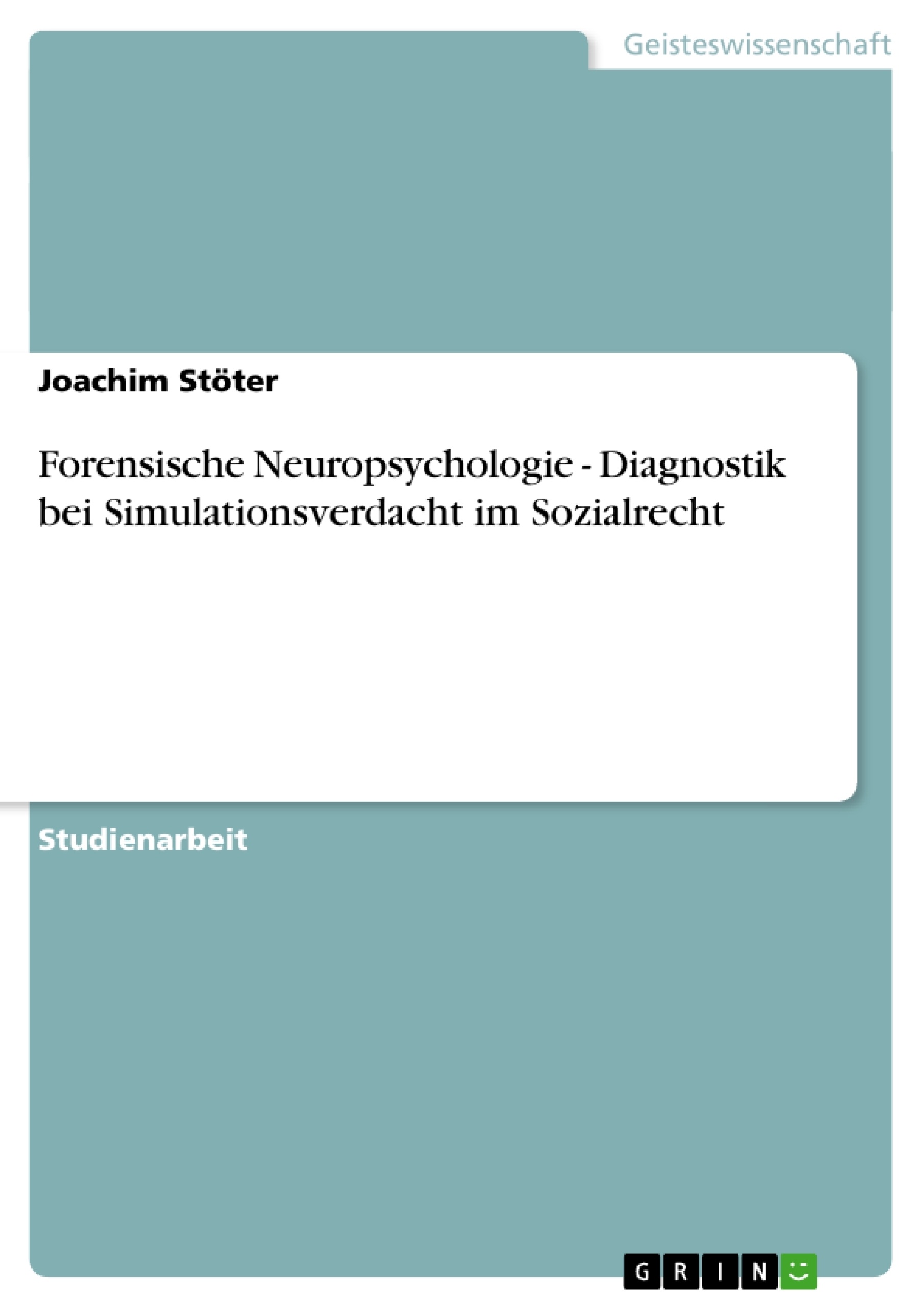In Zeiten knapper Gelder kommt es durchaus vor, dass ein Leiden, welches die Inanspruchnahme von Schadensersatzleistungen erlaubt, simuliert oder sonst wie verstärkt dargestellt wird. Dieser Verdacht muss sich natürlich auf sichere Fakten stützen, will man nicht den Falschen der Simulation bezichtigen.
Henry Miller war es, der, basierend auf Beobachtungen bei 4000 Patienten (vgl. „Clinical Assessment of Mailingering and Deception“, 1997, S. 223) feststellte, dass die Leiden der Personen erst nachließen, wenn sie eine Entschädigung von einem Gericht zugesprochen bekommen hatten. Er nannte dies zunächst zwar Kompensationsneurose, doch war dies im Grunde der erste Anstoß zur genaueren Untersuchung dessen, was wir heute als Simulation verstehen.
Seine Ausführungen wurden unterstützt von einigen Klinikern, die bei Patienten mit Hirnverletzungen ähnliches festgestellt hatten. Selbstverständlich muss man seine Ansätze kritisch betrachten, denn, so führte Binder 1986 aus, es gibt durchaus Patienten mit Kopfverletzungen, die auch nach einer finanziellen Kompensation ein Leiden haben (vgl. „Clinical Assessment of Mailingering and Deception“, 1997, S. 224).
Die Ergebnisse der Neuropsychologie, die immer mehr Einzug in die Gerichte fanden, zeigten, dass geringfügige Hirnschädigungen durchaus zu kognitiven Problemen führen können, diese aber in der Regel nach knapp 3 Monaten zurückgehen. Auch wenn es durchaus einzelne Personen gibt, deren Leiden wirklich länger dauert, so ist hier eine Gefahr des Missbrauchs durch Personen, die auf Entschädigungen hoffen.
Dies wird durch eine auf Binder und Rohling zurückgehende Meta-Analyse gestützt, die finanziellem Anreiz eine signifikante Rolle bei Invalidität bei leichten Schädeltraumata nachweist (vgl. „Clinical Assessment of Mailingering and Deception“, 1997, S. 224).
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Historische Hintergründe und Definition:
- 2.) Methodische Ansätze zur Unterscheidung von „Simulanten“ und „Nicht-Simulanten“:
- 3.) Zentrale Ergebnisse:
- 4.) Ansätze zum Erkennen von Simulationen:
- 5.) „Schwellenmodell“:
- 6.) Fazit:
- 7.) Literaturverzeichnis:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der forensischen Neuropsychologie und der Diagnostik von Simulationsverdacht im Sozialrecht. Sie analysiert die historischen Hintergründe und Definitionen von Simulation, Dissimulation und Aggravation, um die Problematik der Unterscheidung zwischen tatsächlichen und simulierten neuropsychologischen Defiziten zu beleuchten. Die Arbeit untersucht verschiedene methodische Ansätze zur Unterscheidung von Simulanten und Nicht-Simulanten, beleuchtet die zentralen Ergebnisse der Forschung und präsentiert Ansätze zum Erkennen von Simulationen, einschließlich des „Schwellenmodells“.
- Historische Hintergründe und Definition von Simulation, Dissimulation und Aggravation
- Methodische Ansätze zur Unterscheidung von Simulanten und Nicht-Simulanten
- Zentrale Ergebnisse der Forschung zur Simulation im Sozialrecht
- Ansätze zum Erkennen von Simulationen
- Das „Schwellenmodell“ als diagnostisches Instrument
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Historische Hintergründe und Definition:
Das Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe und Definitionen von Simulation, Dissimulation und Aggravation im Kontext des Sozialrechts. Es wird die Problematik der Unterscheidung zwischen tatsächlichen und simulierten neuropsychologischen Defiziten aufgezeigt und die Bedeutung der sicheren Faktenlage für die Diagnose von Simulationsverdacht betont.
2.) Methodische Ansätze zur Unterscheidung von „Simulanten“ und „Nicht-Simulanten“:
Dieses Kapitel analysiert verschiedene methodische Ansätze zur Unterscheidung von Simulanten und Nicht-Simulanten. Es werden die Vor- und Nachteile von Simulationsdesigns und dem Vergleich bekannter Gruppen diskutiert. Die Problematik der Auswahl von Probanden und Messmethoden wird beleuchtet und die Bedeutung der Standardabweichung, der Variabilität bei Test-Retest-Unterschieden und der Streuung in Subtests für die Diagnose von Simulationen hervorgehoben.
3.) Zentrale Ergebnisse:
Das Kapitel präsentiert die zentralen Ergebnisse der Forschung zur Simulation im Sozialrecht. Es wird die Bedeutung der Standardverfahren der Neuropsychologie für die Diagnose von Simulationen diskutiert und die Schwierigkeit, Simulanten anhand von Daten zu identifizieren, aufgezeigt. Die Ergebnisse von Studien, die die Fähigkeit von Neuropsychologen zur Erkennung von Simulationen untersuchten, werden vorgestellt.
4.) Ansätze zum Erkennen von Simulationen:
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zum Erkennen von Simulationen. Es werden die Kriterien von Greiffenstein, Baker und Gola vorgestellt, die als Quasi-Ausschlusskriterien für Simulationsverdacht dienen können. Die Problematik der Zirkularität der Erklärung und Definition und damit der Falscheinschätzung wird diskutiert.
5.) „Schwellenmodell“:
Das Kapitel stellt das „Schwellenmodell“ als diagnostisches Instrument zur Erkennung von Simulationen vor. Es wird die Bedeutung der Unterscheidung zwischen tatsächlichen und simulierten neuropsychologischen Defiziten für die Anwendung des Modells erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die forensische Neuropsychologie, die Diagnostik von Simulationsverdacht, das Sozialrecht, Simulation, Dissimulation, Aggravation, methodische Ansätze, Standardverfahren, Test-Retest-Unterschiede, Standardabweichung, Streuung in Subtests, „Schwellenmodell“, Zirkularität der Erklärung und Definition, Falscheinschätzung, neuropsychologische Defizite, tatsächliche und simulierte Defizite, sichere Faktenlage, Forschungsergebnisse, Studien, Kriterien, Quasi-Ausschlusskriterien, diagnostisches Instrument.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Simulation in der Neuropsychologie?
Simulation bezeichnet das bewusste Vortäuschen oder Übertreiben von geistigen oder körperlichen Leiden, meist um finanzielle Entschädigungen im Sozialrecht zu erhalten.
Wie erkennt man neuropsychologische Simulation?
Neuropsychologen nutzen Tests auf Anstrengungsbereitschaft, analysieren die Konsistenz der Testergebnisse und vergleichen die gezeigten Defizite mit bekannten Krankheitsbildern.
Was ist das „Schwellenmodell“?
Das Schwellenmodell ist ein diagnostisches Instrument, das hilft zu entscheiden, ab welcher Abweichung in Testergebnissen ein begründeter Verdacht auf Simulation vorliegt.
Was unterscheidet Aggravation von Simulation?
Bei der Aggravation ist ein tatsächliches Leiden vorhanden, wird aber vom Patienten schlimmer dargestellt, als es objektiv ist. Simulation ist das reine Erfinden von Symptomen.
Können leichte Hirnschäden dauerhafte Defizite verursachen?
In der Regel bilden sich kognitive Probleme nach leichten Schädeltraumata innerhalb von drei Monaten zurück. Dauerhafte Beschwerden ohne organischen Befund erfordern eine genaue Prüfung auf finanzielle Anreize.
- Quote paper
- Dipl.-Psych. Joachim Stöter (Author), 2004, Forensische Neuropsychologie - Diagnostik bei Simulationsverdacht im Sozialrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127710