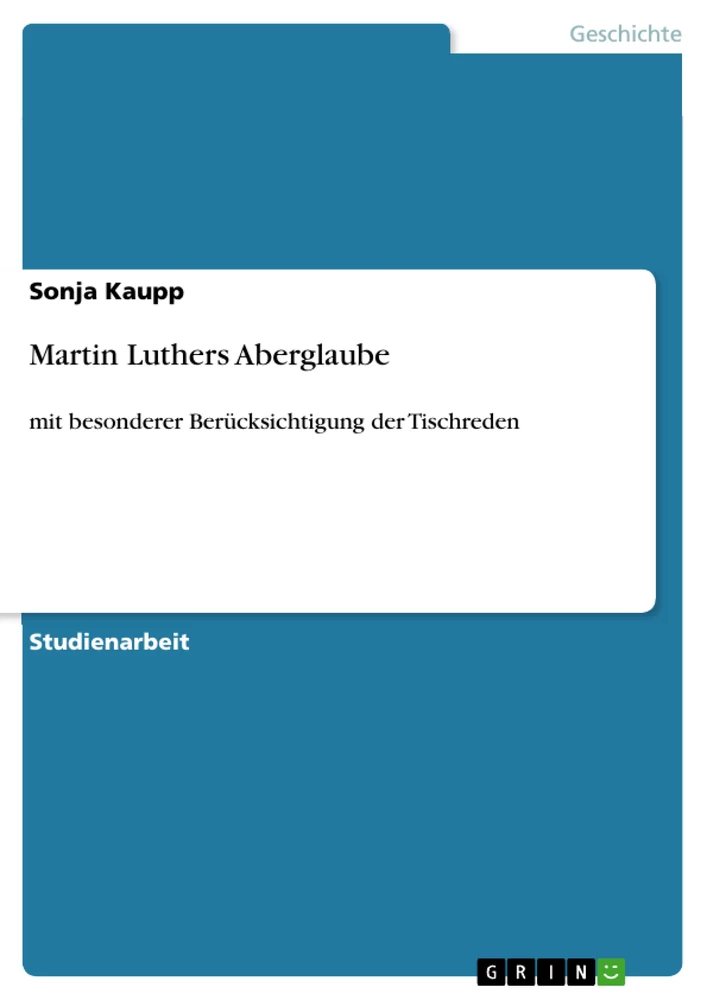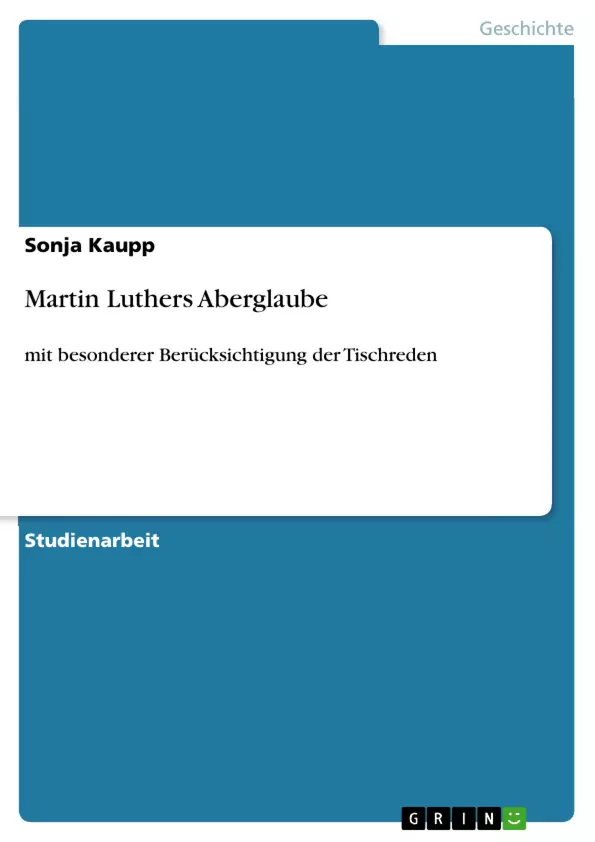Die Persönlichkeit Martin Luthers übt seit jeher eine große Faszination aus, nicht nur auf seine Anhänger. Wer war dieser Mann, der es vom einfachen Mönch zu einer der entscheidenden Persönlichkeiten brachte, die die Frühe Neuzeit einläuteten? Bei der Beschäftigung mit seiner Person stößt man jedoch nicht nur auf reformatorisches Gedankengut, das heute noch die Grundlage einer Konfession bildet, sondern auch auf Aufforderungen, unschuldige Frauen zu verbrennen. Inwiefern war Luther ein Kind des Mittelalters, das den Volksaberglauben teilte?
Diese Untersuchung der Tischreden Luthers im Vergleich mit der entsprechenden Sekundärliteratur versucht, die Grenzen von Luthers Glauben an Hexen (hier liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit), den Teufel, Sterndeuter und Poltergeister aufzuzeigen und an Luthers Verständnis von dem einzig wahren Glauben festzumachen.
Zur Quelle:
Luther war ein geselliger Mensch, der gerne redete und durchaus auch als sprachbegabt gezeichnet werden kann (man denke nur an seine Bibelübersetzung). Es machte ihm Freude, sich mitzuteilen – angeblich wurde sogar das eine oder andere Mal das Essen kalt, bevor er geendet hatte. Luthers Tischreden sind vielmehr Monologe als Gespräche, bei denen es sich um zufällig aufkommende Themen drehte. Sie zeichnen besonders durch ihre Lebendigkeit und Spontaneität aus. Seine Zuhörer waren stets fasziniert und schrieben auch die kleinsten Bemerkungen eifrig mit.
Bei den vorliegenden Quellen handelt es sich um die elektronische Datenbank von Luthers Gesammelten Werken, in der sich sechs Bände den Tischreden widmen, sowie einer schriftlichen Ausgabe von Luthers Tischreden in sechs Bänden (siehe Bibliographie).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zur Thematik
- Zur Quelle
- Der Teufel
- Erklärungsansätze für Luthers Teufelsglauben
- Begegnungen mit dem Teufel
- Rolle des Teufels
- Teufelsbesessenheit und Vertreiben des Teufels
- Hexen
- Luthers theologische Grundgedanken zum Thema Zauberei
- Einfluss des Teufels auf die Hexen/ Schuldfrage
- Begrifflichkeiten in Luthers Werk
- Luthers Frauenbild im Allgemeinen
- Die Rolle der alten Frauen im Speziellen in Luthers Dekalogpredigten
- Luthers Hexenbild basierend auf seinen Dekalogpredigten
- Hauptmerkmale von Hexen
- Hexenflug
- Teufelspakt und Buhlschaft
- Wahrsagen
- Hexenprozesse
- Luther als Unterstützer der Hexenverbrennung
- Luther als Gegner des Hexenwahns
- Astrologie
- Berührungspunkte mit und Meinung über Astrologie
- Gründe für seine Haltung
- Der Widerspruch: Die Diskussionen um Luthers Geburtsjahr
- Nächtliche Erscheinungen: Poltergeister und Schlafwandeln
- Poltergeisterscheinung auf der Wartburg
- Erklärungsversuch
- Schlafwandeln
- Zusammenfassung / Schlussfolgerung
- Bibliographie
- Quellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Martin Luthers Aberglauben, insbesondere mit seinem Glauben an Hexen, Teufel, Sterndeuter und Poltergeister. Sie analysiert Luthers Tischreden und setzt diese in Beziehung zur entsprechenden Sekundärliteratur, um seine Ansichten zu diesen Themen zu beleuchten und seine Grenzen zwischen „rechtem“ Glauben und Aberglauben zu erforschen. Die Arbeit zielt darauf ab, Luthers Verständnis von dem einzig wahren Glauben zu ergründen und seine Positionierung in Bezug auf die verbreiteten Aberglauben seiner Zeit zu analysieren.
- Luthers Teufelsglaube und seine Begegnungen mit dem Teufel
- Luthers theologische Grundgedanken zum Thema Zauberei und seine Ansichten über Hexen
- Luthers Frauenbild und seine Rolle in der Hexenverfolgung
- Luthers Haltung gegenüber Astrologie und seine Auseinandersetzung mit dem Thema
- Luthers Erklärungsversuche für nächtliche Erscheinungen wie Poltergeister und Schlafwandeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Persönlichkeit Martin Luthers sowie die Bedeutung des Aberglaubens in seiner Zeit vor. Sie erläutert den Begriff „Aberglaube“ und die Herausforderungen, die Luther bei der Abgrenzung von „rechtem“ Glauben zu Aberglauben hatte. Die Quelle der Arbeit, Luthers Tischreden, wird vorgestellt und ihre Bedeutung für die Analyse von Luthers Ansichten hervorgehoben.
Das Kapitel über den Teufel beleuchtet Luthers Teufelsglauben und seine Begegnungen mit dem Teufel. Es analysiert verschiedene Erklärungsansätze für Luthers Teufelsglaube, darunter psychologische Interpretationen, die Luthers Teufelsglauben als Projektion seiner eigenen psychischen Prozesse sehen. Das Kapitel untersucht auch die Rolle des Teufels in Luthers Theologie und die Themen Teufelsbesessenheit und Vertreiben des Teufels.
Das Kapitel über Hexen befasst sich mit Luthers theologischen Grundgedanken zum Thema Zauberei und seinem Einfluss auf die Hexenverfolgung. Es analysiert Luthers Begrifflichkeiten in Bezug auf Hexen, seine Ansichten über den Einfluss des Teufels auf Hexen und die Schuldfrage. Das Kapitel untersucht auch Luthers Frauenbild und seine Rolle in der Hexenverfolgung, insbesondere im Kontext seiner Dekalogpredigten.
Das Kapitel über Astrologie beleuchtet Luthers Berührungspunkte mit und Meinung über Astrologie. Es analysiert die Gründe für Luthers Haltung gegenüber Astrologie und die Diskussionen um Luthers Geburtsjahr, die einen Widerspruch zu seiner Ablehnung der Astrologie aufzeigen.
Das Kapitel über nächtliche Erscheinungen befasst sich mit Luthers Erklärungsversuchen für Poltergeister und Schlafwandeln. Es analysiert die Poltergeisterscheinung auf der Wartburg und Luthers Erklärungsversuch für dieses Phänomen. Das Kapitel untersucht auch Luthers Ansichten über Schlafwandeln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Martin Luther, Aberglaube, Hexen, Teufel, Astrologie, Poltergeister, Schlafwandeln, Tischreden, Theologie, Reformation, Frauenbild, Hexenverfolgung, Dekalogpredigten, Frühneuzeit, Glaube, Superstitio, Teufelsbesessenheit, Teufelspakt, Hexenflug, Wahrsagen, Geburtsjahr, Wartburg.
- Arbeit zitieren
- Sonja Kaupp (Autor:in), 2007, Martin Luthers Aberglaube, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127738