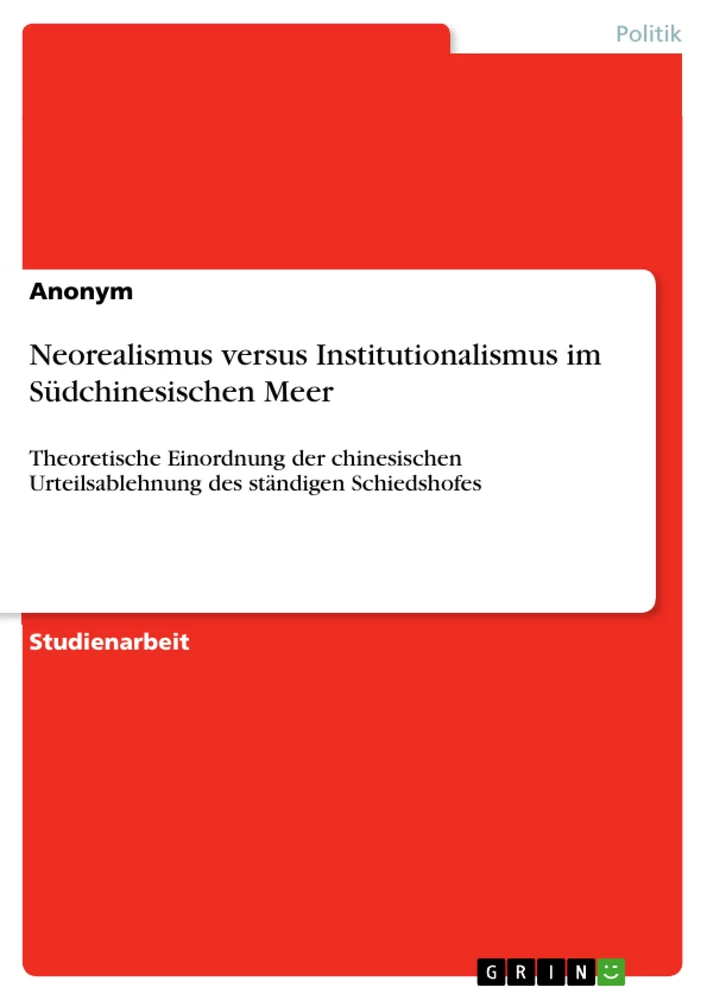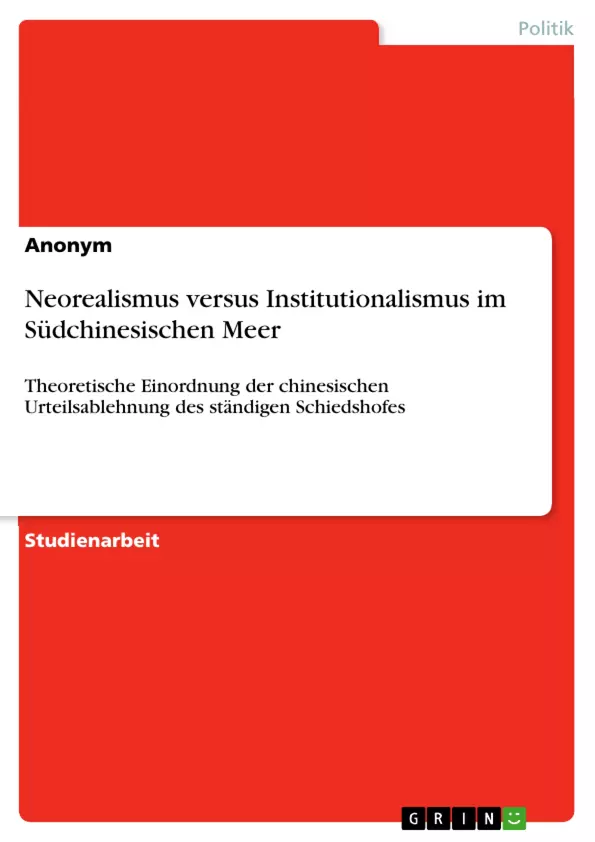Weit komplexer verhalten sich die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer (SCM). So kommt es in diesem Meergebiet aufgrund von Ressourcen und der bedeutsameren geostrategischen Lage zu Auseinandersetzungen zwischen den Anrainerstaaten China, Malaysia, Taiwan, Thailand, Brunei und den Philippinen. Besondere Brisanz erhalten diese Konflikte durch die komplexe Beziehungs- und Bündnisstruktur, welche auch die USA involvieren. Durch diesen Umstand treffen im SCM zwei konkurrierende Weltmächte aufeinander, was das Potenzial für eine globale militärische Eskalation in sich birgt. Aus diesem Grund stellt der Konflikt im SCM eine besondere Situation dar, welche eine deeskalierende Konfliktlösung deutlich erschwert.
Einen Versuch der internationalen Konfliktlösung unternahmen die Philippinen im Jahr 2013, indem sie vor dem ständigen Schiedshof in Den Haag (PCA) Klage einreichten, dass das chinesische Engagement in bestimmten Gebieten gegen internationales Recht verstößt. Im Jahr 2016 bekamen die Philippinen in fast allen Punkten Recht. Allerdings lehnte China den Urteilsspruch aus verschiedenen Gründen ab, weswegen der Konflikt noch weiterhin besteht.
In diesem Zusammenhang soll diese Arbeit der Frage nachgehen, warum China das Urteil des PCA von 2016 nicht anerkannt hat. So sollen die Hintergründe dieser Entscheidung aus zwei theoretischen Perspektiven der internationalen Beziehungen betrachtet werden. Dafür werden die herangezogenen Theorien des neoliberalen Institutionalismus und des defensiven Neorealismus in einem ersten Schritt definiert. Das grundlegende Verständnis der beiden Konzepte ist die Voraussetzung dafür, dass man die chinesische Entscheidung vor dem Hintergrund beider Theorien einordnen kann. Daraufhin wird der Konflikt im SCM genauer beschrieben, indem zuerst der Ablauf bis zum Schiedsspruch erklärt wird, bevor anschließend auf die Organisation des PCA und das Urteil von 2016 eingegangen wird. Dies ist die Grundlage dafür, dass die Ereignisse nach dem Schiedsspruch nachvollzogen werden können, welche daraufhin dargelegt werden. Die daraus gewonnen Erkenntnisse ermöglichen es, die Ablehnung Chinas zuerst aus der Sicht des neoliberalen Institutionalismus zu betrachten und anschließend mithilfe des defensiven Neorealismus zu analysieren, um eine Einordnung des chinesischen Verhaltens in eine der beiden Theorieschulen zu ermöglichen. Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der zentralen theoretischen Konzepte
- Der neoliberale Institutionalismus
- Der defensive Neorealismus
- Der Konflikt im Südchinesischen Meer
- Der Konflikthergang bis 2016
- Der ständige Schiedshof in Den Haag und das Urteil von 2016
- Ereignisse nach dem Schiedsspruch
- Theoretische Einordnung der Hintergründe der chinesischen Urteilsablehnung
- Ausgemachte institutionalistische Elemente in Chinas Verhalten
- Neorealistische Aspekte in Chinas Vorgehen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für Chinas Ablehnung des Urteils des Ständigen Schiedshofs (PCA) im Jahr 2016 im Kontext des Südchinesischen Meer-Konflikts. Die Arbeit zielt darauf ab, die chinesische Entscheidung aus zwei theoretischen Perspektiven der internationalen Beziehungen zu betrachten: dem neoliberalen Institutionalismus und dem defensiven Neorealismus.
- Die Anwendung des neoliberalen Institutionalismus und des defensiven Neorealismus auf den Südchinesischen Meer-Konflikt
- Die Analyse der chinesischen Entscheidung, das PCA-Urteil von 2016 nicht anzuerkennen
- Die Rolle internationaler Institutionen im Konflikt
- Die Bedeutung von Machtpolitik und nationaler Interessen in der internationalen Politik
- Die Auswirkungen des Konflikts auf die regionale und globale Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Südchinesischen Meer-Konflikt als einen bedeutenden Hotspot für mögliche militärische Eskalationen dar. Sie beleuchtet die komplexen territorialen Ansprüche der Anrainerstaaten und die Brisanz des Konflikts aufgrund der Beteiligung der USA. Das Kapitel skizziert den Verlauf des Konflikts bis zum PCA-Urteil von 2016 und die daraus resultierenden Herausforderungen für eine deeskalierende Konfliktlösung.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition der beiden zentralen Theorien des neoliberalen Institutionalismus und des defensiven Neorealismus. Es werden die zentralen Annahmen beider Theorien erörtert, um die Grundlagen für die Analyse der chinesischen Urteilsablehnung zu schaffen.
Kapitel drei beleuchtet den Konflikt im Südchinesischen Meer, indem der Konflikthergang bis zum Jahr 2016 dargelegt wird. Dabei wird auch auf die Organisation des PCA und das Urteil von 2016 eingegangen, wodurch die Grundlage für die Analyse der Ereignisse nach dem Schiedsspruch gelegt wird.
Kapitel vier untersucht die theoretische Einordnung der chinesischen Urteilsablehnung. Es werden ausgemachte institutionalistische Elemente in Chinas Verhalten sowie neorealistische Aspekte in Chinas Vorgehen herausgearbeitet. Durch die Analyse aus beiden Perspektiven wird eine Einordnung des chinesischen Verhaltens in eine der beiden Theorieschulen ermöglicht.
Schlüsselwörter
Südchinesisches Meer, Neorealismus, Institutionalismus, Internationales Recht, Territoriale Ansprüche, Machtpolitik, Konfliktlösung, Internationale Institutionen, Ständiger Schiedshof, PCA-Urteil, Chinesische Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Staaten sind am Konflikt im Südchinesischen Meer beteiligt?
Zu den beteiligten Anrainerstaaten gehören China, Malaysia, Taiwan, Thailand, Brunei und die Philippinen, wobei auch die USA als Bündnispartner involviert sind.
Was war das Urteil des Ständigen Schiedshofs (PCA) im Jahr 2016?
Der PCA gab den Philippinen in fast allen Punkten Recht und stellte fest, dass Chinas Engagement in bestimmten Gebieten gegen internationales Recht verstößt.
Warum lehnt China das PCA-Urteil ab?
China erkennt die Zuständigkeit des Schiedshofs in dieser Angelegenheit nicht an und betrachtet seine territorialen Ansprüche als historisch begründet und unverhandelbar.
Was ist der "neoliberale Institutionalismus" in diesem Kontext?
Diese Theorie betont die Rolle internationaler Institutionen und Regeln bei der Konfliktlösung und der Förderung von Kooperation zwischen Staaten.
Wie erklärt der "defensive Neorealismus" Chinas Verhalten?
Der defensive Neorealismus sieht Staaten primär als Akteure, die ihre Sicherheit durch Macht und Souveränität schützen wollen, was Chinas Ablehnung externer Urteile als Schutz nationaler Interessen deutet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Neorealismus versus Institutionalismus im Südchinesischen Meer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277573