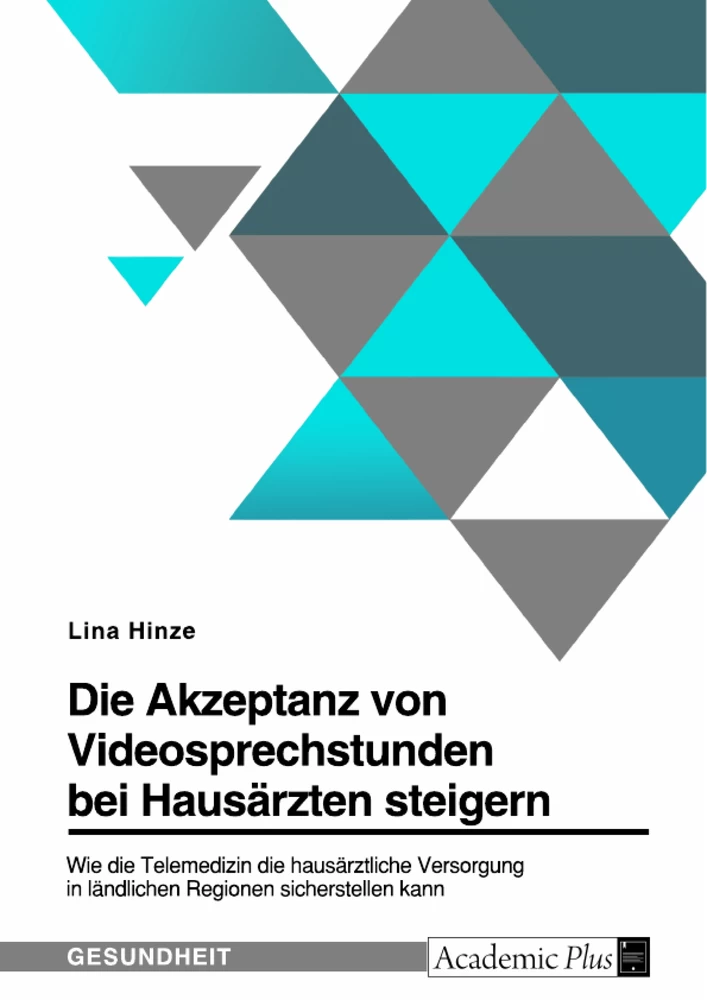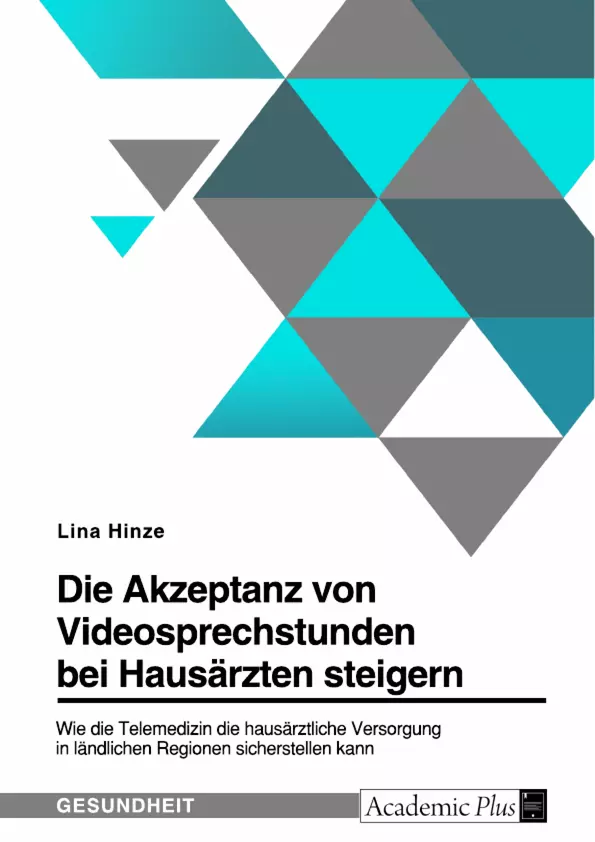Durch welche Faktoren wird die Akzeptanz von Videosprechstunden bei Hausärzten beeinflusst? Für die Beantwortung der Frage erfolgt eine qualitative Datenerhebung, indem halb-standardisierte Interviews mit niedergelassenen Hausärzten geführt werden. Die empirische Forschung verfolgt das Ziel, den theoretischen Diskurs anzureichern sowie anhand der Interviews die Erkenntnisse für die Forschung um die Akzeptanz der Hausärzte zu der Videosprechstunde zu erweitern. Zudem werden anhand der Ergebnisse Konstrukte sichtbar, die Voraussetzungen für eine Akzeptanz der Videosprechstunde abbilden, aus denen die Anwendbarkeit theoretischer Modelle abgeleitet werden können. Auf Basis der Ergebnisse können Handlungsempfehlungen für die Praxis ausgesprochen werden. Diese Handlungsempfehlungen zielen auf eine erhöhte Nutzungsbereitschaft bei den Hausärzten ab, um die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.
Aufnahmestopp für Neupatienten – die Angst vor einer medizinischen Unterversorgung belastet viele Menschen bereits seit mehreren Jahren. Gleichzeitig nimmt die Ungewissheit der ärztlichen Versorgung aufgrund der ausgeschöpften Kapazitätsgrenzen der Ärzte und der Schließung von Arztpraxen zu.
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der damit verbundenen Alterung der Bevölkerung, die Gesundheitsleistungen verstärkt in Anspruch nehmen, wird eine besorgniserregende Entwicklung sichtbar. Während im Jahr 2013 noch 27% der Bevölkerung in Deutschland über 60 Jahre alt waren, so wird ein Anstieg dieser Altersgruppe bis 2030 auf 35% prognostiziert. Mit der Bevölkerung altert auch die Ärzteschaft. Ein hoher Anteil der Ärzte befindet sich im Renteneintrittsalter, wodurch ein entsprechend hoher Nachbesetzungsbedarf entsteht.
Wie kann einer drohenden Unterversorgung entgegengewirkt werden? Die Digitalisierung hat das Gesundheitswesen und die Betreuung der Patienten charakteristisch neu geprägt. In Deutschland soll die Anbindung an die Telematikinfrastruktur, welche eine digitale Vernetzung aller Gesundheitsakteure zum Ziel hat, eine Versorgung auf Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien gewährleisten. Ein Baustein der Telematikinfrastruktur ist die Videosprechstunde. Insbesondere im hausärztlichen Bereich mit ländlichen Versorgungsstrukturen und freien Praxissitzen ist die Videosprechstunde eine geeignete Maßnahme, eine ärztliche Betreuung über eine räumliche Distanz durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung
- 2.1 Ambulante Versorgungsformen
- 2.2 Bedarfsplanung
- 2.3 KV: Vorgaben und praktische Umsetzung
- 2.4 Hausärztliche Versorgung als Schwerpunkt
- 2.4.1 Begriffsabgrenzung hausärztliche Versorgung
- 2.4.2 Aktuelle Situation: Entwicklung zu einer Unterversorgung?
- 2.4.3 Strukturdefizitäre Regionen
- 3 Digitalisierung im Gesundheitswesen
- 3.1 Begriffsabgrenzungen
- 3.2 Aktuelle Situation und Entwicklungen
- 4 Videosprechstunde als Schwerpunkt
- 4.1 Begriffsdefinition und -abgrenzung
- 4.2 Anforderungen an die Implementierung
- 4.3 Prozessintegration der Videosprechstunde
- 4.3.1 Ablauf in der Praxisorganisation
- 4.3.2 Übersicht zur Vergütung und Abrechnung
- 5 Forschungsstand zu der Akzeptanz von Videosprechstunden
- 5.1 Technology Acceptance Model
- 5.2 Value-based Adoption Model
- 6 Methodisches Vorgehen
- 6.1 Untersuchungsdesign
- 6.1.1 Forschungsmethode – Empirische Studie
- 6.1.2 Stichprobenziehung
- 6.1.3 Vorgehen Datenerhebung
- 6.2 Datenanalyse
- 6.2.1 Qualitative Datenanalyse nach Mayring
- 6.2.2 Datenauswertung
- 7 Empirische Ergebnisse
- 8 Diskussion der empirischen Ergebnisse
- 8.1 Anbindung an die Forschungen aus dem bestehenden Diskurs
- 8.2 Anwendbarkeit der Akzeptanzmodelle und Gütebeurteilung
- 8.3 Interpretation und Zusammenfassung der Ergebnisse für die Praxis
- 9 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Akzeptanz von Videosprechstunden bei Ärzten in ländlichen Regionen. Sie analysiert die aktuelle Situation der hausärztlichen Versorgung in Deutschland, insbesondere in strukturdefizitären Regionen, und beleuchtet die Rolle der Digitalisierung in diesem Kontext. Die Arbeit erforscht, inwiefern die Videosprechstunde als Telemedizin-Instrument eine nachhaltige Lösung zur Sicherstellung einer flächendeckenden hausärztlichen Versorgung sein kann. Die Studie befasst sich mit der praktischen Implementierung, den Anforderungen an die Organisation und die Vergütung von Videosprechstunden. Dabei werden etablierte Akzeptanzmodelle, wie das Technology Acceptance Model und das Value-based Adoption Model, herangezogen, um die Faktoren zu verstehen, die die Akzeptanz von Videosprechstunden beeinflussen.
- Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen
- Digitalisierung im Gesundheitswesen
- Akzeptanz von Videosprechstunden bei Ärzten
- Anforderungen an die Implementierung von Videosprechstunden
- Bewertung der Videosprechstunde als Lösungsansatz für die Unterversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Videosprechstunde und deren Bedeutung für die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen ein. Kapitel 2 beleuchtet die aktuelle Situation der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung, fokussiert auf die hausärztliche Versorgung und zeigt die Herausforderungen in strukturdefizitären Regionen auf. Kapitel 3 widmet sich der Digitalisierung im Gesundheitswesen, definiert wichtige Begriffe und stellt die aktuellen Entwicklungen dar. In Kapitel 4 wird die Videosprechstunde als Telemedizin-Instrument näher betrachtet, ihre Begriffsdefinition, die Anforderungen an die Implementierung und die Integration in die Praxisorganisation werden erläutert. Kapitel 5 präsentiert den Forschungsstand zur Akzeptanz von Videosprechstunden und stellt die beiden Akzeptanzmodelle, Technology Acceptance Model und Value-based Adoption Model, vor. Kapitel 6 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Studie, inklusive des Untersuchungsdesigns, der Stichprobenziehung und der Datenanalyse. Kapitel 7 präsentiert die empirischen Ergebnisse, die aus der qualitativen Datenanalyse gewonnen wurden. Die Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 8 analysiert die Ergebnisse im Kontext des bestehenden Diskurses, bewertet die Anwendbarkeit der Akzeptanzmodelle und interpretiert die Ergebnisse für die Praxis. Kapitel 9 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Videosprechstunde, Telemedizin, hausärztliche Versorgung, ländliche Regionen, Digitalisierung im Gesundheitswesen, Akzeptanz, Technology Acceptance Model, Value-based Adoption Model, qualitative Datenanalyse, empirische Studie, Unterversorgung.
Häufig gestellte Fragen
Was beeinflusst die Akzeptanz von Videosprechstunden bei Hausärzten?
Die Akzeptanz wird durch Faktoren wie die wahrgenommene Nützlichkeit, die einfache Handhabung (Technology Acceptance Model) sowie den wahrgenommenen Wert gegenüber dem Aufwand (Value-based Adoption Model) beeinflusst.
Wie kann Telemedizin die Versorgung in ländlichen Regionen sichern?
Videosprechstunden ermöglichen eine ärztliche Betreuung über räumliche Distanzen hinweg. Dies hilft, Kapazitätsengpässe zu überbrücken und die Versorgung in Regionen mit freien Praxissitzen aufrechtzuerhalten.
Welche Rolle spielt die Telematikinfrastruktur (TI)?
Die TI ist die Basis für die digitale Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen. Die Videosprechstunde ist ein zentraler Baustein dieser Infrastruktur, um Informations- und Kommunikationstechnologien für die Patientenversorgung zu nutzen.
Welche Anforderungen gibt es für die Implementierung in einer Praxis?
Es bedarf technischer Voraussetzungen, einer Anpassung der Praxisorganisation sowie Klarheit über die Vergütung und Abrechnung der telemedizinischen Leistungen.
Warum droht in Deutschland eine medizinische Unterversorgung?
Hauptgründe sind der demographische Wandel (alternde Bevölkerung), der hohe Nachbesetzungsbedarf durch in Rente gehende Ärzte und die daraus resultierenden Kapazitätsgrenzen bestehender Praxen.
Welche methodische Vorgehensweise nutzt die Studie?
Es handelt sich um eine empirische Forschung mit qualitativen, halb-standardisierten Interviews mit niedergelassenen Hausärzten, die nach der Methode von Mayring ausgewertet wurden.
- Quote paper
- Lina Hinze (Author), 2021, Die Akzeptanz von Videosprechstunden bei Hausärzten steigern. Wie die Telemedizin die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen sicherstellen kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1277892