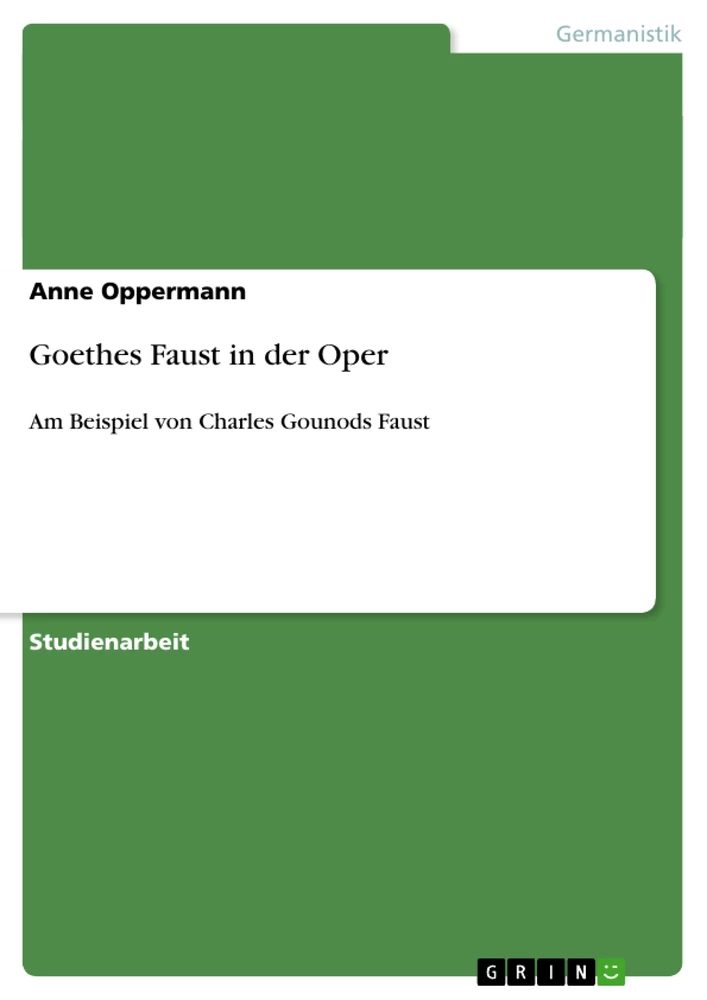Die Tragödie Faust I von Johann Wolfgang von Goethe regte wie kaum ein anderer Stoff die Komponisten zu Vertonungen in verschiedensten Gattungen an. Als besonders beliebt erwiesen sich hier die Gattung des Liedes und der Oper. In den Liedern wird der Text meist originalgetreu übernommen, lediglich die Ausführung variiert. Sie reicht – der historischen Entwicklung entsprechend – von der (von Goethe bevorzugten) strophischen bis zur durchkomponierten Form. Die Opernkomponisten bzw. ihre Librettisten gingen wesentlich freier mit Goethes Vorlage um. Offiziell orientieren sich die meisten an Goethes Tragödie – nur wenige folgen wie Ferruccio Busoni dem Puppenspiel oder wie Albert Lortzing Grabbes Text – doch wurde der Schwerpunkt des jeweiligen Werkes meist neu festgelegt und Goethes Faust dazu passend gekürzt, ummodelliert und neu gedeutet. Es läßt sich in den Faust-Opern die Tendenz beobachten, daß nur eine der der drei Figuren – Faust, Mephistopheles oder Gretchen – als Hauptfigur betrachtet wird. Verständlicherweise wird oft die Titelfigur Faust, sein Wissensdrang, seine faustische Suche als zentrales Motiv gedeutet. „Ich, Faust, ein ewiger Wille“ wie es so passend bei Busoni heißt. So geschehen zum Beispiel bei Ludwig Spohr und Hector Berlioz. Andere wie z.B. Arrigo Boito und Carlo Conit sahen in Mephistopheles die treibende Kraft und somit die Hauptfigur. Charles Gounod hingegen entschied sich für Gretchen als Zentralfigur.
Diese Arbeit befaßt sich mit Charles Gounods Oper Faust, die sich als die erfolgreichste Faust-Vertonung auf der Bühne behauptet hat. Im ersten Teil werde ich darstellen, welche musikalischen Vorraussetzungen bereits in Goethes Faust I angelegt sind, welche Vorstellungen Goethe von einer dem Faust angemessenen Musik hatte und wie seine Reaktion auf entstehende Faust-Musiken war. Der zweite Teil der Arbeit wird der Frage nachgehen, welche Änderungen Gounod und seine Librettisten Jules Barbier und Michel Carré an Faust vornahmen, um ihn opernbühnentauglich zu machen und welche Auswirkungen dies auf die Charakterdarstellungen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Goethe, Faust und die Musik
- Musik im Faust
- Goethe und Faust-Vertonungen
- Charles Gounod: Faust
- Historischer Abriß
- Michel Carrés Faust et Marguerite
- Vergleich von Gounods und Goethes Faust
- Erster Akt
- Zweiter Akt
- Dritter Akt
- Vierter Akt
- Fünfter Akt
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Oper Faust von Charles Gounod, die sich als die erfolgreichste Faust-Vertonung auf der Bühne etabliert hat. Sie analysiert die musikalischen Vorraussetzungen in Goethes Faust I, Goethes Vorstellungen von einer angemessenen Musik zum Faust und seine Reaktion auf entstehende Faust-Musiken. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Änderungen, die Gounod und seine Librettisten Jules Barbier und Michel Carré an Faust vornahmen, um ihn opernbühnentauglich zu machen, und die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Charakterdarstellungen.
- Musikalische Elemente in Goethes Faust I
- Goethes Vorstellungen von einer Faust-Musik
- Goethes Reaktion auf Faust-Vertonungen
- Änderungen an Goethes Faust durch Gounod und seine Librettisten
- Auswirkungen der Änderungen auf die Charakterdarstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Goethes Faust I als Stoff für Vertonungen in verschiedenen Gattungen dar, insbesondere für Opern. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Herangehensweisen von Komponisten und Librettisten an Goethes Vorlage und die Tendenz, eine der drei Figuren Faust, Mephistopheles oder Gretchen als Hauptfigur zu betrachten. Die Arbeit konzentriert sich auf Charles Gounods Oper Faust und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Goethes Beziehung zur Musik und seiner Vorstellung von einer dem Faust angemessenen Musik. Es analysiert die musikalischen Elemente in Goethes Faust I, die von Glockenklang, Chorgesang, Tanz, Gesang und Solo-Einlagen geprägt sind. Es werden verschiedene Analysen der Faust-Tragödie mit musikalischen Parametern vorgestellt, die die Opernhaftigkeit des Werkes beleuchten. Das Kapitel beleuchtet auch Goethes Reaktion auf verschiedene Faust-Vertonungen, darunter die Werke von Zelter, Eberwein und Berlioz. Es wird deutlich, dass Goethe eine Musik zum Faust suchte, die dem Charakter des Don Juan entsprach und die er mit Mozart oder Meyerbeer assoziierte.
Das dritte Kapitel widmet sich Charles Gounods Oper Faust. Es gibt einen historischen Abriss der Entstehung der Oper und stellt die Librettisten Jules Barbier und Michel Carré vor. Es wird der Vergleich zwischen Gounods und Goethes Faust gezogen, wobei die einzelnen Akte der Oper analysiert werden. Die Analyse beleuchtet die Änderungen, die Gounod und seine Librettisten an Goethes Vorlage vornahmen, um sie opernbühnentauglich zu machen, und die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Charakterdarstellungen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Goethes Faust, Musik, Oper, Charles Gounod, Faust-Vertonungen, Libretto, Charakterdarstellungen, Vergleich, Analyse, Musikgeschichte, Musiktheorie, Literaturverfilmung.
- Citation du texte
- M.A. Anne Oppermann (Auteur), 2005, Goethes Faust in der Oper , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127841