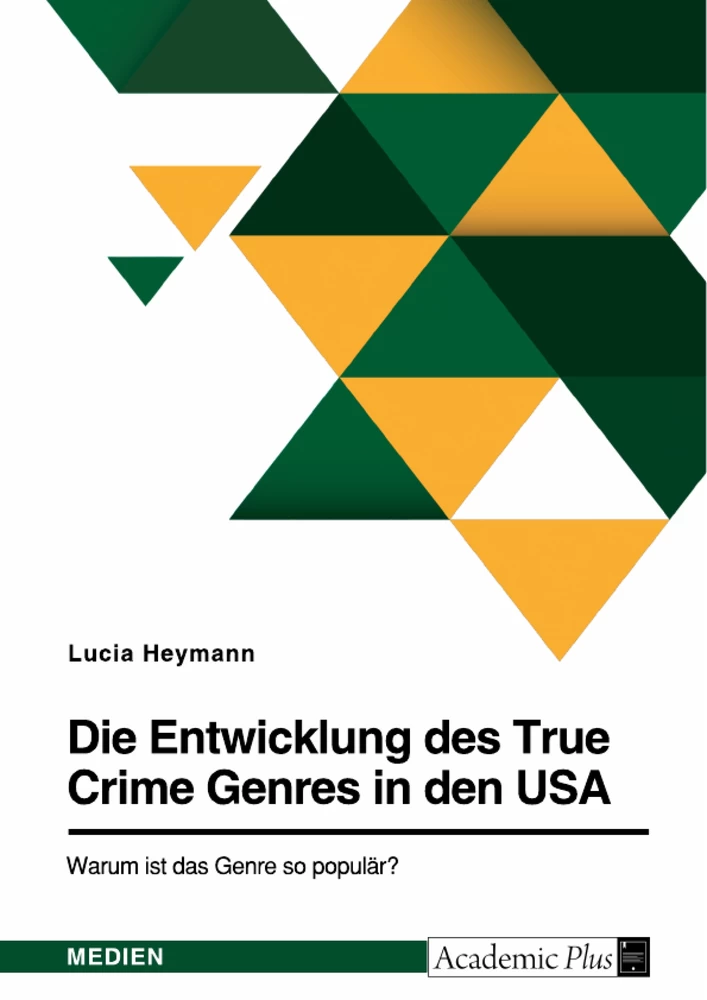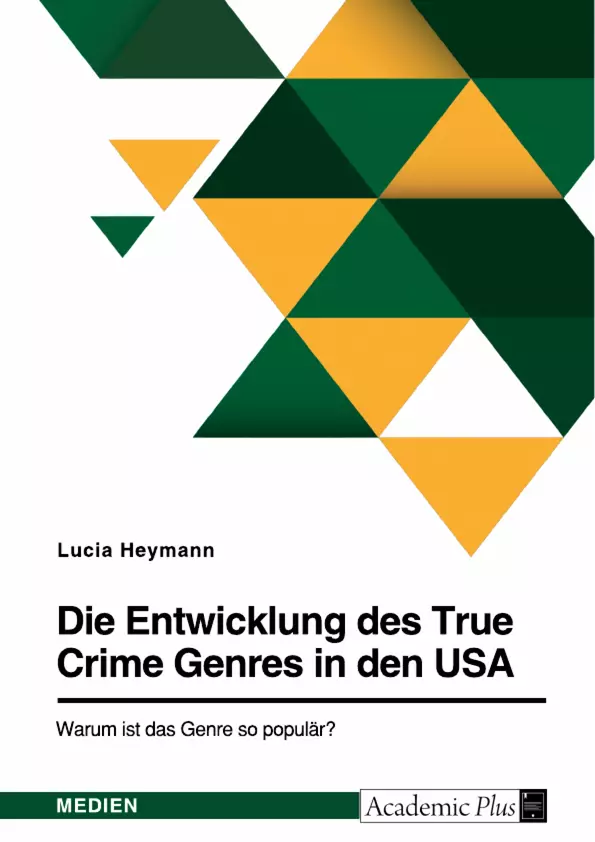Die Arbeit beschäftigt sich damit, wie sich das True Crime Genre insbesondere in den USA verändert hat und inwiefern kritische Aussagen in Anbetracht seiner durchlaufenen Evolution noch gerechtfertigt sind, wenn gesellschaftlich relevante Probleme thematisiert und innerhalb aktueller Serien dargestellt werden. Tanya Horeck betont in diesem Kontext unter anderem, dass beispielsweise die anhaltende Popularität von True Crime Dokumentationen für die Film- und Medienforschung eine wichtige Gelegenheit bietet, um über die aktuellen politischen und affektiven Kräfte des Genres zu reflektieren.
Im Laufe der Arbeit wird herausgearbeitet, ob auch fiktionale Formate diese Kräfte entfalten können. Die wesentlichen Leitfragen, die den Rahmen der Arbeit bilden, sind dabei folgende: Welche Faktoren haben den Wandel des True Crime Genres in den USA beeinflusst und inwiefern tragen diese zu seiner heutigen Popularität bei? Wie wird die eben angesprochene Genreevolution im True Crime sichtbar und wie hat sich dieser Prozess gestaltet? Wieso wird das Genre zunehmend seriell bzw. fiktional produziert? Diese Fragen werden mithilfe einer Analyse der ersten Staffel von AMERICAN CRIME STORY: THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE, WHEN THEY SEE US sowie UNBELIEVABLE geklärt und exemplarisch beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. True Crime – Mehr als nur ein Genre?
- 2.1 Genrebegriff und -Problematik
- 2.2 True Crime
- 2.2.1 Definition und Genese
- 2.2.2 Charakteristika und Merkmale im True Crime Film
- 2.2.3 True Crime im Fernsehen
- 2.2.4 Serielle und aktuelle Tendenzen im True Crime
- 2.3 Einflüsse aus dem Krimi
- 2.4 Genrehybridisierung und Genremixing im Krimi?
- 3. Transgressive Television
- 4. Vorstellung der Analyseexemplare
- 4.1 THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY
- 4.2 WHEN THEY SEE US
- 4.3 UNBELIEVABLE
- 5. Kontextanalyse nach Lothar Mikos
- 5.1 Genreeinordnung und Einflüsse
- 5.1.1 THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE
- 5.1.2 WHEN THEY SEE US
- 5.1.3 UNBELIEVABLE
- 5.1.4 Zwischenfazit
- 5.2 Soziokulturelle Themen und verknüpfte Diskurse
- 5.3 Emotionale Anbindung und Authentizität durch reale Lebenswelten
- 5.4 Einordnung auf dem Serienmarkt und Transgressive TV
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Entwicklung des True Crime Genres in den USA und seine zunehmende Popularität. Die Arbeit analysiert die soziokulturelle Bedeutung des Genres und ordnet aktuelle Serien in einen genretheoretischen Kontext ein. Der Fokus liegt auf der Betrachtung fiktionaler Serien und deren Umgang mit realen Kriminalfällen.
- Genretheorie des True Crime
- Soziokulturelle Bedeutung von True Crime Serien
- Analyse aktueller True Crime Serien im US-amerikanischen Fernsehen
- Der Einfluss von True Crime auf den Serienmarkt
- Genrehybridisierung und Genremixing im Kontext von True Crime
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die kontroverse Diskussion um das True Crime Genre. Sie stellt die Omnipräsenz von True Crime Formaten im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen fest und betont den starken Einfluss des US-amerikanischen Marktes auf globale Trends. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse fiktionaler True Crime Serien, die über die Darstellung von Kriminalfällen hinaus gesellschaftliche und soziale Probleme beleuchten.
2. True Crime – Mehr als nur ein Genre?: Dieses Kapitel definiert den Begriff True Crime und untersucht seine Genese und Charakteristika. Es analysiert die Entwicklung des Genres im Fernsehen und die aktuellen Trends, einschließlich der Genrehybridisierung und des Einflusses des Krimis. Es legt die Grundlage für die Analyse der ausgewählten Serien durch die Klärung von Genrekonventionen und -grenzen.
3. Transgressive Television: [Annahme: Kapitel 3 behandelt den Begriff "Transgressive Television" im Kontext von True Crime. Da der Text keine Details enthält, wird eine Platzhalter-Zusammenfassung erstellt.] Dieses Kapitel beschreibt den Begriff "Transgressive Television" und seine Relevanz für das Verständnis der analysierten True Crime Serien. Es erklärt die Bedeutung von Grenzüberschreitungen und provokativen Inhalten in der modernen Fernsehproduktion und wie diese in True Crime Serien zum Ausdruck kommen. Es analysiert die Strategien, mit denen True Crime Serien provozieren und gleichzeitig ein großes Publikum ansprechen. Die Einordnung der analysierten Serien in den Kontext von "Transgressive Television" wird thematisiert.
4. Vorstellung der Analyseexemplare: Dieses Kapitel stellt die drei ausgewählten Serien – THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY, WHEN THEY SEE US und UNBELIEVABLE – kurz vor und gibt einen Überblick über deren Inhalt und Thematik. Es dient als Einleitung zur detaillierten Analyse in den folgenden Kapiteln. Die Auswahl der Serien wird begründet und ihre Relevanz für die Forschungsfrage herausgestellt.
5. Kontextanalyse nach Lothar Mikos: Dieses Kapitel analysiert die drei ausgewählten Serien anhand des Kontextualisierungsmodells von Lothar Mikos. Es ordnet sie genre-theoretisch ein, untersucht die soziokulturellen Themen und die emotionale Anbindung an reale Lebenswelten. Die Einordnung auf dem Serienmarkt und die Beziehung zum Konzept "Transgressive Television" werden diskutiert. Die Analyse zeigt auf, wie die Serien gesellschaftliche Probleme reflektieren und kritisch kommentieren.
Schlüsselwörter
True Crime, Genreanalyse, Serien, Fernsehen, USA, Soziokultur, Kontextualisierung, Rassismus, Homophobie, Sexismus, Transgressive Television, Mikos, Genremixing, Gesellschaftliche Probleme.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: True Crime Serien im US-amerikanischen Fernsehen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Entwicklung und zunehmende Popularität des True Crime Genres im US-amerikanischen Fernsehen. Sie analysiert die soziokulturelle Bedeutung des Genres und ordnet aktuelle Serien in einen genretheoretischen Kontext ein, wobei der Fokus auf fiktionalen Serien liegt, die reale Kriminalfälle behandeln.
Welche Serien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert drei ausgewählte True Crime Serien: "THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY", "WHEN THEY SEE US" und "UNBELIEVABLE". Die Auswahl und Relevanz dieser Serien für die Forschungsfrage werden im Text begründet.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet ein genretheoretisches Vorgehen und analysiert die Serien anhand des Kontextualisierungsmodells von Lothar Mikos. Dies beinhaltet die Genreeinordnung, die Untersuchung soziokultureller Themen, die Analyse der emotionalen Anbindung an reale Lebenswelten und die Einordnung im Serienmarkt unter Berücksichtigung des Konzepts "Transgressive Television".
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die Genretheorie des True Crime, die soziokulturelle Bedeutung von True Crime Serien, die Analyse aktueller True Crime Serien im US-amerikanischen Fernsehen, den Einfluss von True Crime auf den Serienmarkt, Genrehybridisierung und Genremixing im Kontext von True Crime, sowie die Relevanz von "Transgressive Television". Soziokulturelle Aspekte wie Rassismus, Homophobie und Sexismus werden im Kontext der analysierten Serien betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, True Crime – Mehr als nur ein Genre?, Transgressive Television, Vorstellung der Analyseexemplare, Kontextanalyse nach Lothar Mikos und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des True Crime Genres und der analysierten Serien. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über die jeweiligen Inhalte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: True Crime, Genreanalyse, Serien, Fernsehen, USA, Soziokultur, Kontextualisierung, Rassismus, Homophobie, Sexismus, Transgressive Television, Mikos, Genremixing, Gesellschaftliche Probleme.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer Definition des True Crime Genres. Es folgt die Vorstellung der analysierten Serien und deren Kontextualisierung mittels des Mikos-Modells. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse zusammenfasst. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ermöglicht die einfache Navigation durch die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung und Bedeutung des True Crime Genres im US-amerikanischen Fernsehen zu untersuchen und die soziokulturellen Implikationen dieser Serien zu analysieren. Die Arbeit trägt zum Verständnis des Genres und seines Einflusses auf den Medienmarkt bei.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für das True Crime Genre, Medienwissenschaft, Soziologie, Kulturwissenschaften und die Analyse von Fernsehserien interessieren. Sie bietet genretheoretische Einblicke und eine tiefgreifende Analyse aktueller Serienphänomene.
- Citation du texte
- Lucia Heymann (Auteur), 2022, Die Entwicklung des True Crime Genres in den USA. Warum ist das Genre so populär?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1278680