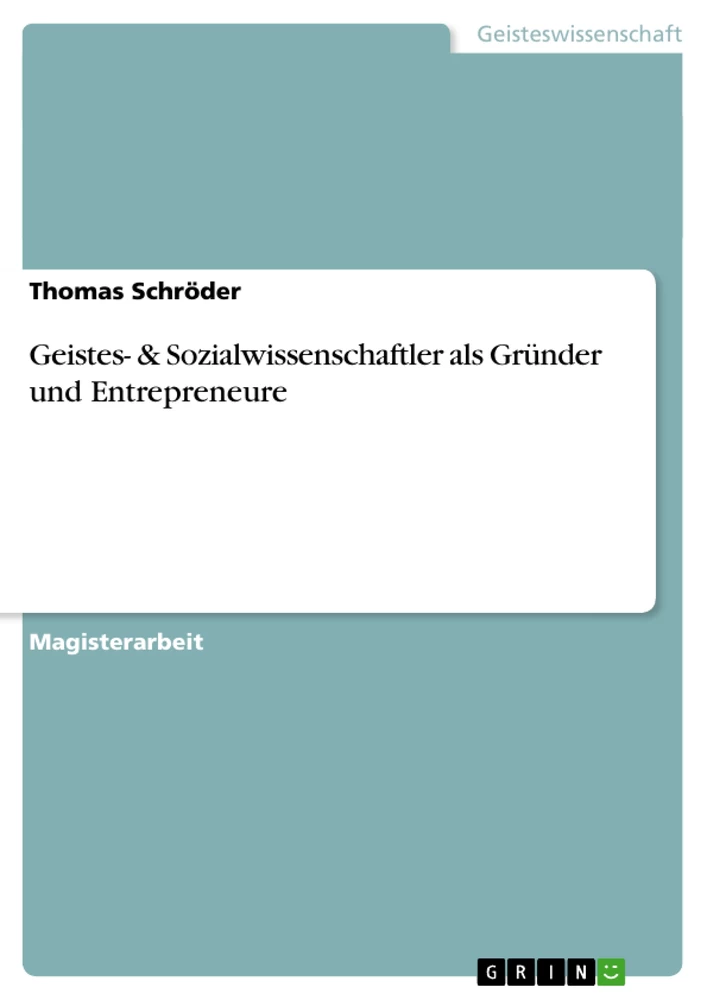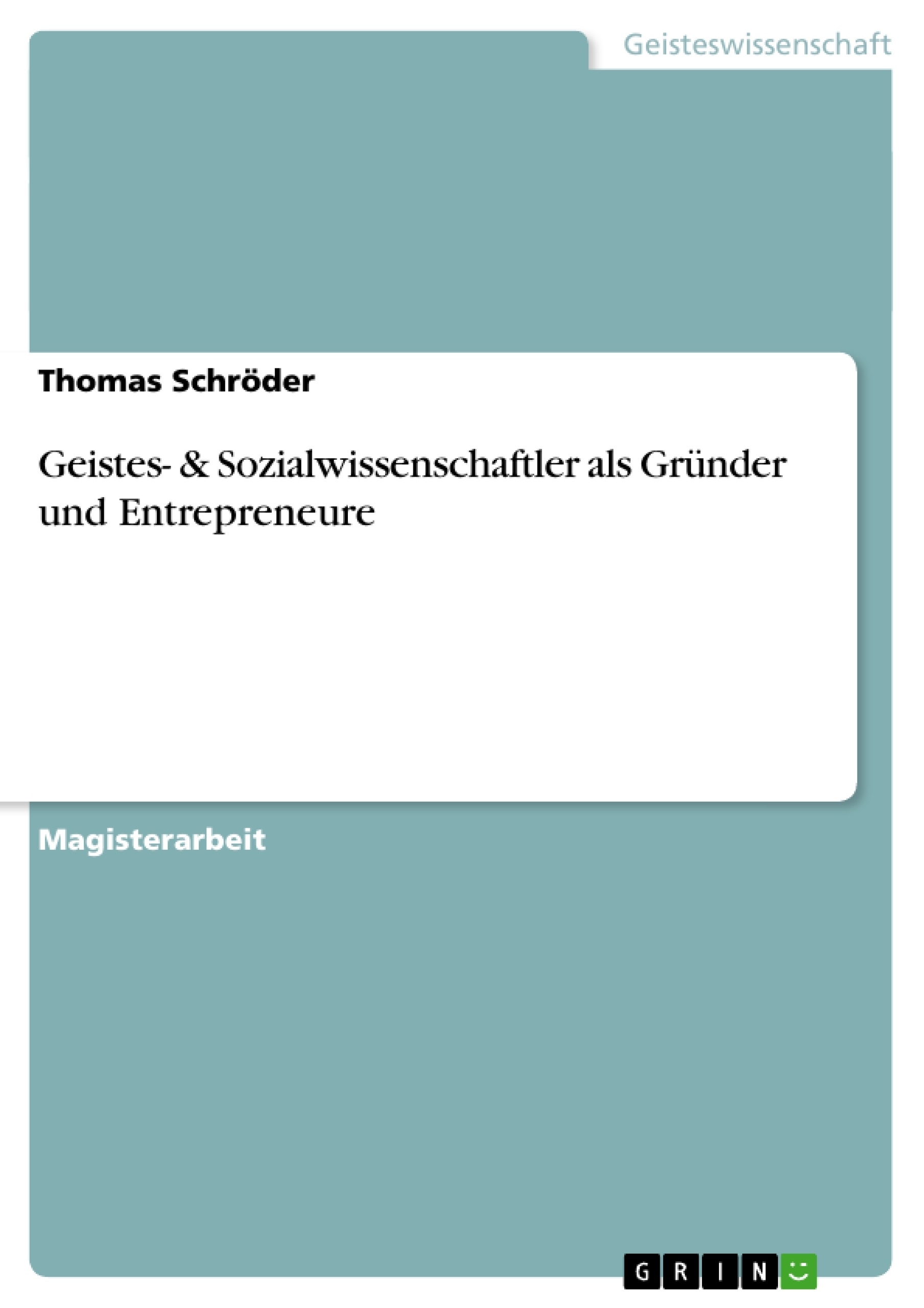„Warum sollten sich ausgerechnet Geistes- und Sozialwissenschaftler selbstständig machen?
Sind die dafür denn überhaupt geeignet?“ In diesen Fragen spiegelt sich eine Meinung, die in Gesprächen so oder ähnlich häufig geäußert wird und die vermutlich weit verbreitet ist.
Auf die erste Frage liefert die Betrachtung der Entwicklungen am Arbeitsmarkt eine plausible Antwort; die zweite erfordert eine intensivere Auseinandersetzung mit den Ansätzen und Ergebnissen
der Gründungsforschung.
Der Wandel der Arbeitslandschaft und die hohen Arbeitslosenzahlen der vergangenen zwei Jahrzehnte machen es auch für Akademiker zusehends schwieriger, einen sicheren Arbeitsplatz
zu finden. Während unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abgebaut oder zeitlich begrenzt werden, nimmt der Anteil an sozial nicht abgesicherter, befristeter Teilzeitbeschäftigung
stetig zu. In Politik und Gesellschaft ist der Ruf nach mehr Eigenverantwortung der Individuen mittlerweile nicht mehr zu überhören. Vor diesem Hintergrund stellt Selbstständigkeit als Form der Erwerbstätigkeit eine sinnvolle berufliche
Alternative dar. Als begünstigend erweist sich für Akademiker der wirtschaftssektorale Wandel, im Zuge dessen die Nachfrage nach Wissen und wissensintensiven Dienstleistungen erheblich gestiegen ist. Sich in diesem Bereich selbstständig
zu machen, bietet für Hochschulabsolventen gute Chancen.
Andererseits ist die berufliche Selbstständigkeit nach wie vor mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden, das jedoch
mehr und mehr durch die wachsende Unsicherheit abhängiger Beschäftigungsverhältnisse relativiert wird.
Mit Blick auf Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaftler wird gemeinhin davon ausgegangen, dass diese über die nötigen Kompetenzen für eine berufliche Selbstständigkeit verfügen. Bei
Geistes- und Sozialwissenschaftlern ist die öffentliche Meinung erheblich zurückhaltender. Auch die Gründungsforschung widmet dieser Gruppe nur wenig Aufmerksamkeit, da angenommen wird, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler im Verhältnis weniger gründen und dass sowohl die Arbeitsmarkteffekte als auch der volkswirtschaftliche Nutzen ihrer Gründungen
aufgrund des hohen Anteils von Klein- und Kleinstgründungen wesentlich geringer ausfallen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungen
- Einleitung
- Wandel der Arbeitslandschaft und Entwicklung der beruflichen Selbstständigkeit
- Sektoraler Wandel
- Globalisierung der Arbeitslandschaft
- Wandel der Unternehmensstrukturen
- Spezifische Probleme des deutschen Arbeitsmarktes
- Wandel der Beschäftigungsformen
- Wandel der Normalbiografie
- Geistes- und Sozialwissenschaftler im Kontext einer „Neuen Kultur der Selbstständigkeit“?
- Stand der Gründungforschung
- Forschungsansätze und Interdisziplinarität
- Gründungsphasen, Gründungstypen und Gründungsmotivationen
- Zentrale Begriffe und deren Verwendung im Kontext der vorliegenden Arbeit
- Problem der statistischen Erfassung des Gründungsgeschehens
- Forschungsdefizit bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Gründungen
- Geistes- und Sozialwissenschaftler als Gründer
- »Gründungserfolg«
- Leitbegriffe und Konzepte: Kompetenz, Erfahrung und Fähigkeiten
- Kompetenz
- Handlungskompetenz
- Kompetenzkonzept von Erpenbeck und Heyse
- Kritik am Kompetenzbegriff
- Verwendung der Begriffe und Konzepte im Kontext der empirischen Untersuchung
- Methodenbegründung
- Fragestellung und Erläuterung des Untersuchungsvorhabens
- Vorgehen bei der Datenerhebung
- Vorgehen bei der Datenauswertung
- Kurzportraits der interviewten Gründer
- Ferdinand
- Karen
- Karsten
- Maren
- Marc
- Sven
- Auswertung der Interviews: Ergebnisdarstellung
- Ferdinand
- Karen
- Karsten
- Maren
- Marc
- Sven
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Erfahrungen und biografische Besonderheiten
- Werte und Einstellungen
- Fähigkeiten
- Wissen und Kenntnisse
- Kompetenzen
- Unterstützungsnetzwerke
- Soziales Kapital
- Selbstständigkeit als Disposition
- Defizite
- Gründungserfolg
- Hochschulen und Gründungsvorbereitung
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Interview-Leitfaden
- Kurzfragebogen zur Sozialdatenerfassung
- Abschlussfragebogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, welche Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten Geistes- und Sozialwissenschaftler für eine erfolgreiche Existenzgründung benötigen. Die Arbeit analysiert die Gründungsprozesse von Absolventen dieser Fachrichtungen und untersucht, welche Faktoren ihren Erfolg beeinflussen.
- Wandel der Arbeitslandschaft und die Bedeutung der Selbstständigkeit
- Kompetenzbegriff und seine Relevanz für die Gründung
- Erfahrungen und Fähigkeiten von Geistes- und Sozialwissenschaftlern als Gründer
- Gründungsmotivationen und -herausforderungen
- Rolle der Hochschulen bei der Gründungsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des Wandels der Arbeitslandschaft und der steigenden Bedeutung der Selbstständigkeit. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Geistes- und Sozialwissenschaftler im Kontext einer „Neuen Kultur der Selbstständigkeit“ gegenübersehen.
Im zweiten Kapitel wird der Stand der Gründungforschung beleuchtet. Es werden verschiedene Forschungsansätze und -perspektiven vorgestellt, sowie zentrale Begriffe wie Gründungsphasen, Gründungstypen und Gründungsmotivationen definiert.
Kapitel drei widmet sich den Leitbegriffen Kompetenz, Erfahrung und Fähigkeiten. Es wird das Kompetenzkonzept von Erpenbeck und Heyse vorgestellt und kritisch diskutiert.
Kapitel vier erläutert die Methodenbegründung der Arbeit. Es wird das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung beschrieben, sowie die Auswahl der Interviewpartner vorgestellt.
Kapitel fünf präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit sechs Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die eine eigene Firma gegründet haben. Die Interviews werden detailliert ausgewertet und die Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen der Gründer analysiert.
Kapitel sechs fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung von Erfahrungen, Fähigkeiten und Kompetenzen für den Gründungserfolg.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gründung von Unternehmen, die Rolle von Geistes- und Sozialwissenschaftlern als Gründer, Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die Bedeutung von Netzwerken und sozialem Kapital, sowie die Herausforderungen und Chancen der Selbstständigkeit. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Gründungsförderung durch Hochschulen und die Entwicklung von spezifischen Kompetenzen für den Gründungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Sind Geistes- und Sozialwissenschaftler als Gründer geeignet?
Ja, die Arbeit zeigt, dass sie über spezifische Kompetenzen verfügen, die in der wissensintensiven Dienstleistungsgesellschaft sehr gefragt sind, auch wenn sie oft weniger im Fokus der Gründungsforschung stehen.
Warum ist Selbstständigkeit für Akademiker heute wichtiger geworden?
Der Wandel der Arbeitswelt, der Abbau unbefristeter Stellen und die steigende Nachfrage nach Spezialwissen machen die Selbstständigkeit zu einer attraktiven beruflichen Alternative.
Was ist das Kompetenzkonzept von Erpenbeck und Heyse?
Es ist ein Modell zur Erfassung von Handlungskompetenzen, das in der Arbeit genutzt wird, um die Fähigkeiten der interviewten Gründer zu analysieren.
Welche Defizite haben Geisteswissenschaftler oft bei der Gründung?
Häufig mangelt es an betriebswirtschaftlichem Fachwissen, während Stärken eher im Bereich der sozialen Kompetenz, Netzwerkarbeit und methodischen Analyse liegen.
Welche Rolle spielen Hochschulen bei der Gründungsförderung?
Hochschulen sind zentrale Orte zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit, wobei das Angebot für geisteswissenschaftliche Fakultäten oft noch ausbaufähig ist.
- Quote paper
- Thomas Schröder (Author), 2007, Geistes- & Sozialwissenschaftler als Gründer und Entrepreneure, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127989