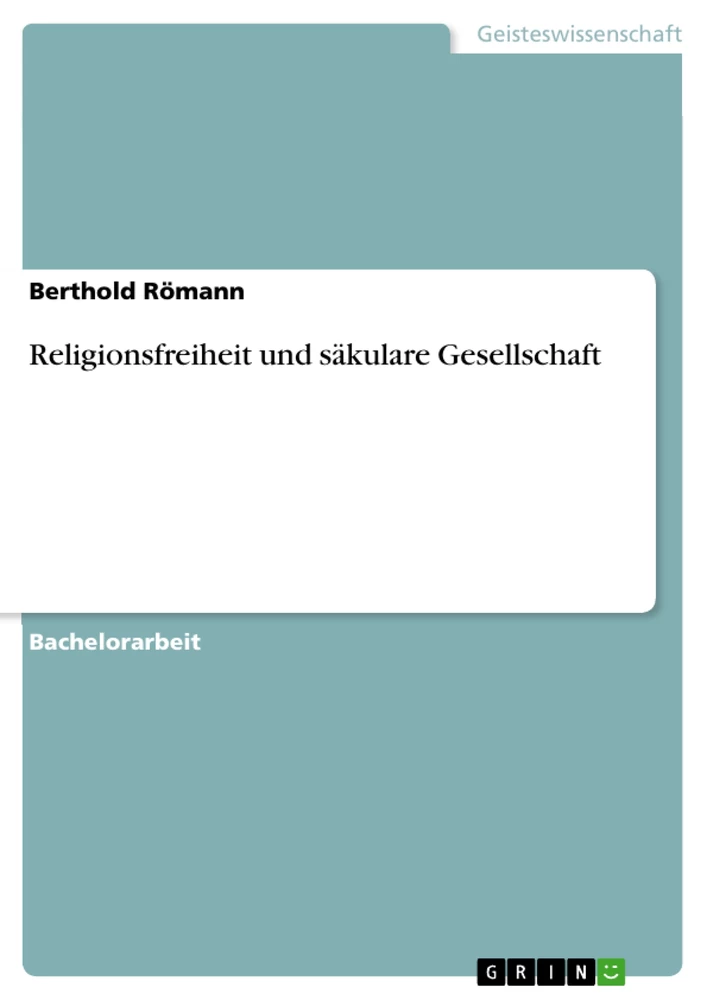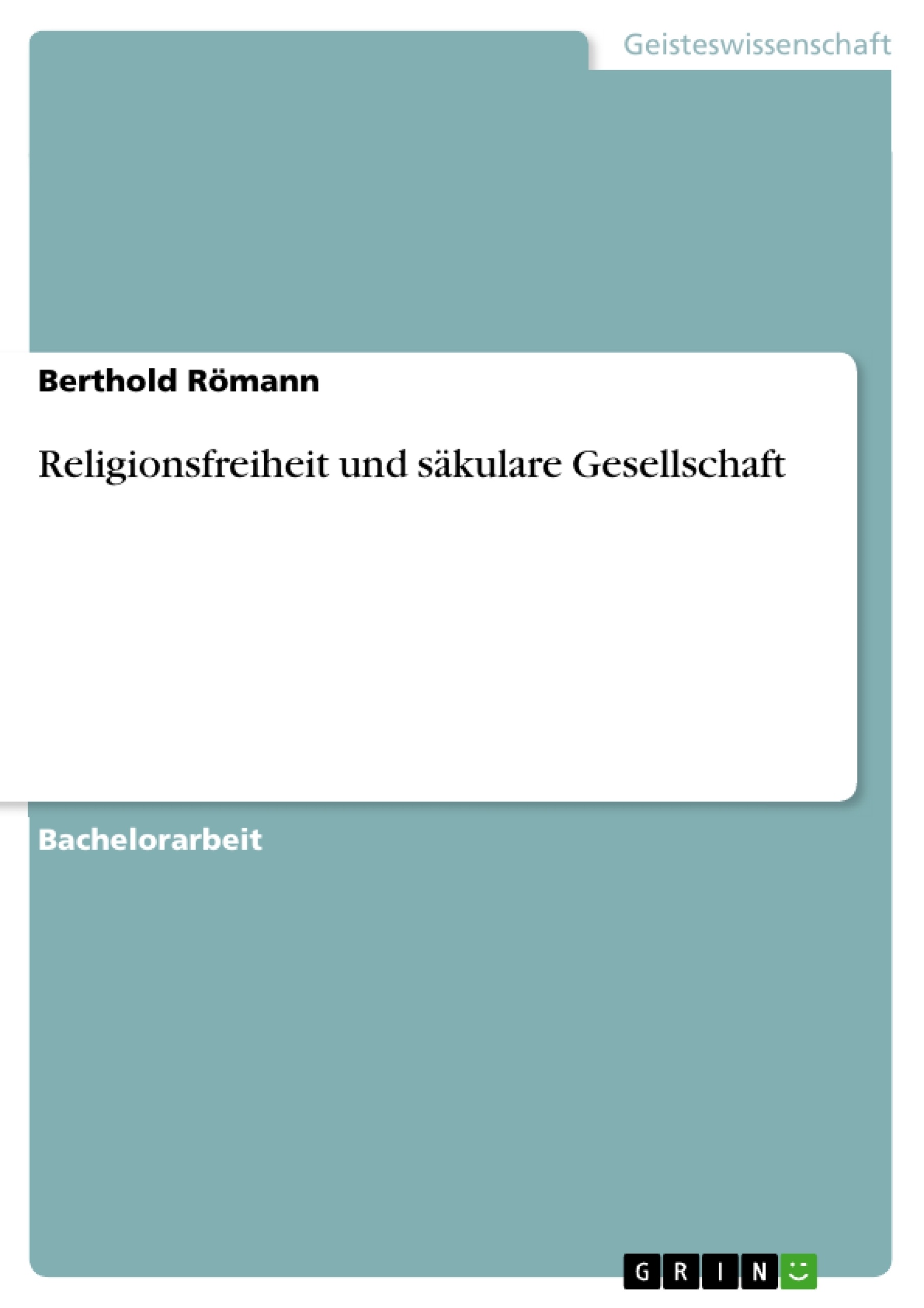In der vorliegenden Arbeit wird das Thema Religionsfreiheit und säkulare Gesellschaft behandelt. Das Ziel meiner Arbeit ist somit, die Begrifflichkeit Religionsfreiheit näher zu erläutern und in diesem Zusammenhang den religiösen Hintergrund der Beschneidung genauer darzustellen und klar von der weiblichen Genitalverstümmelung zu differenzieren.
Nachdem zunächst einige Begriffsbestimmungen vorgenommen werden, folgt danach die Darstellung der Religionsfreiheit als Menschenrecht. Gerade in der momentanen Situation stellt sich immer wieder die Frage, wie das Menschenrecht der Religionsfreiheit zu verstehen ist. Darf der Staat zum Beispiel in die Religionsfreiheit eingreifen oder nicht oder gehört es zur Religionsfreiheit, wenn ein Neugeborenes ohne eigene Zustimmung beschnitten wird? Zu diesem Zweck findet in Kapitel 4 die genaue Abgrenzung der Religionsfreiheit gegenüber Staat und Person statt. Daran anschließend wird in Kapitel 5 eine kurze Darstellung der Anerkennung der Religionsfreiheit durch das Zweite Vatikanische Konzil vorgenommen.
Im Anschluss daran, folgt die Beschreibung der momentanen Situation bezüglich der Knabenbeschneidung und deren Begründung mithilfe der Religionsfreiheit. An dieser Stelle wird auch eine klare Unterscheidung zwischen Knabenbeschneidung und weiblicher Genitalverstümmlung vorgenommen. Gerade diese Unterscheidung ist für mich persönlich von immenser Wichtigkeit, da die Knabenbeschneidung keinesfalls mit der weiblichen Genitalverstümmelung gleichzusetzen ist. Es schließt sich die Debatte des Kölner Urteils zum Thema Beschneidung an, worauf die knappe Darstellung weiterer aktueller Diskussionen zum Thema Religionsfreiheit folgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Begriffsbestimmung Religion
- 2.2 Begriffsbestimmung Säkularismus
- 2.3 Säkularismus - 3 Unterscheidungen
- 3. Der Begriff Weltreligion
- 3.1 Judentum
- 3.2 Christentum
- 3.3 Islam
- 4. Religionsfreiheit – Ein Menschenrecht unter Druck?
- 4.1 Was Religionsfreiheit nicht ist
- 4.1.1 Freiheit gegenüber der eigenen Person?
- 4.1.2 Freiheit gegenüber dem Staat?
- 4.1.3 Das Verhältnis von Staat zur Religionsgemeinschaft
- 4.2 Religionsfreiheit und Menschenrecht im Geflecht
- 4.3 Religion und Formen der Freiheit
- 4.3.1 Gedankenfreiheit
- 4.3.2 Handlungsfreiheit
- 4.4 Menschenrechte und Kinder: Ethik
- 4.4.1 Definition Kind
- 4.4.2 Kinder als Subjekte von Menschenrechten
- 4.4.3 Die Weltkonferenz in Wien (1993)
- 5. Religionsfreiheit - Das Zweite Vatikanische Konzil
- 5.1 Der Weg zur Religionsfreiheit
- 5.2 Das Bekenntnis zum Menschenrecht auf Religionsfreiheit
- 5.3 Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit
- 5.4 Vor dem Konzil: Gegner der Religionsfreiheit
- 5.5 Dignitatis humanae vs. Quanta cura
- 6. Religionsfreiheit – Die Knabenbeschneidung
- 6.1 Definition und Techniken
- 6.2 Einblick in die Geschichte
- 6.3 Religiöse Überlegungen (Ansätze zur Ursache von Beschneidung)
- 6.4 Religionsfreiheit und Zirkumzision
- 6.4.1 Religiöse Rechtfertigung?
- 6.4.2 Religionsfreiheit als Abwehrrecht
- 6.4.3 Beschneidungsgegner (Marilyn Milos)
- 6.5 Weibliche Genitalverstümmelung
- 6.5.1 Die Rechtslage
- 6.5.2 Bedeutung von Religion
- 7. Die Debatte zum Kölner Urteil
- 7.1 Die Vorgeschichte zum Kölner Urteil
- 7.2 Die Beschneidung: Recht und Toleranz
- 7.3 Pro zum Kölner Urteil
- 7.4 Contra zum Kölner Urteil
- 8. Religionsfreiheit - Andere aktuelle Debatten
- 8.1 Das Kruzifix im Klassenzimmer
- 8.2 Das Kopftuch in der Schule
- 8.3 Kruzifix und Kopftuch: Kritische Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das komplexe Zusammenspiel von Religionsfreiheit und säkularer Gesellschaft. Das Hauptziel besteht in der Klärung des Begriffs Religionsfreiheit und der Analyse des religiösen Hintergrunds der männlichen Beschneidung, unter klarer Abgrenzung zur weiblichen Genitalverstümmelung. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte dieses Themas.
- Begriffsbestimmung von Religion und Säkularismus
- Religionsfreiheit als Menschenrecht und deren Grenzen
- Das Zweite Vatikanische Konzil und seine Bedeutung für die Religionsfreiheit
- Die ethischen und rechtlichen Aspekte der männlichen Beschneidung
- Aktuelle Debatten um Religionsfreiheit in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit widmet sich dem Thema Religionsfreiheit in der säkularen Gesellschaft. Sie erläutert den Begriff der Religionsfreiheit und analysiert den religiösen Kontext der männlichen Beschneidung im Vergleich zur weiblichen Genitalverstümmelung. Die Arbeit untersucht, wie das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in verschiedenen Kontexten zu verstehen ist, und beleuchtet aktuelle Debatten zu diesem Thema.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Definitionen von Religion und Säkularismus fest. Es analysiert die Herausforderungen bei der Definition von Religion, berücksichtigt den Pluralismus moderner Glaubensvorstellungen und betont die Bedeutung der religiösen Neutralität des Staates. Der Begriff des Säkularismus wird im Kontext der Französischen Revolution und des Prinzips der „prinzipiengeleiteten Distanz“ erörtert.
3. Der Begriff Weltreligion: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über einige der großen Weltreligionen – Judentum, Christentum und Islam – und ihren Einfluss auf die Diskussion um Religionsfreiheit. Es stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Ausübung des Glaubens dar und dient als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit konkreten Fallbeispielen.
4. Religionsfreiheit – Ein Menschenrecht unter Druck?: Dieses Kapitel erörtert die Religionsfreiheit als Menschenrecht und deren Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft. Es untersucht die Abgrenzung der Religionsfreiheit gegenüber dem Staat und dem Individuum, insbesondere im Kontext von Eingriffen in die körperliche Integrität, wie beispielsweise der Beschneidung. Die Bedeutung von Gedankenfreiheit und Handlungsfreiheit im Kontext von Religionsfreiheit wird detailliert beleuchtet. Schließlich wird der besondere Aspekt der Kinderrechte im Zusammenhang mit Religionsfreiheit erörtert.
5. Religionsfreiheit - Das Zweite Vatikanische Konzil: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Anerkennung der Religionsfreiheit als Menschenrecht. Es untersucht den historischen Weg zur Anerkennung dieses Rechts und setzt es in Kontrast zu früheren Positionen der katholischen Kirche. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit.
6. Religionsfreiheit – Die Knabenbeschneidung: Dieses Kapitel analysiert die männliche Beschneidung aus der Perspektive der Religionsfreiheit. Es beschreibt die verschiedenen Techniken, geht auf die Geschichte der Beschneidung ein und untersucht die religiösen Argumente, die für diese Praxis angeführt werden. Die Debatte um die Rechtfertigung der Beschneidung unter dem Aspekt der Religionsfreiheit wird detailliert dargestellt, wobei die klare Abgrenzung zur weiblichen Genitalverstümmelung im Vordergrund steht.
7. Die Debatte zum Kölner Urteil: Dieses Kapitel widmet sich der juristischen Auseinandersetzung um die Beschneidung, die durch das Kölner Urteil ausgelöst wurde. Es analysiert die Vorgeschichte des Urteils und erörtert die verschiedenen Positionen (Pro und Contra) in dieser Debatte. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Recht und Toleranz.
8. Religionsfreiheit - Andere aktuelle Debatten: Dieses Kapitel beleuchtet weitere aktuelle Debatten rund um das Thema Religionsfreiheit, beispielsweise die Diskussion um das Kruzifix im Klassenzimmer und das Kopftuch in der Schule. Es präsentiert kritische Stellungnahmen zu diesen Themen und veranschaulicht die Komplexität der Herausforderungen, die mit der Religionsfreiheit in einer säkularen Gesellschaft verbunden sind.
Schlüsselwörter
Religionsfreiheit, Säkularismus, Weltreligionen, Menschenrechte, Kinderrechte, Beschneidung, Genitalverstümmelung, Zweites Vatikanisches Konzil, Kölner Urteil, Pluralismus, Gewissensfreiheit, Recht und Toleranz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Religionsfreiheit in der säkularen Gesellschaft"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Religionsfreiheit und säkularer Gesellschaft. Sie untersucht insbesondere die Religionsfreiheit als Menschenrecht, analysiert den religiösen Kontext der männlichen Beschneidung im Vergleich zur weiblichen Genitalverstümmelung und beleuchtet aktuelle gesellschaftliche Debatten zu diesem Thema.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmungen von Religion und Säkularismus, Religionsfreiheit als Menschenrecht und deren Grenzen, das Zweite Vatikanische Konzil und seine Bedeutung für die Religionsfreiheit, die ethischen und rechtlichen Aspekte der männlichen Beschneidung, aktuelle Debatten um Religionsfreiheit (z.B. Kruzifix im Klassenzimmer, Kopftuch in der Schule) und das Kölner Urteil zur Beschneidung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsbestimmungen (Religion und Säkularismus), Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam), Religionsfreiheit als Menschenrecht, Das Zweite Vatikanische Konzil und Religionsfreiheit, Männliche Beschneidung und Religionsfreiheit, Die Debatte zum Kölner Urteil und Andere aktuelle Debatten zur Religionsfreiheit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Definitionen von Religion und Säkularismus werden verwendet?
Die Arbeit legt grundlegende Definitionen von Religion und Säkularismus fest. Sie analysiert die Herausforderungen bei der Definition von Religion im Kontext des modernen Glaubens-Pluralismus und erörtert den Säkularismus, insbesondere im Kontext der Französischen Revolution und des Prinzips der „prinzipiengeleiteten Distanz“.
Welche Rolle spielt das Zweite Vatikanische Konzil?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Anerkennung der Religionsfreiheit als Menschenrecht. Sie analysiert den historischen Weg zur Anerkennung dieses Rechts und den Kontrast zu früheren Positionen der katholischen Kirche, mit Fokus auf die Beziehung zwischen Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit.
Wie wird die männliche Beschneidung behandelt?
Die Arbeit analysiert die männliche Beschneidung aus der Perspektive der Religionsfreiheit. Sie beschreibt die Techniken, geht auf die Geschichte ein, untersucht religiöse Argumente und diskutiert die Rechtfertigung der Beschneidung unter dem Aspekt der Religionsfreiheit. Eine klare Abgrenzung zur weiblichen Genitalverstümmelung wird betont.
Welche Bedeutung hat das Kölner Urteil?
Das Kapitel zur Debatte um das Kölner Urteil analysiert die juristische Auseinandersetzung um die Beschneidung. Es erörtert die Vorgeschichte des Urteils und die verschiedenen Positionen (Pro und Contra) in dieser Debatte, mit Fokus auf das Spannungsfeld zwischen Recht und Toleranz.
Welche weiteren aktuellen Debatten werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet weitere aktuelle Debatten um Religionsfreiheit, wie die Diskussion um das Kruzifix im Klassenzimmer und das Kopftuch in der Schule. Sie präsentiert kritische Stellungnahmen und veranschaulicht die Komplexität der Herausforderungen, die mit der Religionsfreiheit in einer säkularen Gesellschaft verbunden sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Religionsfreiheit, Säkularismus, Weltreligionen, Menschenrechte, Kinderrechte, Beschneidung, Genitalverstümmelung, Zweites Vatikanisches Konzil, Kölner Urteil, Pluralismus, Gewissensfreiheit, Recht und Toleranz.
- Citar trabajo
- Berthold Römann (Autor), 2015, Religionsfreiheit und säkulare Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280337