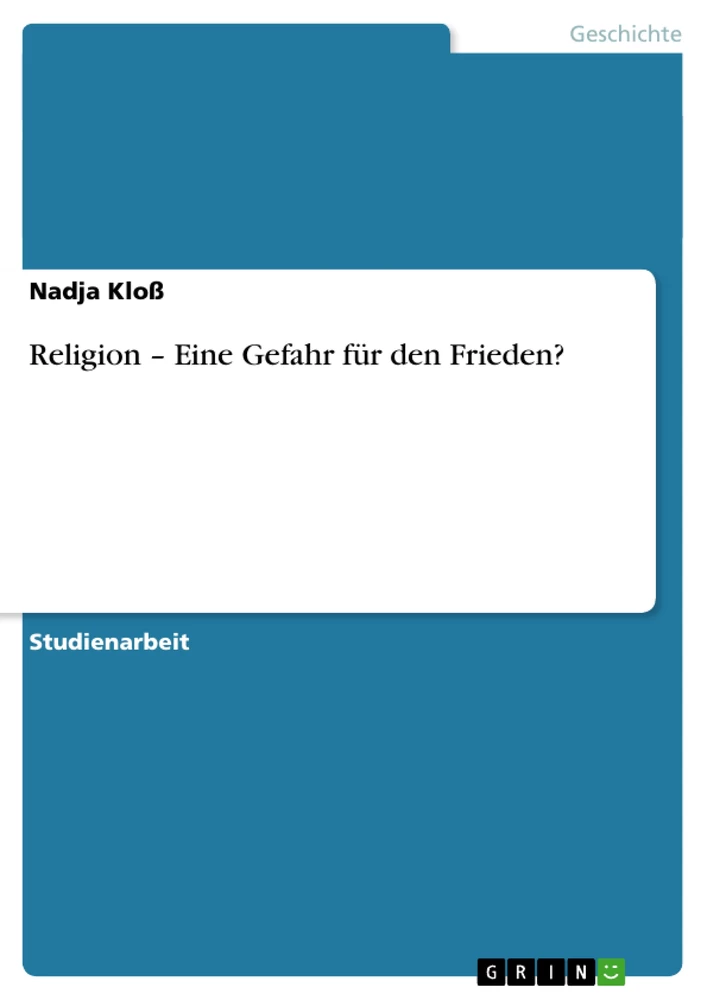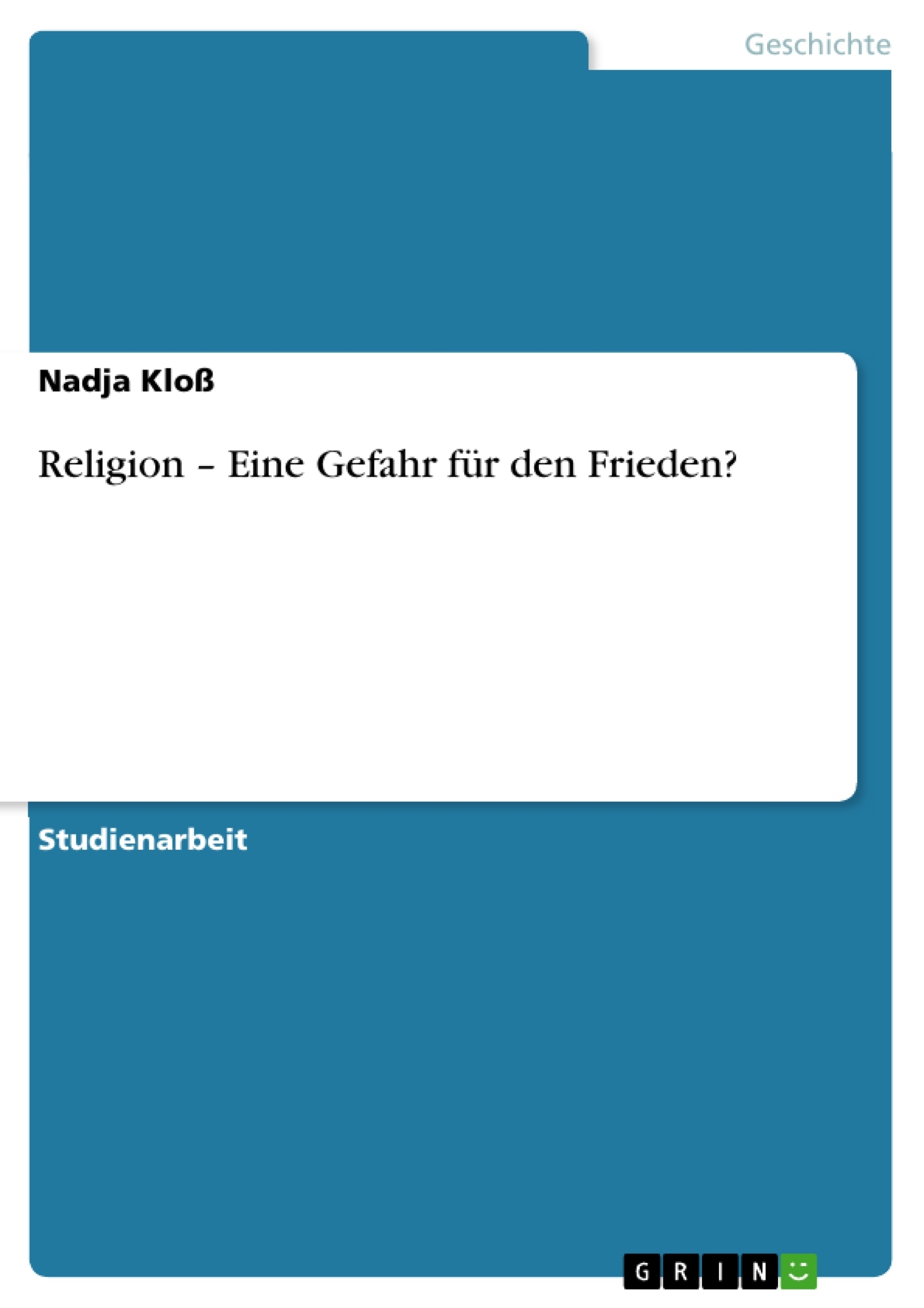Der 11. September 2001 als Verbrechen gegen die Menschheit führte uns bereits deutlich die
globale Gefahr eines religiös motivierter Terrorismus vor Augen. Dabei ist aber zu beachten,
dass dieses Geschehen nicht pauschal dem militanten Islam anzulasten ist und es auch falsch
ist, gar zum Gegenangriff eines „wehrhaften Christentums“ aufzurufen. Denn die
Zweideutigkeit aller Religionen, auch die des Christentums, v.a. durch die Kreuzzüge und die
Judenverfolgung, ist offensichtlich. Somit ist deutlich, dass Religion sowohl segenreich, also
Anlass für Befriedungsprozesse, als auch Quelle von Fanatismus und Verderben sein kann,
indem Gott/ das Heilige dämonisch verzerrt wird. Religion kann folglich auch Mittel der
Kriegsführung sein, indem religiöse Versprechungen zur Motivation (Ablass, Eintritt in das
Paradies) des eigenen Volkes/ Soldaten gegeben werden, hinzu kommt, dass materielle Opfer
oftmals mit religiösen Opfern gleichgesetzt werden. Immer wieder kommt es zu blutigen
Auseinandersetzungen zwischen verschiedensten Religionsanhängern – Konflikte um
Kaschmir, in Nordirland und selbst in Deutschland wird türkischen Familien das Haus
angezündet. Doch warum ist es nicht möglich, dass die jeweilige religiöse Überzeugung der
am Konflikt beteiligten Menschen nicht friedensstiftend, sonder eher im Gegenteil
kriegsfördernd sind? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Hauptteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Rolle der Religion als potenzielle Gefahr für den Frieden im 21. Jahrhundert. Es analysiert, wie religiöse Überzeugungen sowohl zu friedlichen als auch zu gewalttätigen Konflikten beitragen können. Die Arbeit hinterfragt die Ambivalenz der Religion und deren historische Auswirkungen auf den Weltfrieden.
- Religiös motivierter Terrorismus und seine globale Auswirkung
- Die Ambivalenz der Religion: Friedensstiftung versus Fanatismus
- Der Dschihad im Islam und seine Interpretation
- Kreuzzüge und die Gewalt im Namen des Christentums
- Der Vergleich von islamischem und christlichem Fundamentalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Religion sowohl Quelle des Friedens als auch des Konflikts sein kann. Der 11. September 2001 wird als Beispiel für religiös motivierten Terrorismus genannt, wobei betont wird, dass dieser nicht dem gesamten Islam zugeschrieben werden kann. Die historische Ambivalenz von Religionen, inklusive des Christentums (Kreuzzüge, Judenverfolgung), wird hervorgehoben. Es wird gezeigt, wie religiöse Versprechungen (Paradies, Sündenvergebung) zur Motivation von Gewalt eingesetzt werden können. Der Text verweist auf verschiedene Konflikte, die einen religiösen Hintergrund aufweisen, und stellt die Frage, warum religiöse Überzeugungen kriegsfördernd wirken können. Die „Löwener Erklärung“ wird zitiert, welche die Notwendigkeit der Abschaffung des Krieges betont, jedoch gleichzeitig die Diskrepanz zur Realität aufzeigt. Es wird festgehalten, dass keine Religion für Immunität gegenüber gewalttätigen Auseinandersetzungen beanspruchen kann, obwohl die grundsätzliche Vorstellung von Frieden und Gerechtigkeit in allen Religionen übereinstimmt.
2. Hauptteil: Dieser Abschnitt vertieft die These, indem er den Islam und das Christentum als Beispiele untersucht. Es wird der Dschihad im Islam erläutert, wobei der Fokus auf seine vielschichtige Bedeutung liegt – nicht nur als gewalttätiger Kampf, sondern auch als umfassende Anstrengung im Dienste Allahs. Der Iran wird als Beispiel für eine Theokratie genannt, in der religiöse Prinzipien die Staatsgewalt bestimmen, und die Benachteiligung religiöser Minderheiten wird beleuchtet. Der Text diskutiert die Rolle des Krieges im Alten Testament und betont, dass religiöse Motivation für Krieg in der Antike weit verbreitet war. Im Kontext des Christentums werden die Kreuzzüge analysiert, wobei die religiösen Motive im Laufe der Zeit in den Hintergrund traten und andere politische und wirtschaftliche Interessen an Bedeutung gewannen. Schließlich wird ein Vergleich zwischen islamischem und christlichem Fundamentalismus angedeutet.
Schlüsselwörter
Religion, Frieden, Gewalt, Terrorismus, Islam, Christentum, Dschihad, Kreuzzüge, Fundamentalismus, Theokratie, Iran, Weltfrieden, Religionsfrieden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Referat: Religion als potenzielle Gefahr für den Frieden im 21. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand des Referats?
Das Referat untersucht die ambivalente Rolle der Religion im 21. Jahrhundert. Es analysiert, wie religiöse Überzeugungen sowohl zu Frieden als auch zu gewalttätigen Konflikten beitragen können, und hinterfragt die historischen Auswirkungen von Religion auf den Weltfrieden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung religiös motivierten Terrorismus und dem Vergleich von islamischem und christlichem Fundamentalismus.
Welche Themen werden im Referat behandelt?
Das Referat behandelt folgende Schwerpunktthemen: religiös motivierter Terrorismus und seine globale Auswirkung; die Ambivalenz der Religion (Friedensstiftung vs. Fanatismus); der Dschihad im Islam und seine Interpretation; die Kreuzzüge und Gewalt im Namen des Christentums; und ein Vergleich von islamischem und christlichem Fundamentalismus. Es wird zudem die Rolle von religiösen Versprechungen (Paradies, Sündenvergebung) als Motivation für Gewalt diskutiert.
Welche Beispiele werden im Referat genannt?
Als Beispiele für religiös motivierte Gewalt werden der 11. September 2001, der Iran als Theokratie mit Benachteiligung religiöser Minderheiten, die Kreuzzüge und der Dschihad im Islam (in seiner vielschichtigen Bedeutung) genannt. Der Vergleich von islamischem und christlichem Fundamentalismus wird angedeutet, ebenso die Rolle des Krieges im Alten Testament.
Wie wird die Ambivalenz der Religion dargestellt?
Das Referat betont die widersprüchliche Rolle der Religion: Einerseits streben viele Religionen Frieden und Gerechtigkeit an, andererseits können religiöse Überzeugungen missbraucht werden, um Gewalt zu rechtfertigen. Die „Löwener Erklärung“, die die Notwendigkeit der Abschaffung des Krieges betont, wird als Beispiel für die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität genannt.
Welche Kapitel umfasst das Referat?
Das Referat besteht aus einer Einleitung und einem Hauptteil. Die Einleitung stellt die These auf und gibt einen Überblick über die Thematik. Der Hauptteil vertieft die These durch die Untersuchung des Islams und Christentums als Beispiele, beleuchtet den Dschihad und die Kreuzzüge und vergleicht schließlich islamischen und christlichen Fundamentalismus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Referat?
Schlüsselwörter sind: Religion, Frieden, Gewalt, Terrorismus, Islam, Christentum, Dschihad, Kreuzzüge, Fundamentalismus, Theokratie, Iran, Weltfrieden, Religionsfrieden.
Welche Schlussfolgerung zieht das Referat?
Das Referat kommt zu dem Schluss, dass keine Religion immun gegenüber gewalttätigen Auseinandersetzungen ist, obwohl die grundsätzliche Vorstellung von Frieden und Gerechtigkeit in allen Religionen übereinstimmt. Es unterstreicht die Notwendigkeit, die komplexe Beziehung zwischen Religion und Gewalt zu verstehen, um den Weltfrieden zu fördern.
- Citation du texte
- Nadja Kloß (Auteur), 2008, Religion – Eine Gefahr für den Frieden? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128153