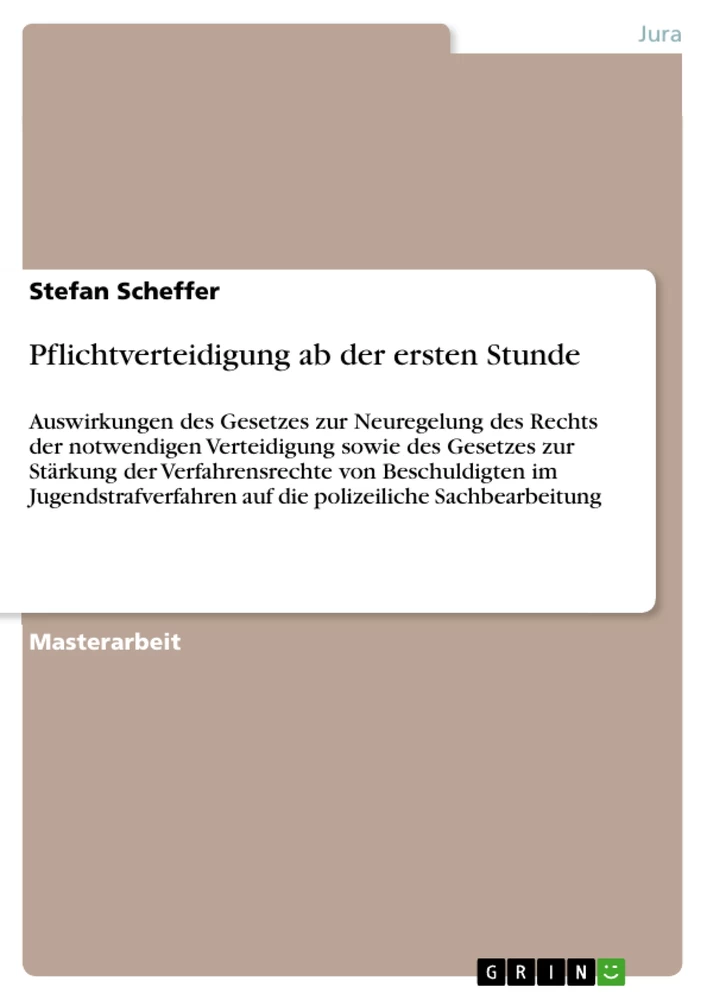Die Richtlinie (EU) 2016/1919 (PKH-Richtlinie) sowie die Richtlinie (EU) 2016/800 waren nationales Recht umzusetzen. Dies erfolgte durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung und das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Dezember 2019. In der vorliegenden Arbeit sollen die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelungen auf die Arbeit der Polizei betrachtet werden. Es werden zunächst die europarechtlichen Grundlagen sowie die Ausgangssituation im deutschen Recht dargestellt. Es wird weiterhin die Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht anhand der erfolgten Neuregelung der §§ 140ff. StPO und §§ 68ff. JGG betrachtet. Dabei wird auch thematisiert, wie der Umsetzungsspielraum, der dem nationalen Gesetzgeber zur Erreichung der in den Richtlinien vorgegebenen Ziele eingeräumt war, ausgestaltet worden ist. Ergänzt wird diese Betrachtung durch eine exemplarische Rechtsvergleichung.
Der zentrale Artikel 4 der PKH-Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass die betroffenen Personen unverzüglich und spätestens vor einer Befragung oder vergleichbaren Ermittlungsmaßnahme durch die Polizei oder eine andere Strafverfolgungs- oder Justizbehörde Prozesskostenhilfe bewilligt wird. Es sollen somit finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Zugang zu einem Anwalt und damit eine effektive Verteidigung zu gewährleisten. Die Richtlinie (EU) 2016/800 sieht dies – neben anderen Rechtsgarantien – in abgeänderter Form für Verdächtige und Beschuldigte unter 18 Jahren vor. Dabei ist der Verzicht auf einen Anwalt – der für Erwachsene grundsätzlich möglich ist – für Personen unter 18 Jahren im Regelfall nicht vorgesehen.
Die Umsetzung in nationales Recht ist möglich durch die Sicherstellung einer Bedürftigkeitsprüfung oder einer Begründetheitsprüfung. In Deutschland erfolgte sie durch eine Anpassung des Instituts der notwendigen Verteidigung und somit ausschließlich durch eine Begründetheitsprüfung. Wesentlicher Bestandteil der Neuregelung ist auch die Vorverlagerung der verpflichtenden Verteidigerbestellung in das Ermittlungsverfahren, insbesondere vor die erste Vernehmung des Beschuldigten. Damit soll ein Perspektivwechsel weg von der Hauptverhandlung, hin zum Ermittlungsverfahren vollzogen werden, der durch die wachsende Erkenntnis über die weichenstellende Bedeutung des Ermittlungsverfahrens veranlasst ist.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einführung
- I. Anlass und Ziel der Untersuchung
- II. Methodik und Gang der Untersuchung
- B) Europarechtliche Vorgaben
- I. Das Recht auf ein faires Verfahren gemäß Art. 6 EMRK
- II. Das Urteil Salduz vs. Türkei
- III. Der europäische Fahrplan zur Stärkung der Beschuldigtenrechte
- IV. Richtlinie (EU) 2013/48
- V. Richtlinie (EU) 2016/1919
- VI. Richtlinie (EU) 2016/800
- C) Die Ausgangsituation im deutschen Recht
- I. Das Recht auf ein faires Verfahren
- II. Das Institut der notwendigen Verteidigung und seine Abgrenzung zur Prozesskostenhilfe
- D) Die Umsetzung der Richtlinien in nationales deutsches Recht
- I. Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung
- 1. Grundlagen
- 2. § 140 StPO: Notwendige Verteidigung
- a) § 140 Abs. 1 StPO: Katalog
- b) § 140 Abs. 2 StPO: Generalklausel
- 3. § 141 StPO: Zeitpunkt der Bestellung eines Pflichtverteidigers
- a) § 141 Abs. 1 StPO: Antrag des Beschuldigten
- b) § 141 Abs. 2 StPO: Bestellung von Amts wegen
- 4. § 141a StPO: Vernehmung und Gegenüberstellungen vor der Bestellung eines Pflichtverteidigers im Vorverfahren
- 5. § 142 StPO: Zuständigkeiten und Bestellungsverfahren
- II. Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren
- 1. Grundlagen
- 2. § 68 JGG: Notwendige Verteidigung
- 3. § 68a JGG: Zeitpunkt der Bestellung eines Pflichtverteidigers
- 4. § 68b JGG: Vernehmung und Gegenüberstellung vor der Bestellung eines Pflichtverteidigers
- III. Autonomie und Pflichtverteidigung
- E) Exemplarische Rechtsvergleichung
- I. Österreich
- II. Niederlande
- III. Litauen
- IV. Systemvergleich
- F) Auswirkungen auf die polizeiliche Sachbearbeitung
- I. Die Problematik der erforderlichen Sanktionsprognose
- II. Erzieherische Einwirkung auf den Beschuldigten im Jugendstrafverfahren
- III. Der Grundsatz der Beschleunigung im Strafverfahren
- IV. Die Bearbeitung von Eilfällen
- V. Die erforderliche Belehrung über die Möglichkeit der Pflichtverteidigerbestellung
- VI. Die Einschränkung der Aussagefreiheit
- VII. Audiovisuelle Aufzeichnung von Vernehmungen
- G) Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung und des Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren auf die polizeiliche Sachbearbeitung. Sie untersucht, wie die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1919 und der Richtlinie (EU) 2016/800 im deutschen Strafprozessrecht die Praxis der polizeilichen Vernehmung und die Rechte des Beschuldigten beeinflussen.
- Analyse der europarechtlichen Vorgaben zur Stärkung der Beschuldigtenrechte
- Umsetzung der Richtlinien im deutschen Recht, insbesondere die Neuregelung der notwendigen Verteidigung
- Auswirkungen auf die polizeiliche Sachbearbeitung, z.B. bei der Vernehmung von Beschuldigten
- Rechtliche Herausforderungen und praktische Probleme in der Anwendung des neuen Rechts
- Vergleichende Betrachtung der Rechtslage in anderen europäischen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik, in der der Anlass und die Zielsetzung der Untersuchung erläutert werden. Anschließend werden die europarechtlichen Vorgaben, insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren gemäß Art. 6 EMRK, das Urteil Salduz vs. Türkei sowie die relevanten Richtlinien (EU) 2013/48, (EU) 2016/1919 und (EU) 2016/800, analysiert.
Im dritten Kapitel wird die Ausgangslage im deutschen Recht dargestellt, insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren und das Institut der notwendigen Verteidigung. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Umsetzung der Richtlinien in nationales deutsches Recht. Hier werden die beiden Gesetze zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung und zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren im Detail untersucht.
Es folgt eine exemplarische Rechtsvergleichung mit Österreich, den Niederlanden und Litauen, um die deutsche Rechtslage in einen internationalen Kontext einzuordnen. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Rechtsänderungen auf die polizeiliche Sachbearbeitung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden zentralen Themen und Begriffen: Recht auf ein faires Verfahren, notwendige Verteidigung, Pflichtverteidiger, Prozesskostenhilfe, Richtlinie (EU) 2016/1919, Richtlinie (EU) 2016/800, polizeiliche Sachbearbeitung, Vernehmung, Beschuldigtenrechte, Jugendstrafverfahren.
- Quote paper
- Stefan Scheffer (Author), 2022, Pflichtverteidigung ab der ersten Stunde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1281751