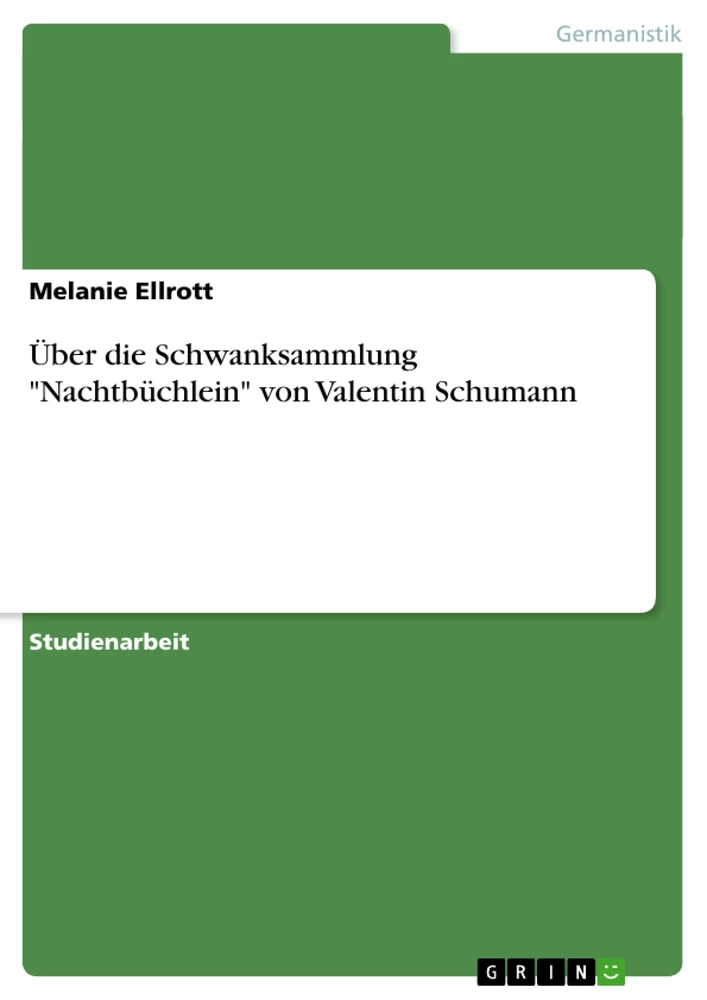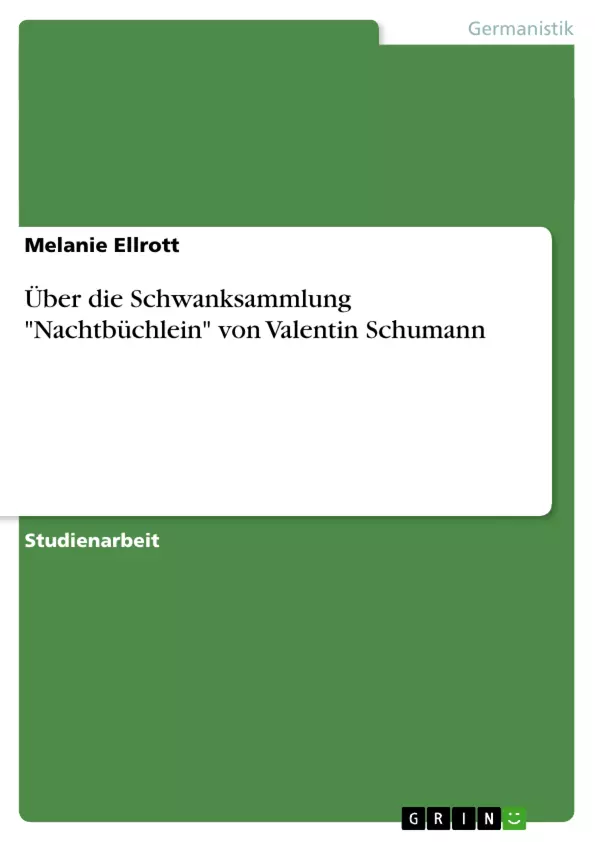Vorab ist festzustellen, dass aufgrund der Nähe zu anderen epischen Kleinformen, wie z.B. Anekdote, Märchen, Märe, Witz u.a. es schwierig ist, eine sich davon abgrenzende, gültige Definition zu entwickeln.
Das Wort 'Schwank' kommt ursprünglich aus dem Mittelhochdeutschen (swanc: leicht zu schwingen) bedeutet Schwung, Hieb, Streich, und daher: die Erzählung eines Streichs.
Der Schwank ist eine kurze, meist realistische Erzählung in Versen oder Prosa mit einer Pointe, die einen lustigen Einfall oder eine komische Begebenheit wiedergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätzliches zur Gattung Schwank
- Biographie des Autors
- Werk
- Ausgaben
- Quellen
- Formeller Aufbau
- Formelle Merkmale
- Sprache/Stilistische Mittel
- Erzählverhalten
- Schwankcharakter
- Unterteilung der Schwänke in Klassen
- Genrebilder
- Wirkung bei der Rezeption
- Handlungstypus eines Schwankes
- Vergleich 'Nachtbüchlein' vs. 'Schimpf und Ernst'
- Wirkung
- Literarischer Wert
- Soziologische Aspekte in den Schwänken
- Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Schwanksammlung 'Nachtbüchlein' von Valentin Schumann und untersucht die Besonderheiten dieser Textsorte im Kontext der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur. Die Arbeit befasst sich mit der Gattung des Schwanks, der Biographie des Autors, dem Aufbau und den formalen Merkmalen des 'Nachtbüchleins' sowie der soziologischen Aspekte der in den Schwänken dargestellten Geschichten.
- Gattung des Schwanks und ihre Abgrenzung zu anderen epischen Kleinformen
- Biographie und Werk des Autors Valentin Schumann
- Formelle Merkmale des 'Nachtbüchleins', insbesondere Sprache und Stil
- Analyse der Schwänke hinsichtlich ihrer Charakteristika und Wirkung
- Soziologische Aspekte der Schwänke und ihre Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beleuchtet zunächst die Gattung des Schwanks, wobei die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition aufgrund der Nähe zu anderen epischen Kleinformen hervorgehoben werden. Anschließend wird die Biographie des Autors Valentin Schumann anhand der wenigen verfügbaren Informationen aus dem 'Nachtbüchlein' selbst und aus Sekundärliteratur dargestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Werk 'Nachtbüchlein' und behandelt die verschiedenen Ausgaben, die Quellen, aus denen Schumann schöpfte, sowie den formalen Aufbau der Sammlung. Dabei wird deutlich, dass Schumann sich auf eine Vielzahl von literarischen Vorbildern stützte und diese in seinen eigenen Schwänken adaptierte.
Im dritten Kapitel werden die formalen Merkmale des 'Nachtbüchleins' untersucht, insbesondere die Sprache und die stilistischen Mittel, die Schumann einsetzt. Die Analyse zeigt, dass die Schwänke in Frühneuhochdeutsch verfasst sind und sich durch eine lebendige Sprache und eine Vielzahl von sprachlichen Besonderheiten auszeichnen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Schwankcharakter und untersucht die Unterteilung der Schwänke in Klassen, die Genrebilder, die in den Schwänken dargestellt werden, sowie die Wirkung der Schwänke auf die Rezeption.
Das fünfte Kapitel analysiert den Handlungstypus eines Schwanks und untersucht die typischen Elemente, die in den Schwänken des 'Nachtbüchleins' vorkommen.
Das sechste Kapitel vergleicht das 'Nachtbüchlein' mit der bekannten Schwanksammlung 'Schimpf und Ernst' von Johann Pauli und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Werken.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Wirkung des 'Nachtbüchleins' und untersucht den literarischen Wert der Sammlung.
Das achte Kapitel widmet sich den soziologischen Aspekten der Schwänke und untersucht, wie die Geschichten die gesellschaftliche Ordnung kritisieren und die Lebenswelt des 16. Jahrhunderts widerspiegeln.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Textsorte Schwank, die Schwanksammlung 'Nachtbüchlein' von Valentin Schumann, die Biographie des Autors, die formalen Merkmale des Werkes, die Analyse der Schwänke hinsichtlich ihrer Charakteristika und Wirkung sowie die soziologischen Aspekte der Schwänke und ihre Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung. Die Arbeit beleuchtet die Gattung des Schwanks im Kontext der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literatur und untersucht die Besonderheiten dieser Textsorte anhand des 'Nachtbüchleins'.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Gattung "Schwank" aus?
Ein Schwank ist eine kurze, realistische Erzählung mit einer Pointe, die meist eine komische Begebenheit oder einen listigen Streich wiedergibt.
Wer war Valentin Schumann?
Valentin Schumann war der Autor der Schwanksammlung "Nachtbüchlein", die im 16. Jahrhundert erschien und wichtige Einblicke in die damalige Lebenswelt bietet.
Welche Themen werden im "Nachtbüchlein" behandelt?
Das Werk enthält Genrebilder des Alltags und übt oft Kritik an der gesellschaftlichen Ordnung durch humorvolle Darstellung menschlicher Schwächen.
Wie unterscheidet sich das "Nachtbüchlein" von "Schimpf und Ernst"?
Die Arbeit vergleicht Schumanns Werk mit der bekannten Sammlung von Johann Pauli hinsichtlich Aufbau, Quellen und erzählerischer Wirkung.
Welchen literarischen Wert hat die Sammlung heute?
Das "Nachtbüchlein" gilt als bedeutendes Zeugnis der frühneuhochdeutschen Literatur und der Entwicklung komischer Kleinformen in der Prosa.
- Arbeit zitieren
- Melanie Ellrott (Autor:in), 2004, Über die Schwanksammlung "Nachtbüchlein" von Valentin Schumann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128176