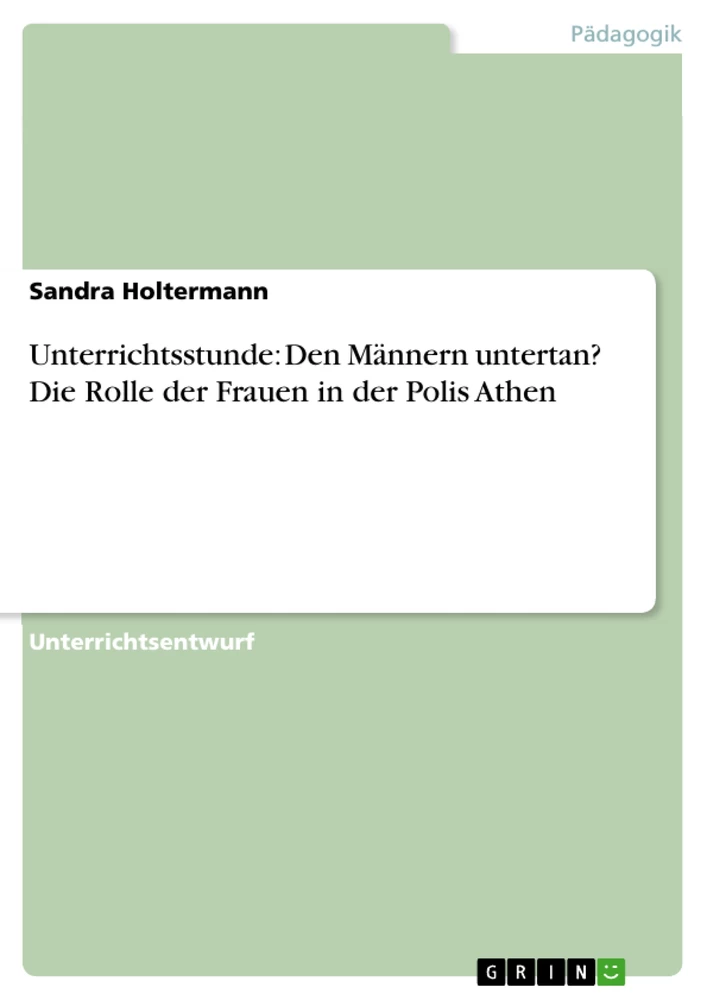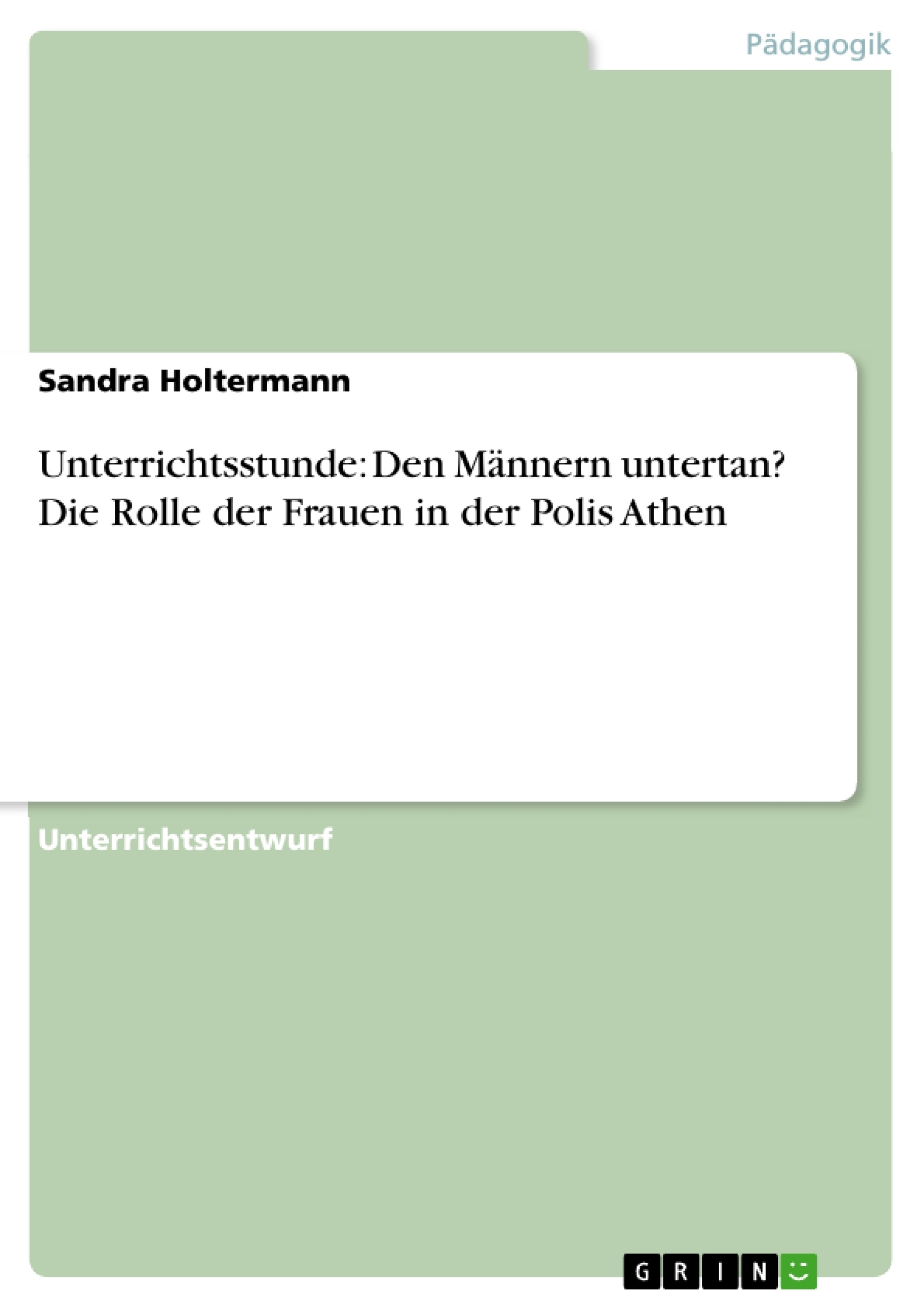Ausführlicher Unterrichtsentwurf im Reihenthema "Das antike Griechenland". Stundenziel war die Erarbeitung, Darstellung und Analyse eines Standbildes zum Verhältnis von Mann und Frau in der Polis Athen.
Inhaltsverzeichnis
- Lerngruppenanalyse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse und Begründung
- Die Stunde im Unterrichtszusammenhang
- Methodische Entscheidungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Stunde zielt darauf ab, die Rolle der Frauen in der Polis Athen zu analysieren und mit dem heutigen Frauenbild in Deutschland zu vergleichen. Dabei werden die Schüler mit Hilfe von Quellentexten und Standbildern die Arbeitsteilung und das Rollenverständnis in der antiken Gesellschaft erforschen.
- Das Frauenbild in der antiken Polis Athen
- Die Rolle der Frau in der Hauswirtschaft und im öffentlichen Leben
- Die Bedeutung von Quellentexten für die historische Forschung
- Der Vergleich des antiken Frauenbilds mit dem heutigen Frauenbild
- Die Bedeutung von Standbildern als Darstellungsform
Zusammenfassung der Kapitel
Lerngruppenanalyse
Die Lerngruppe ist dem Fach Geschichte gegenüber positiv eingestellt und beteiligt sich aktiv am Unterricht. Die Schüler sind offen und aufgeschlossen, wobei einige von der Wichtigkeit ihrer Meldungen überzeugt sind und diese nur ungern zurückhalten. Im Unterrichtsgespräch suchen die Schüler noch sehr als Ansprechpartnerin und Lehrperson, die ihre Äußerungen bewertet. Mit Quellen- und Darstellungstexten haben die Schüler zum überwiegenden Teil kaum Probleme, sofern sie der Altersstufe angemessen sind. Die Arbeit in Gruppen funktioniert gut, wenngleich mitunter die Kommunikation nicht im Sinne der erteilten Arbeitsaufträge verläuft. Mit dem geplanten Produkt des Standbildes haben die Schüler bereits Erfahrung sammeln können.
Sachanalyse
Der Dichter Homer beschreibt in seiner „Odyssee“ das Ideal der Frau als geduldige und treue Gattin, die sich um Haus und Haushalt kümmert. Die Lebenswelt eines griechischen Ehepaares war bipolar: Der Mann war im öffentlichen Leben aktiv, während die Frau im Haus blieb und sich um die Hauswirtschaft kümmerte. Dieses Ideal wurde auch von Philosophen wie Xenophon und Aristoteles vertreten, die in ihren Texten die Arbeitsteilung und die Herrscherrolle des Mannes über Frauen und Kinder begründeten.
Didaktische Analyse und Begründung
Das Stundenthema ist im neu erschienenen Kerncurriculum für die Jahrgänge 5-10 dem Punkt „Die SuS erklären die athenische Demokratie als neue Form des Zusammenlebens" zuzuordnen. Die Schüler leben selbst in einer Zeit, in der die „klassischen“ Rollenbilder immer stärker überwunden werden. Gleichzeitig befinden sie sich in einer Entwicklungsphase, in der sie beginnen, ihre Geschlechterrollen bewusster wahrzunehmen und sich in diesem Zusammenhang mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rolle der Frauen in der Polis Athen, das antike Frauenbild, die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, die historische Quellenanalyse, die Bedeutung von Standbildern als Darstellungsform und den Vergleich des antiken Frauenbilds mit dem heutigen Frauenbild.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen in der Polis Athen?
Frauen waren primär für den Haushalt (Oikos) zuständig und lebten weitgehend getrennt vom öffentlichen Leben, das den Männern vorbehalten war.
Was war das Frauenideal nach Homer?
Das Ideal war die geduldige und treue Gattin, die sich im Haus um die Wirtschaft und die Erziehung der Kinder kümmerte.
Wie begründeten antike Philosophen die Rollenverteilung?
Philosophen wie Aristoteles und Xenophon sahen die Herrschaft des Mannes über die Frau als naturgegeben und durch die unterschiedlichen Aufgabenbereiche gerechtfertigt an.
Was ist ein Standbild im Geschichtsunterricht?
Ein Standbild ist eine methodische Form, bei der Schüler historische Beziehungen oder Rollenbilder körperlich darstellen, um diese zu analysieren.
Wie wird der Bezug zur heutigen Zeit hergestellt?
Die Schüler vergleichen das antike Frauenbild mit dem heutigen Rollenverständnis in Deutschland, um den Wandel gesellschaftlicher Werte zu verstehen.
- Quote paper
- Sandra Holtermann (Author), 2008, Unterrichtsstunde: Den Männern untertan? Die Rolle der Frauen in der Polis Athen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128202