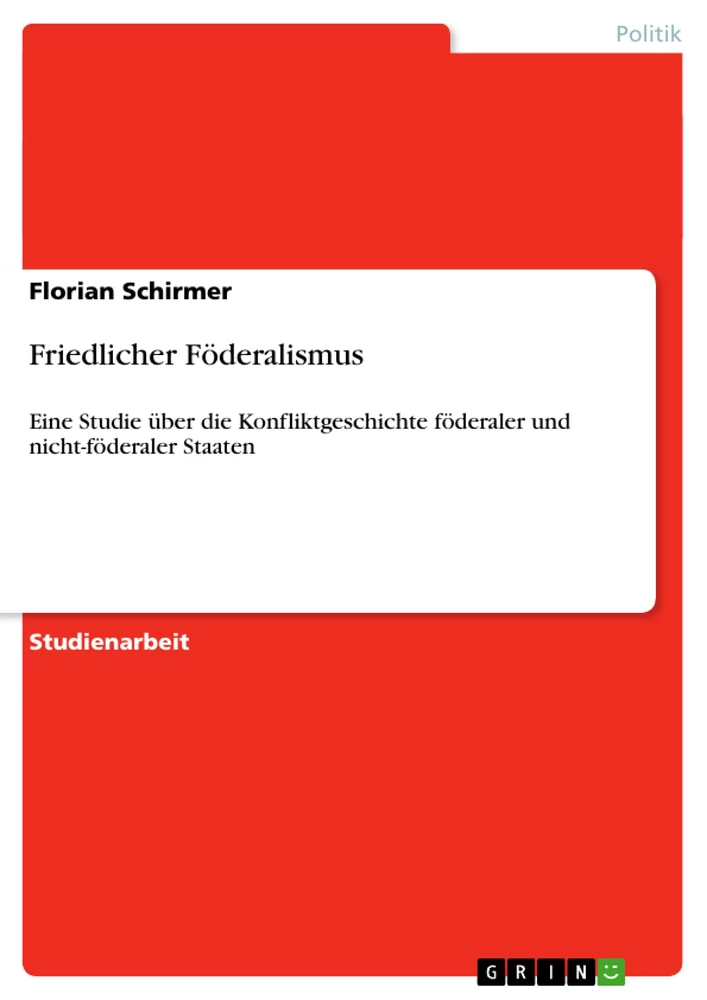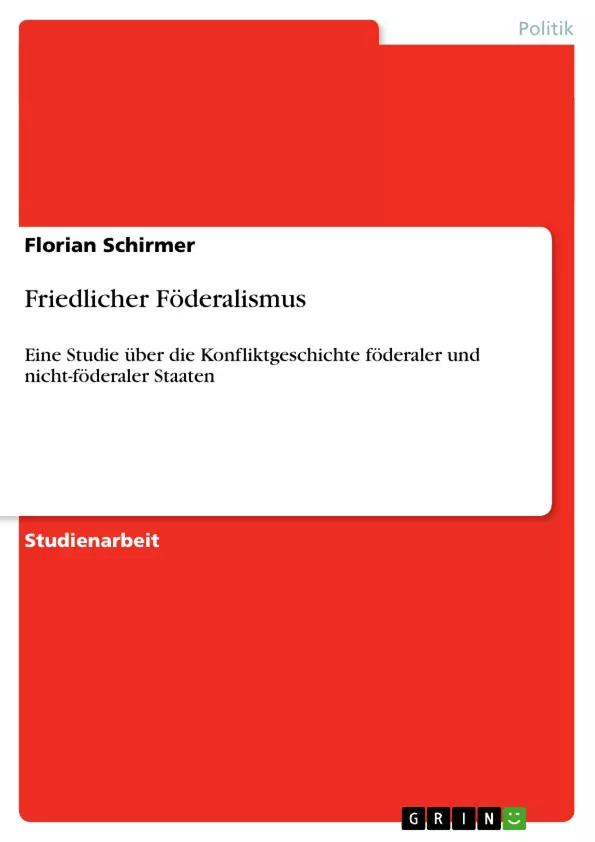Die politikwissenschaftliche Theorie des Demokratischen Friedens besagt – verkürzt dargestellt – dass demokratische Staaten untereinander weniger zu kriegerischen Handlungen neigen als gegenüber anderen, nicht-demokratischen Staaten. Einen Schritt weiter soll die vorliegende Arbeit gehen, indem sie auf der Suche nach der Grundlage dieses Verhaltens den eigentlichen Staatsaufbau untersucht. Da auch dem Föderalismus oft eine integrative und friedenserhaltende Funktion nachgesagt wird, bildet der föderale Staatsaufbau demokratischer Staaten in diesem Zusammenhang den Fokus der Arbeit. Die Frage die sich hier also stellt lautet: Sind Staaten, die einen föderalen Staatsaufbau aufweisen weniger konfliktanfällig als Staaten nicht-föderalen Aufbaus? und weiter: Was macht Föderalismus in diesem Kontext überhaupt aus?
Um diese empirische Pilotstudie auf eine gute Basis zu stellen, ist zuerst eine schlüssige Definition der notwendigen Begrifflichkeiten notwendig. Den darauf folgenden Teil bildet die Operationalisierung die sich dem Punkt der Methodik unterordnet und dem rein empirischen Teil vorangestellt ist. Im letzten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert sowie weitere Forschungsfragen aufgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik und Indexbildung
- Grundlagen
- Föderalismus: Marmorkuchen & Co.
- Konflikte: Frieden oder Krieg?
- Indexbildung: Was werden wird
- Ergebnisse: Des Friedens föderales Wesen?
- Verfeinerung des Index
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen föderalem Staatsaufbau und Konflikten. Sie zielt darauf ab, die These zu überprüfen, ob föderale Staaten weniger konfliktanfällig sind als nicht-föderale Staaten. Die Arbeit analysiert die Konfliktgeschichte von OECD-Mitgliedstaaten und untersucht, ob und inwiefern der föderale Staatsaufbau einen Einfluss auf die Konfliktdynamik hat.
- Definition und Operationalisierung des Begriffs „Föderalismus“
- Analyse der Konfliktgeschichte von OECD-Mitgliedstaaten
- Entwicklung eines Index zur Messung der Konfliktdynamik
- Beziehung zwischen föderalem Staatsaufbau und Konflikten
- Implikationen für die Theorie des Demokratischen Friedens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas vor. Sie erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit und skizziert den Aufbau der Studie. Kapitel 2 befasst sich mit der Methodik und Indexbildung. Es werden die Grundlagen der Konfliktforschung und des Föderalismus erläutert, sowie die Operationalisierung der beiden Konzepte für die Studie. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die Beziehung zwischen föderalem Staatsaufbau und Konflikten. Es werden die Ergebnisse des entwickelten Index zur Messung der Konfliktdynamik vorgestellt und interpretiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und weitere Forschungsfragen aufwirft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Föderalismus, die Konfliktforschung, den Demokratischen Frieden, die OECD-Mitgliedstaaten, die Konfliktgeschichte, die Indexbildung und die Konfliktdynamik. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen föderalem Staatsaufbau und Konflikten und untersucht, ob und inwiefern der föderale Staatsaufbau einen Einfluss auf die Konfliktdynamik hat. Die Studie verwendet einen Index zur Messung der Konfliktdynamik und analysiert die Daten von OECD-Mitgliedstaaten. Die Ergebnisse der Studie werden im Kontext der Theorie des Demokratischen Friedens diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Sind föderale Staaten friedlicher als zentralistische Staaten?
Die Arbeit untersucht genau diese These. Sie geht der Frage nach, ob ein föderaler Staatsaufbau eine integrative Funktion besitzt, die die Konfliktanfälligkeit eines Staates senkt.
Was ist die Theorie des "Demokratischen Friedens"?
Diese Theorie besagt, dass demokratische Staaten untereinander seltener Kriege führen. Die vorliegende Studie erweitert diesen Ansatz, indem sie den spezifischen Staatsaufbau (Föderalismus) als Faktor einbezieht.
Wie wird Föderalismus in dieser Studie definiert?
Die Arbeit nutzt verschiedene politikwissenschaftliche Modelle (wie das "Marmorkuchen"-Modell), um Föderalismus zu operationalisieren und messbar zu machen.
Welche Staaten wurden für die Untersuchung herangezogen?
Die empirische Pilotstudie konzentriert sich auf die Analyse der Konflikthistorie von OECD-Mitgliedstaaten.
Wie wird die Konfliktdynamik gemessen?
Es wurde ein spezieller Index entwickelt, der verschiedene Grade von Konflikten (von Frieden bis Krieg) erfasst, um die Beziehung zum Staatsaufbau statistisch auswerten zu können.
Was ist das Ziel dieser Pilotstudie?
Ziel ist es, eine schlüssige Basis für die Forschung zur friedenserhaltenden Funktion des Föderalismus zu schaffen und erste empirische Belege für oder gegen die geringere Konfliktanfälligkeit föderaler Systeme zu liefern.
- Arbeit zitieren
- Florian Schirmer (Autor:in), 2009, Friedlicher Föderalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128228