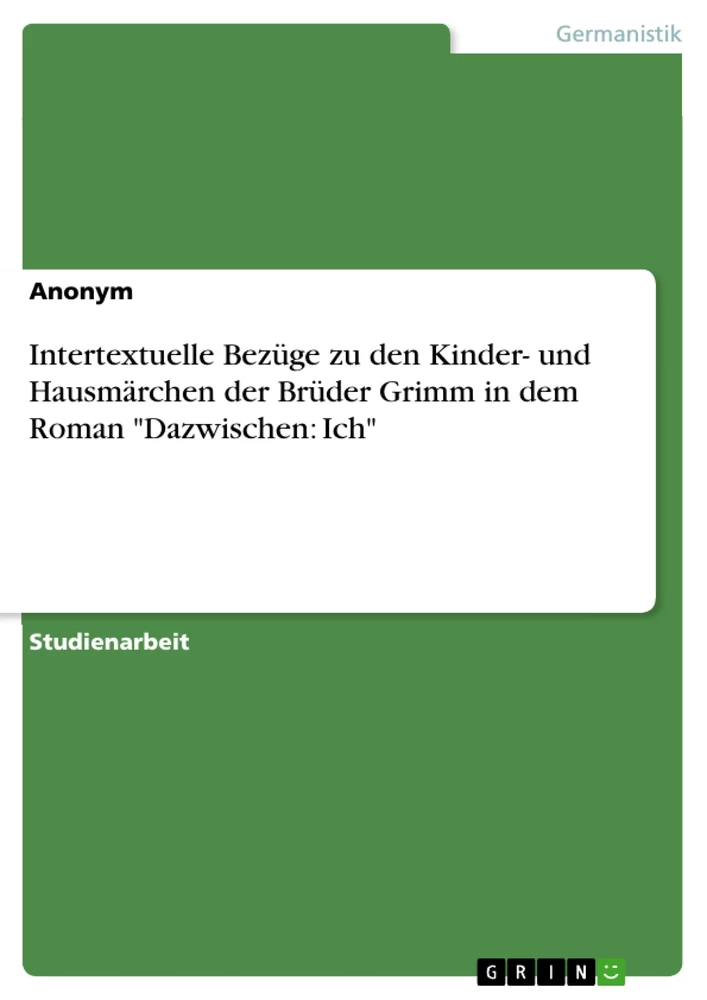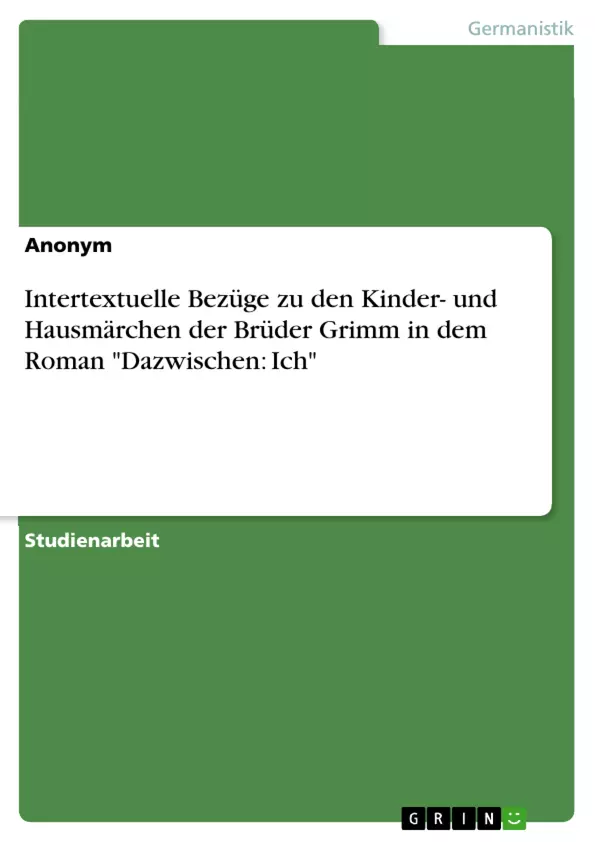Wenn Julya Rabinowich in ihrem Jugendroman "Dazwischen: Ich" Anspielungen auf bekannte Märchen macht, dann tut sie dies bewusst: Sie stellt intertextuelle Bezüge her. Intertextualität in der Kinder- und Jugendliteratur ist kein seltenes Phänomen, vielmehr kann man erkennen, dass ihre Bedeutung zwischen dem späten 20. Jahrhundert und dem frühen 21. Jahrhundert gestiegen ist.
Das Ziel dieser Ausarbeitung liegt darin, zu zeigen, auf welche Art und Weise Julya Rabinowich intertextuelle Bezüge zu bekannten Märchen der Brüder Grimm herstellt. Welche Funktion haben Märchen allgemein und in Bezug auf die Intertextualität in der Kinder- und Jugendliteratur? Diese Fragestellung gilt es dann noch anhand geeigneter Beispiele aus dem Roman zu analysieren. Zum Ende der Ausarbeitung werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf die daraus resultierenden Fragestellungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Märchen
- Kinder- und Hausmärchen
- Merkmale von Volksmärchen
- Die Bedeutung von Märchen in der Kinder- und Jugendliteratur
- Intertextualität
- Märchen der Brüder Grimm in Dazwischen: Ich
- Fazit
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert die intertextuellen Bezüge zwischen dem Jugendroman "Dazwischen: Ich" von Julya Rabinowich und bekannten Märchen der Brüder Grimm. Sie untersucht die Funktion von Märchen in der Kinder- und Jugendliteratur, insbesondere in Bezug auf Intertextualität, und analysiert, wie Rabinowich diese Bezüge in ihrem Roman verwendet.
- Intertextualität in der Kinder- und Jugendliteratur
- Die Rolle von Märchen in der Kinder- und Jugendliteratur
- Die Funktion von Märchen in Bezug auf Intertextualität
- Die Darstellung von Flucht und Vertreibung in "Dazwischen: Ich"
- Die Bedeutung von Märchen für die Protagonistin Madina
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problematik der Intertextualität in der Kinder- und Jugendliteratur dar und beschreibt die Bedeutung von Märchen für Julya Rabinowich und ihre Protagonistin Madina.
- Kinder- und Hausmärchen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Bedeutung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sowie deren Popularität. Es werden die Merkmale von Volksmärchen und die Bedeutung von Märchen in der Kinder- und Jugendliteratur thematisiert.
- Merkmale von Volksmärchen: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Merkmale von Volksmärchen, wie zum Beispiel die fantastische Handlung, die klare Figurenkonstellation und die typische Sprache.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Volksmärchen, "Dazwischen: Ich", Julya Rabinowich, Flucht, Vertreibung, Madina, Tagebucheinträge
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Intertextuelle Bezüge zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm in dem Roman "Dazwischen: Ich", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282431