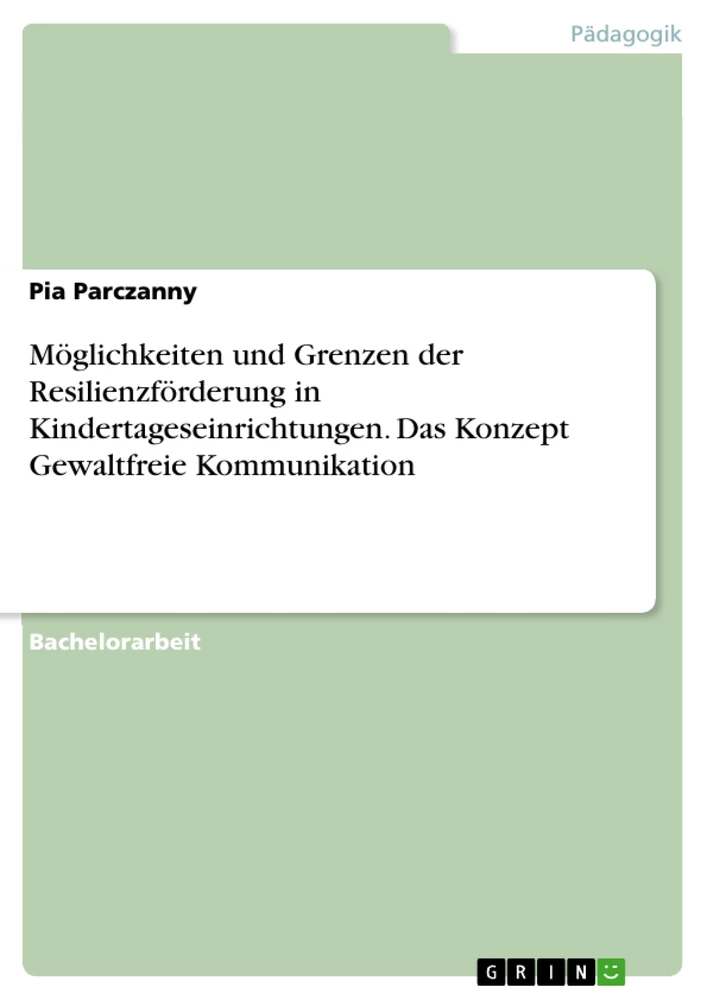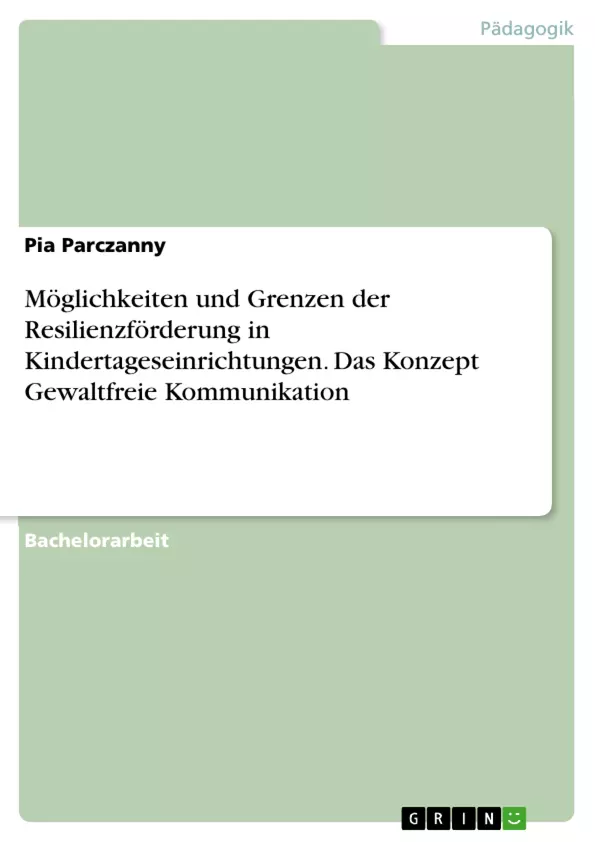Diese Bachelorarbeit widmet sich der Forschungsfrage, welchen Beitrag das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation zur Resilienzförderung in Kindertagesstätten leisten kann. Ziel der Arbeit ist es, die mögliche Rolle der Gewaltfreien Kommunikation innerhalb der Resilienzförderung zu untersuchen und einen Überblick über die vorhandene Literatur zu schaffen.
In den letzten Jahren erschienen vermehrt Elternratgeber und pädagogische Fachliteratur zu den Themen bedürfnisorientierte Erziehung und Kinder stärken. Sie solle Kinder für das Leben stärken und zu einem bewussteren Umgang mit den kindlichen Gefühlen und Bedürfnissen führen. Oftmals bedienen sich diese Ratgeber dabei dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg oder integrieren zumindest Elemente dessen. Das, worauf diese Ratgeberliteratur umgangssprachlich abhebt, ist das Phänomen der Resilienz. Resiliente Kinder sollen widerstandsfähiger sein gegenüber den Belastungen, die das Leben mit sich bringt.
Doch was ist es, das die Kinder resilienter macht, und welche Rolle spielt die Gewaltfreie Kommunikation dabei? Und wie können die Erkenntnisse der Resilienzforschung durch das pädagogische Fachpersonal in Kindertagesstätten eingebunden und umgesetzt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Resilienz
- Risikofaktorenkonzept
- Vulnerabilitätsfaktoren
- Risikofaktoren/Stressoren
- Schutzfaktorenkonzept
- Personale Ressourcen
- Soziale Ressourcen
- Resilienzmodelle
- Rahmenmodell von Resilienz
- Vorstellung relevanter Resilienzstudien
- Kauai-Studie
- Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
- Mannheimer Risikokinderstudie
- Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg
- Beobachtung
- Gefühl
- Bedürfnis
- Bitte
- Empathie
- Emotion und Resilienz
- Resilienzförderprogramme zur Durchführung in Kindertageseinrichtungen
- PriK - Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen
- Allgemeines
- Programmverlauf
- Evaluation
- PriK - Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen
- Diskussion – Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anlage 1
- Anlage 2
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen. Im Fokus steht dabei das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Die Arbeit analysiert verschiedene Resilienzmodelle und Studien, um ein tieferes Verständnis für die Förderung von Resilienz im frühkindlichen Bildungsbereich zu entwickeln.
- Definition und Bedeutung von Resilienz
- Risikofaktoren und Schutzfaktoren im Kontext von Resilienzförderung
- Anwendung des Konzepts der Gewaltfreien Kommunikation zur Stärkung von Resilienz
- Analyse und Bewertung von Resilienzförderprogrammen in Kindertageseinrichtungen
- Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Implementierung von Resilienzförderprogrammen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie führt zudem die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit aus.
- Definition Resilienz: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Resilienz und erklärt seine Bedeutung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Bewältigung von Herausforderungen im Leben.
- Risikofaktorenkonzept: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Faktoren, die die Entwicklung von Resilienz beeinflussen können. Dabei werden sowohl Vulnerabilitätsfaktoren als auch Risikofaktoren/Stressoren analysiert.
- Schutzfaktorenkonzept: Dieses Kapitel widmet sich den Schutzfaktoren, die Kindern helfen, Resilienz zu entwickeln und Herausforderungen besser zu bewältigen. Hier werden personale und soziale Ressourcen im Detail betrachtet.
- Resilienzmodelle: In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle zur Erklärung von Resilienz vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
- Rahmenmodell von Resilienz: Dieses Kapitel präsentiert ein spezifisches Rahmenmodell zur Veranschaulichung der verschiedenen Facetten von Resilienz.
- Vorstellung relevanter Resilienzstudien: Dieses Kapitel beleuchtet ausgewählte empirische Studien, die sich mit der Thematik von Resilienzförderung befassen. Dabei werden die Ergebnisse der Kauai-Studie, der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie und der Mannheimer Risikokinderstudie vorgestellt.
- Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg: Dieses Kapitel stellt das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) vor und erläutert seine Bedeutung für die Förderung von Resilienz.
- Emotion und Resilienz: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Emotionen und Resilienz und untersucht, wie Emotionen die Entwicklung von Resilienz beeinflussen können.
- Resilienzförderprogramme zur Durchführung in Kindertageseinrichtungen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Resilienzförderprogramme für Kindertageseinrichtungen vor, wie zum Beispiel das Programm PriK (Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen).
- Diskussion – Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen: Dieses Kapitel diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen und beleuchtet die Herausforderungen bei der Implementierung von Förderprogrammen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Resilienz, Resilienzförderung, Kindertageseinrichtungen, Gewaltfreie Kommunikation, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Vulnerabilität, emotionale Kompetenz, Empathie, Bedürfnisse, präventive Interventionen, Entwicklungsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Resilienz bei Kindern?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber Belastungen und Krisen im Leben.
Wie hilft Gewaltfreie Kommunikation (GFK) der Resilienz?
GFK nach Marshall Rosenberg fördert die Wahrnehmung von Gefühlen und Bedürfnissen, was die emotionale Kompetenz und soziale Ressourcen stärkt.
Was sind Schutzfaktoren in der Resilienzforschung?
Dazu gehören personale Ressourcen (Selbstwirksamkeit) und soziale Ressourcen (stabile Bindungen zu Bezugspersonen).
Welche Resilienzstudien sind besonders relevant?
Die Arbeit nennt die Kauai-Studie, die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie und die Mannheimer Risikokinderstudie als zentrale Quellen.
Kann Resilienz in der Kita gezielt gefördert werden?
Ja, durch Programme wie „PriK“ (Prävention und Resilienzförderung) können pädagogische Fachkräfte die Widerstandsfähigkeit der Kinder aktiv stärken.
- Citation du texte
- Pia Parczanny (Auteur), 2022, Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen. Das Konzept Gewaltfreie Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282441