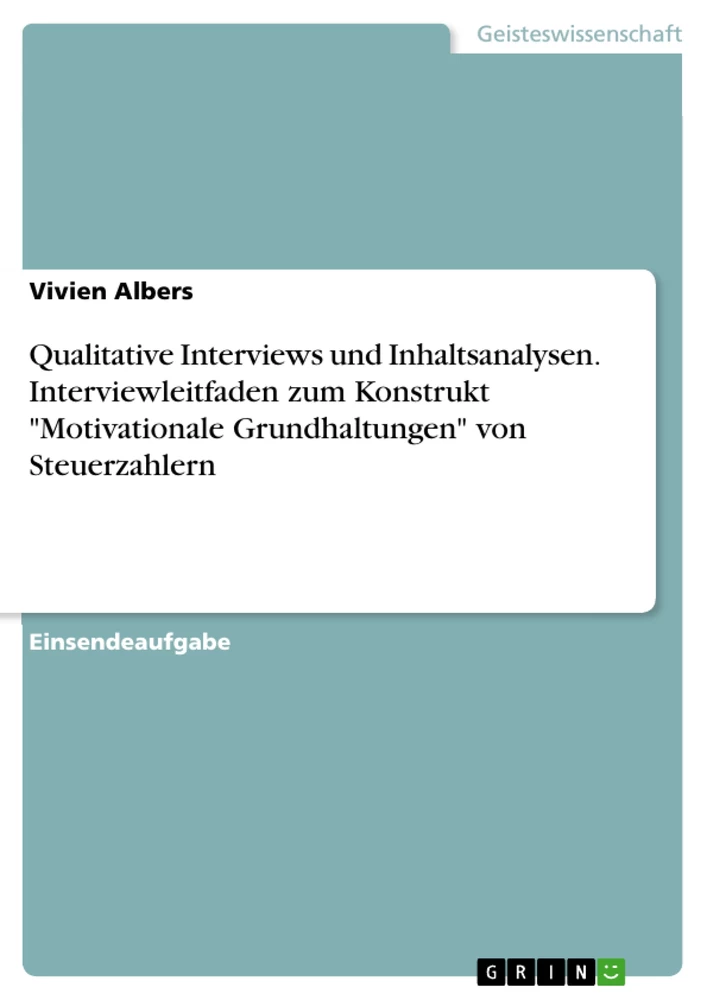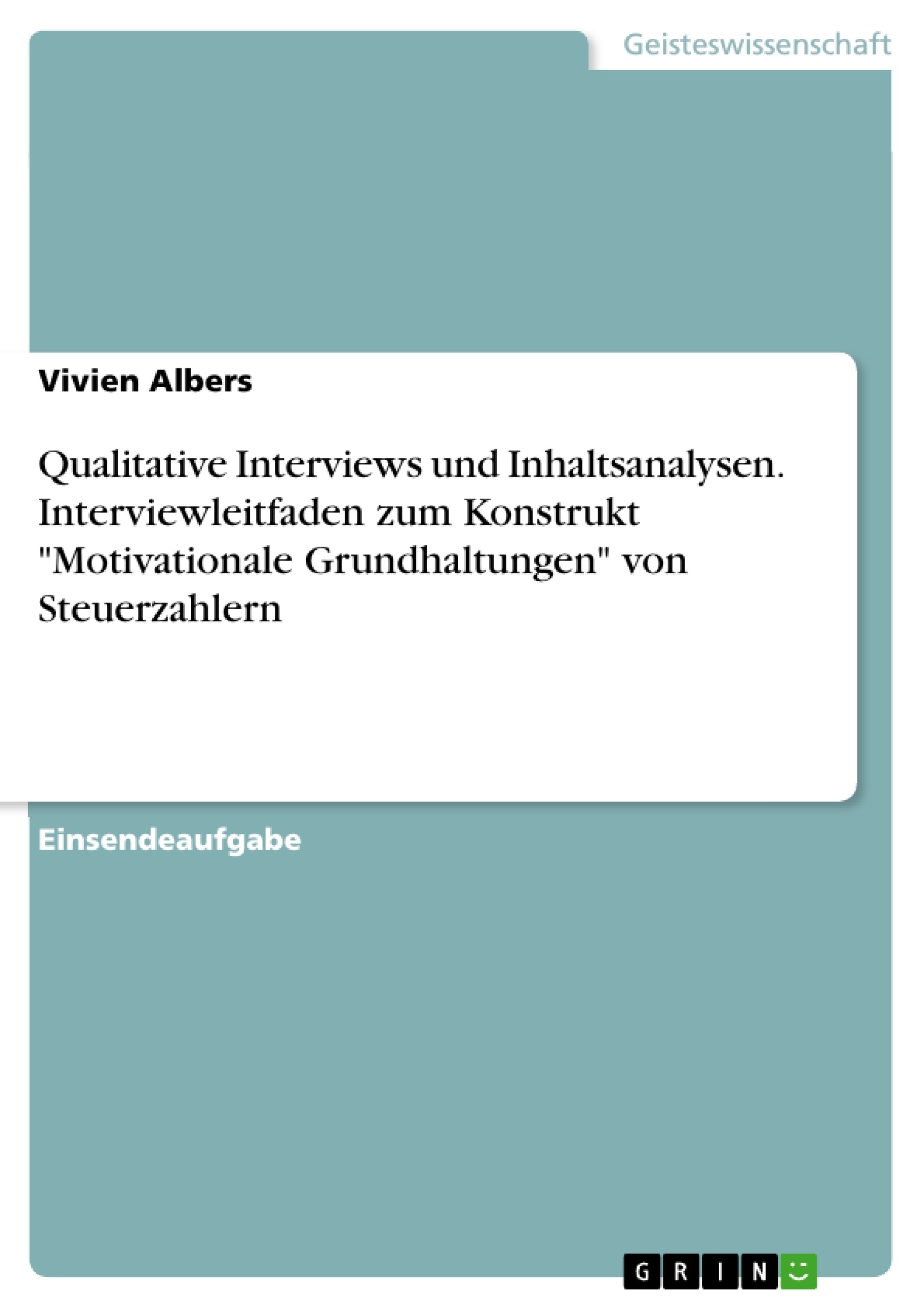Gegenstand der vorliegenden Einsendeaufgabe ist die Operationalisierung des Konstrukts Motivationale Grundhaltung von Steuerzahlern und die Konzeption eines vollständigen qualitativen Interviewleitfadens zur Themenstellung. Das nachstehende Modell zur Messung der motivationalen Grundhaltungen bildet verschiedene Grundpositionen zum Steuerzahlen ab und wurde von Braithwaite 2003 entwickelt. Das Modell unterscheidet fünf motivationale Grundhaltungen: Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement & Game Playing.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Qualitativer Interviewleitfaden zum Konstrukt Motivationale Grundhaltungen von Steuerzahlern
- 1.1 Das Qualitative Leitfadeninterview
- 1.2 Operationalisierung des Konstrukts
- 1.3 Konzeption des Interviewleitfadens
- 1.4 Durchführung des Interviews
- 2. Transkription qualitativer Interviews
- 2.1 Definition
- 2.2 Typische Transkriptionsregeln
- 3. Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.1 Definition und Einsatzmöglichkeiten
- 3.2 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
- 3.3 Ablauf einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse
- 3.4 Unterschiede beider Analysemethoden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Erforschung der motivationalen Grundhaltungen von Steuerzahlern. Sie verfolgt das Ziel, ein Instrument zur Erfassung dieser Haltungen zu entwickeln und anhand qualitativer Methoden zu testen.
- Entwicklung eines qualitativen Interviewleitfadens zur Erfassung motivationaler Grundhaltungen
- Anwendung verschiedener qualitativer Methoden zur Datenanalyse, insbesondere der qualitativen Inhaltsanalyse
- Vergleich verschiedener Auswertungsformen der qualitativen Inhaltsanalyse
- Identifizierung und Analyse der verschiedenen Motivationen und Einstellungen von Steuerzahlern
- Beitrag zur Weiterentwicklung der Forschung im Bereich der Steuermoral und Steuergerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 befasst sich mit der Entwicklung eines qualitativen Interviewleitfadens zur Erfassung motivationaler Grundhaltungen von Steuerzahlern. Es werden verschiedene Aspekte des Leitfadeninterviews, wie die Operationalisierung des Konstrukts und die Konzeption des Leitfadens, sowie die Durchführung der Interviews diskutiert.
Kapitel 2 widmet sich der Transkription qualitativer Interviews und erläutert wichtige Definitionen und Transkriptionsregeln.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse als Methode zur Auswertung der interviewbasierten Daten. Es werden die beiden Formen der Inhaltsanalyse, die inhaltlich strukturierende und die evaluative Inhaltsanalyse, vorgestellt und im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Qualitative Inhaltsanalyse, Motivationale Grundhaltungen, Steuerzahler, Interviewleitfaden, Transkription, Steuermoral, Steuergerechtigkeit, Empirische Forschung
Häufig gestellte Fragen
Welche fünf motivationalen Grundhaltungen von Steuerzahlern gibt es?
Nach dem Modell von Braithwaite (2003) unterscheidet man: Commitment (Verpflichtung), Capitulation (Kapitulation), Resistance (Widerstand), Disengagement (Abkehr) und Game Playing (Umgehung/Spiel mit Regeln).
Was ist das Ziel eines qualitativen Interviewleitfadens in diesem Kontext?
Der Leitfaden dient dazu, die tiefliegenden Einstellungen und Motivationen von Steuerzahlern durch offene Fragen systematisch zu erfassen und wissenschaftlich auswertbar zu machen.
Was bedeutet Operationalisierung eines Konstrukts?
Operationalisierung bedeutet, abstrakte Begriffe wie „Steuermoral“ in messbare Indikatoren oder konkrete Interviewfragen zu übersetzen, um sie empirisch untersuchen zu können.
Welche Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse werden vorgestellt?
Die Arbeit erläutert die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (Themenfokus) und die evaluative Inhaltsanalyse (Bewertungsfokus) sowie deren Unterschiede.
Warum ist die Transkription von Interviews notwendig?
Die Transkription überführt das gesprochene Wort in eine schriftliche Form, was die Voraussetzung für eine präzise und nachvollziehbare wissenschaftliche Analyse der Daten ist.
- Quote paper
- Vivien Albers (Author), 2021, Qualitative Interviews und Inhaltsanalysen. Interviewleitfaden zum Konstrukt "Motivationale Grundhaltungen" von Steuerzahlern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282467