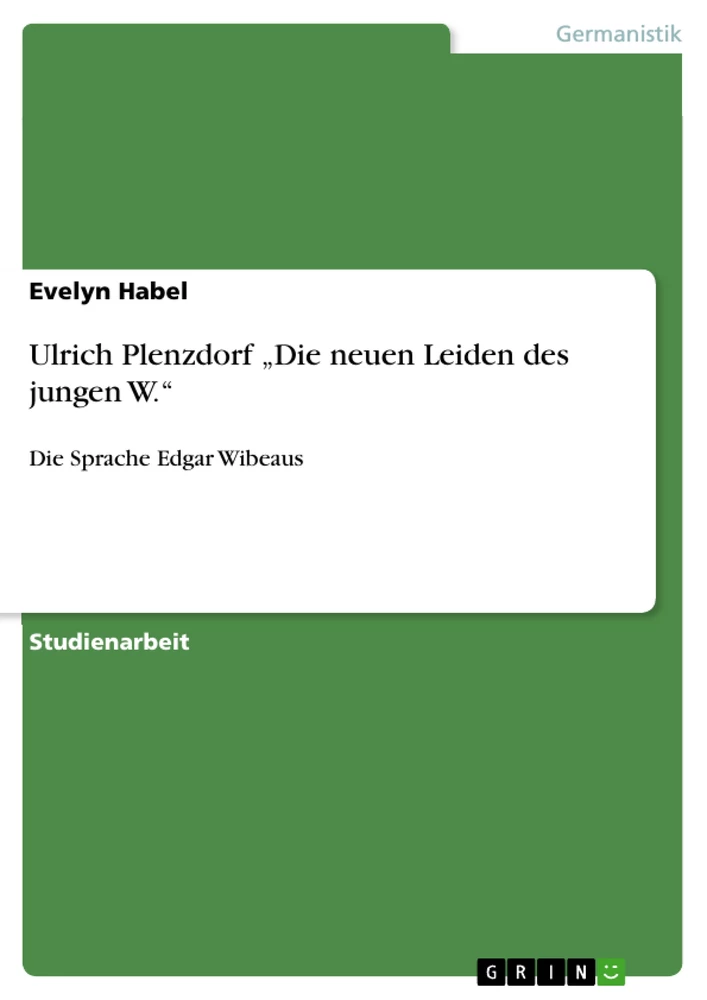„Berühmt geworden ist Plenzdorf genau in dem Augenblick, als er gerade kein Drehbuch schrieb, sondern einen Roman. Er handelt vom 17-jährigen Lehrling Edgar Wibeau, den alle nur Wibeau nennen, weil die DDR kein besonders sublimiertes Land ist und deshalb auch nichts von besonders sublimierten Aussprachen hält. (…) Wibeau, verkannter van Goch (Originalton Wibeau), Salinger- Enthusiast, emigriert in die Berliner Gartenlaube eines Freundes und findet dort, auf dem Plumpsklo, die Geschichte eines verwandten Geistes, in allermerkwürdigstem Deutsch – »Die Leiden des jungen Werthers« von Goethe.
Diese Geschichte dieser Plumpsklo-Lektüre wurde in mehr als dreißig Sprachen übersetzt und hat bis heute über vier Millionen Gesamtauflage, allein 2,4 Millionen beim Suhrkamp-Verlag. Plenzdorf legte mit Unterstützung von »Old Werther« die Totalkritik des spezifischen DDR-Spießertums vor.“
Der Roman ist zu einer Zeit der kulturpolitischen Entspannung entstanden. Der Grundgedanke entstand 1968 aus einem intensiven Studium mit Goethes „Werther“ und wahrscheinlich durch die eigenen Erfahrungen von Plenzdorf, welcher auch eine Lehre abgebrochen hat. Plenzdorfs Edgar Wibeau ist ein Jugendlicher, der seinen Platz in der Gesellschaft sucht, von der er sich eigentlich unverstanden fühlt. Er kann sich mit ihr nicht identifizieren, weil sie ihn einschränkt. Obwohl die heutigen Leser einen anderen politischen Hintergrund haben, ist dieser Stoff ein zeitloses Thema und nicht ausschließlich Problematik der DDR-Jugend. Junge Menschen sind meist diejenigen, die ausbrechen und das vorgeschriebene verändern wollen. Sie hinterfragen die Gegebenheiten und versuchen eigene Wege zu gehen. Manchen gelingt dieser Ausbruch, andere scheitern daran und werden wieder in das Gesellschaftssystem „eingefügt“.
In dieser Arbeit soll vordergründig die Sprache Edgars erläutert werden, denn Plenzdorf gelingt es mit der Jugendsprache die Probleme von Edgar realistisch und ansprechend darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textbetrachtung
- Erzählstruktur
- Die Sprache Edgar Wibeaus
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Sprache des Protagonisten Edgar Wibeau in Ulrich Plenzdorfs Roman „Die neuen Leiden des jungen W.“. Ziel ist es, die Besonderheiten von Edgars Sprache im Kontext der DDR-Jugendsprache der 1970er Jahre zu beleuchten und ihre Bedeutung für die Darstellung von Edgars Lebenswelt und seiner inneren Konflikte zu untersuchen.
- Die Sprache als Ausdruck von Identität und Rebellion
- Die Verwendung von Jugendsprache und Slang
- Der Einfluss von Goethes „Werther“ auf Edgars Sprache
- Die Rolle der Sprache in der Darstellung von Edgars Selbstfindung
- Die Sprache als Mittel der Kritik an der DDR-Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Roman „Die neuen Leiden des jungen W.“ sowie die Figur des Edgar Wibeau vor. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung des Romans und die Bedeutung von Plenzdorfs Werk für die DDR-Literatur.
Der Abschnitt „Textbetrachtung“ analysiert die Erzählstruktur des Romans. Dabei wird die Verwendung der Retroperspektive, die Wechsel zwischen Kommentar- und Handlungsebene sowie die Bedeutung von Dialogen und Zitaten aus Goethes „Werther“ für die Darstellung der Handlung untersucht.
Der Abschnitt „Die Sprache Edgar Wibeaus“ befasst sich mit der sprachlichen Gestaltung der Figur des Edgar Wibeau. Es werden die Besonderheiten seiner Sprache im Kontext der DDR-Jugendsprache der 1970er Jahre analysiert, wobei der Einfluss von Salingers „Der Fänger im Roggen“ sowie die Rolle der Sprache in der Darstellung von Edgars Selbstfindung und Rebellion beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sprache Edgar Wibeaus, die DDR-Jugendsprache der 1970er Jahre, die Darstellung von Identität und Rebellion, den Einfluss von Goethes „Werther“, die Rolle der Sprache in der Selbstfindung und die Kritik an der DDR-Gesellschaft.
- Citar trabajo
- Evelyn Habel (Autor), 2005, Ulrich Plenzdorf „Die neuen Leiden des jungen W.“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128353