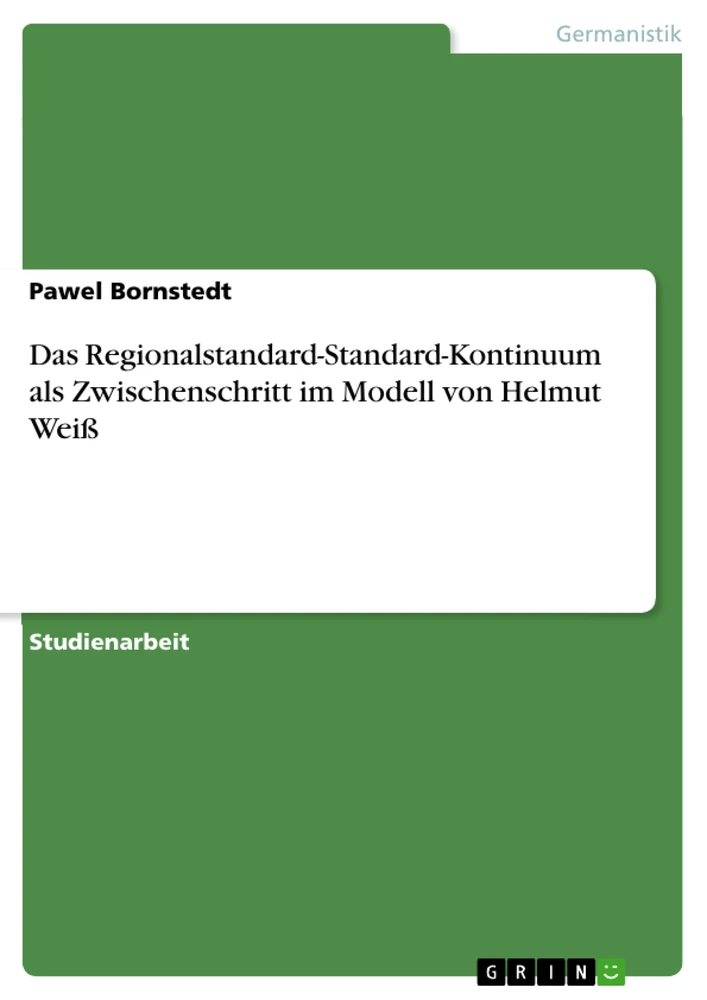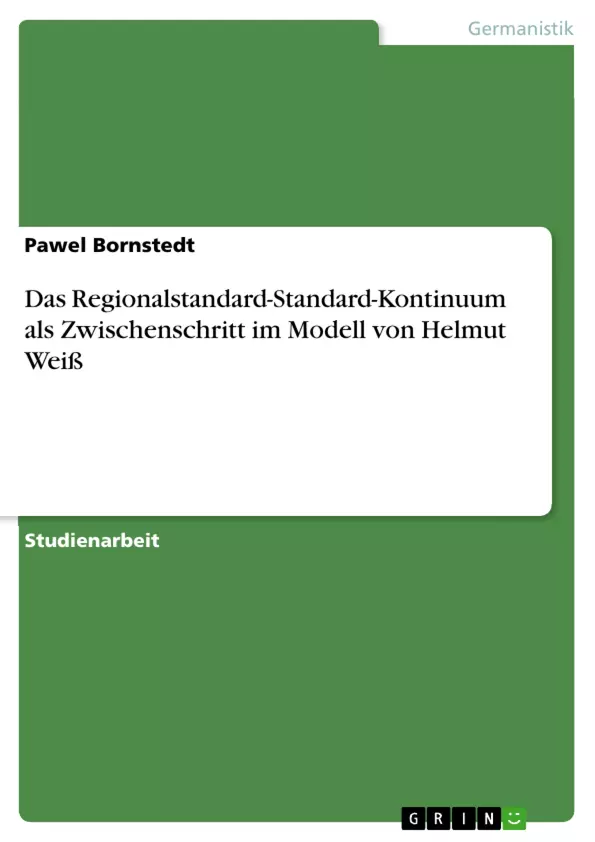Diese Arbeit vertritt die These, dass die aktuelle Lage des Deutschen in Deutschland im Modell von Weiß einen zusätzlichen Zwischenschritt erforderlich macht, nämlich den Zwischenschritt eines Regionalstandard-Standard-Kontinuums. Das Dialekt-Standard-Kontinuum ist tatsächlich im Wandel – die Dialekte schwinden zwar, doch (noch) sind sie weder vollends verschwunden, noch ist der Nonstandard frei von unterschiedlichen regionalen Markierungen. Vielmehr scheinen Regiolekte die Dialekte abzulösen und dabei selbst zu Regionalstandards zu werden, während simultan der überregionale Nonstandard diese Entwicklung zwar beeinflusst, aber nicht dominiert. Somit muss die vierte Phase beim Modell von Weiß erst noch erreicht werden, die dritte Phase ist jedoch auch nicht mehr zutreffend. Interessanterweise wurde genau diese Entwicklung (sogar mitsamt Denaturierungstendenzen) bereits in den 1990ern prognostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Dialekt-Standard-Kontinuum
- III. Das Nonstandard-Standard-Kontinuum
- IV. Das Regionalstandard-Standard-Kontinuum
- IV.1. Nativierung des Standarddeutschen
- IV.2. Funktion und Prestige
- IV.3. Bevölkerungsentwicklung
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Dialekt-Standard-Kontinuums im Deutschen und argumentiert, dass die aktuelle Situation im Modell von Helmut Weiß einen zusätzlichen Zwischenschritt erfordert, nämlich das Regionalstandard-Standard-Kontinuum. Dieser Schritt spiegelt den Wandel wider, der die Dialekte zwar nicht völlig auslöscht, aber ihre Dominanz durch Regionalstandards ersetzt, die durch den überregionalen Nonstandard beeinflusst, aber nicht dominiert werden.
- Der Wandel vom Dialekt-Standard-Kontinuum zum Regionalstandard-Standard-Kontinuum
- Die Bedeutung des Regionalstandards als "Variante des Standarddeutschen im jeweiligen regionalen Kontext"
- Die Nativierung des Standarddeutschen und die Stärkung der Regionalstandards
- Der Funktions- und Prestigeverlust der Dialekte zugunsten der Regionalstandards
- Die Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen auf die langfristige Erhaltung der Regionalstandards
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Dialekt-Standard-Kontinuums ein und stellt die These der Arbeit vor: Die aktuelle Lage des Deutschen in Deutschland erfordert im Modell von Weiß einen zusätzlichen Zwischenschritt - das Regionalstandard-Standard-Kontinuum.
- II. Das Dialekt-Standard-Kontinuum: Dieses Kapitel erläutert das Dialekt-Standard-Kontinuum, das die Varietätenvielfalt zwischen Dialekt und Standard darstellt. Es werden verschiedene Fachtermini für die einzelnen Bereiche des Kontinuums geklärt, um Klarheit für die weitere Diskussion zu schaffen.
- III. Das Nonstandard-Standard-Kontinuum: Dieses Kapitel behandelt den Wandel vom Dialekt-Standard-Kontinuum zum Nonstandard-Standard-Kontinuum und erläutert, wie dieser Wandel durch den Dialektschwund in Norddeutschland entstanden ist.
- IV. Das Regionalstandard-Standard-Kontinuum: In diesem Kapitel wird das Regionalstandard-Standard-Kontinuum als zusätzlicher Zwischenschritt im Modell von Weiß vorgestellt. Es wird die Nativierung des Standarddeutschen, der Funktions- und Prestigeverlust der Dialekte und die Bedeutung der Bevölkerungsentwicklung für die langfristige Erhaltung der Regionalstandards diskutiert.
Schlüsselwörter
Das Regionalstandard-Standard-Kontinuum, Dialekt-Standard-Kontinuum, Nonstandard-Standard-Kontinuum, Standardisierung, Nativierung, Dialektschwund, Regionalstandards, Funktionsverlust, Prestigeverlust, Bevölkerungsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale These vertritt die Arbeit zum Modell von Helmut Weiß?
Die Arbeit argumentiert, dass die aktuelle sprachliche Lage in Deutschland einen zusätzlichen Zwischenschritt erfordert: das Regionalstandard-Standard-Kontinuum.
Was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Regionalstandard?
Während Dialekte schwinden, entstehen Regiolekte, die selbst zu Regionalstandards werden – also Varianten des Standarddeutschen mit regionaler Markierung.
Was bedeutet „Nativierung des Standarddeutschen“?
Dies beschreibt den Prozess, bei dem das Standarddeutsche zunehmend als Erstsprache (Muttersprache) erworben wird, dabei aber regionale Färbungen beibehält.
Warum ist das Modell von Weiß in seiner ursprünglichen Form nicht mehr zutreffend?
Laut der Arbeit ist die dritte Phase des Modells überholt, die vierte Phase (völliges Verschwinden regionaler Merkmale) aber noch nicht erreicht.
Welchen Einfluss hat das Prestige auf diese Entwicklung?
Der Funktions- und Prestigeverlust der traditionellen Dialekte führt dazu, dass Sprecher eher zu Regionalstandards greifen, die ein höheres soziales Ansehen genießen.
- Quote paper
- Pawel Bornstedt (Author), 2022, Das Regionalstandard-Standard-Kontinuum als Zwischenschritt im Modell von Helmut Weiß, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1284347